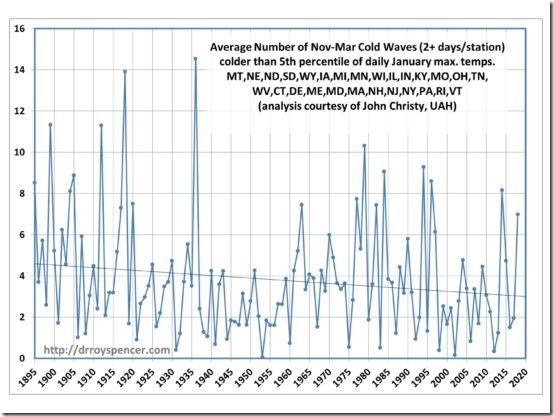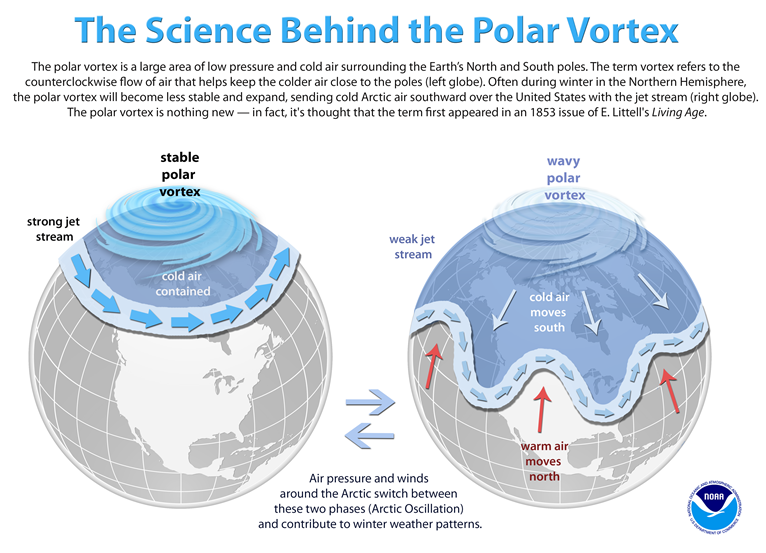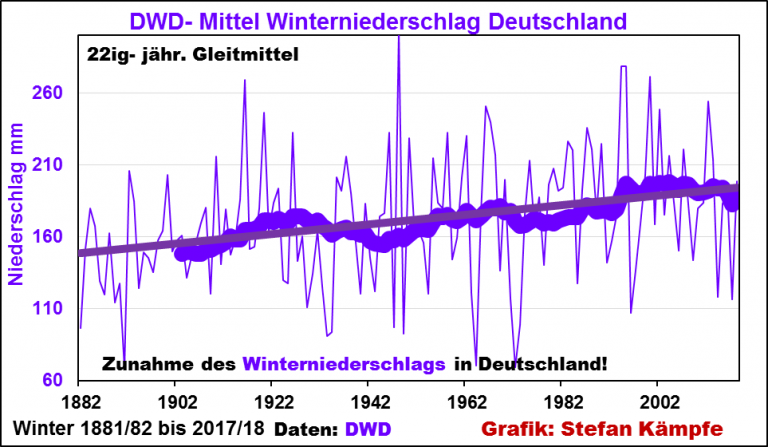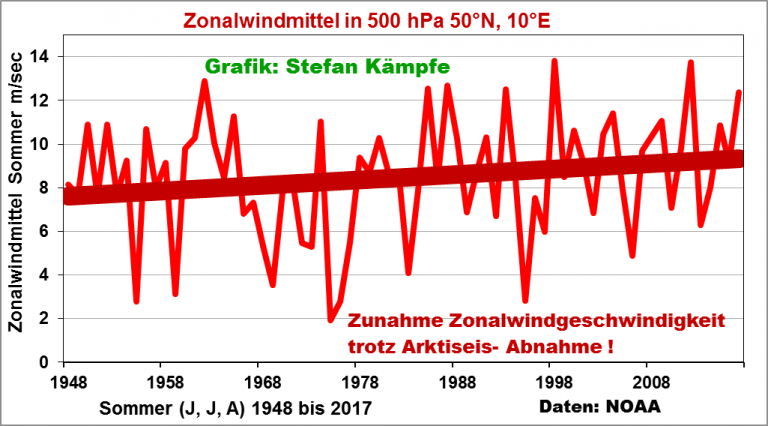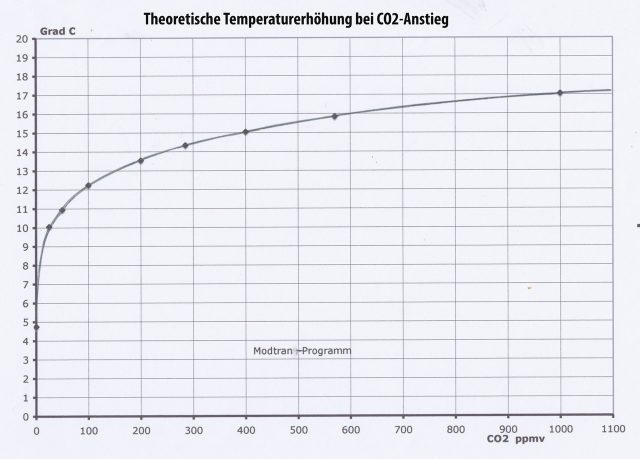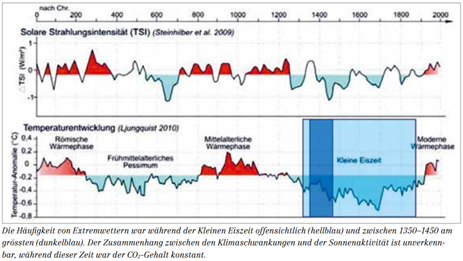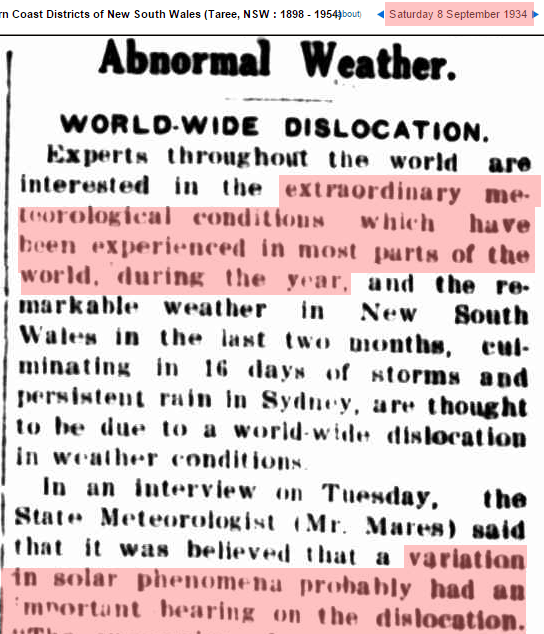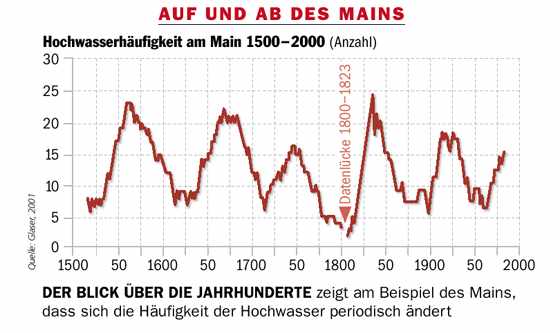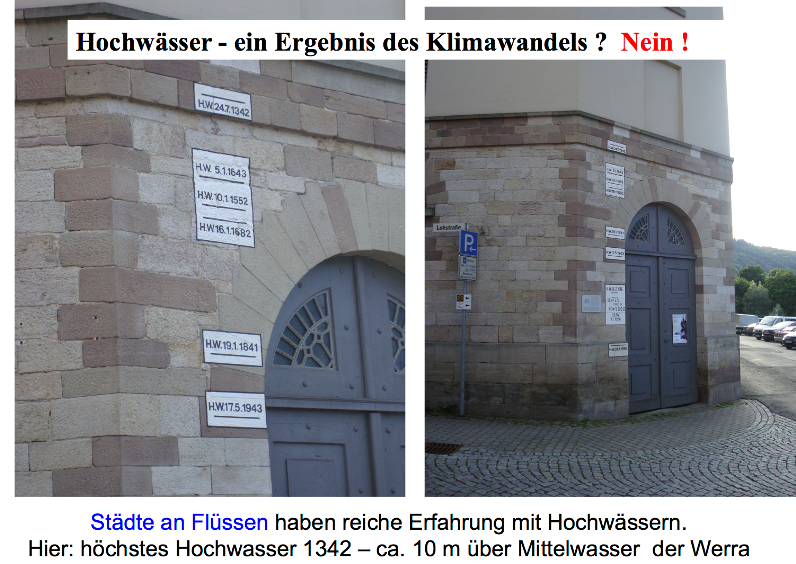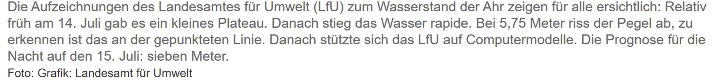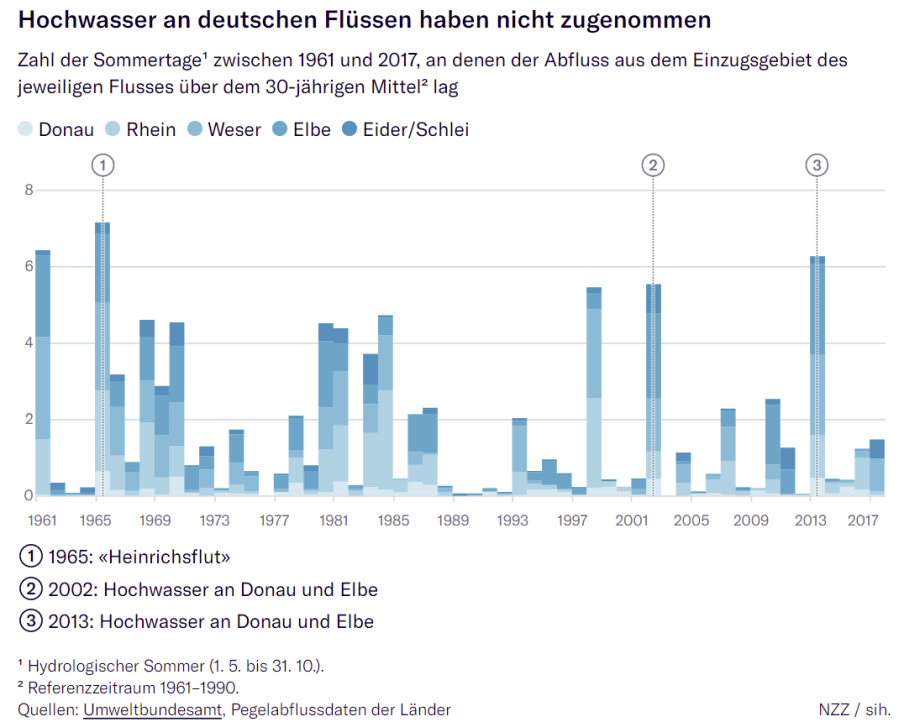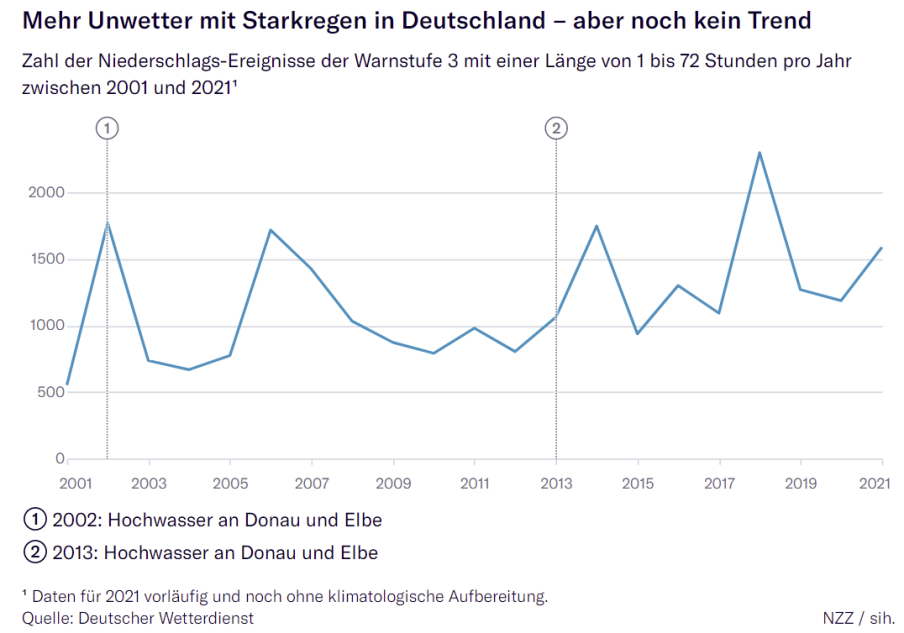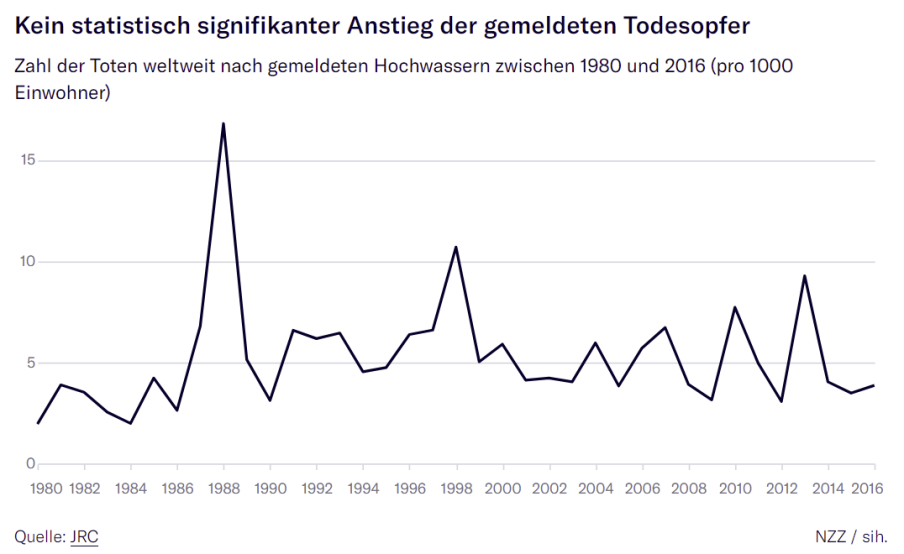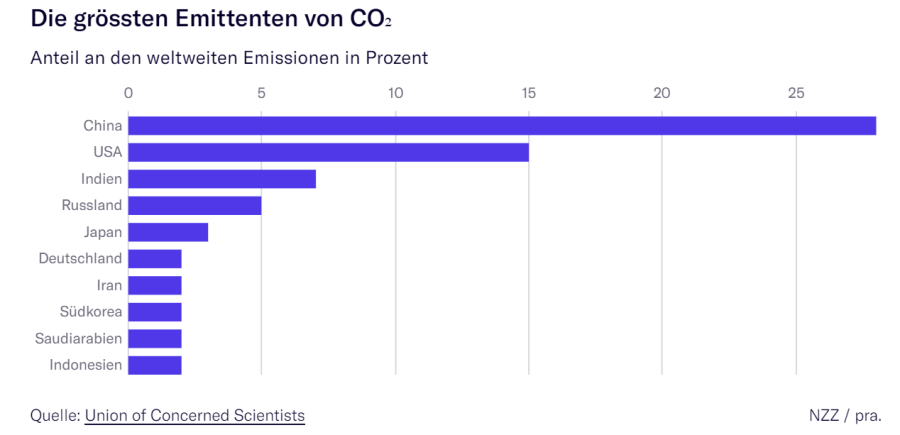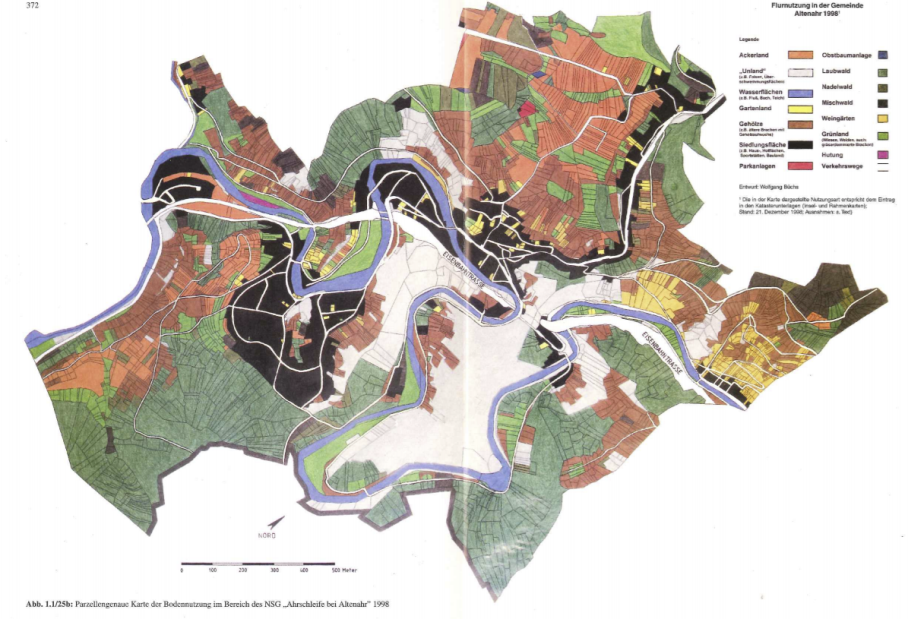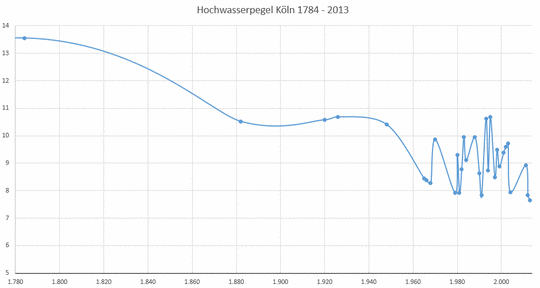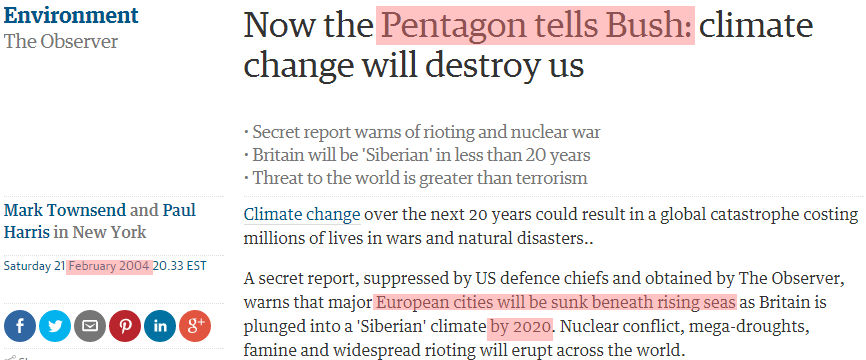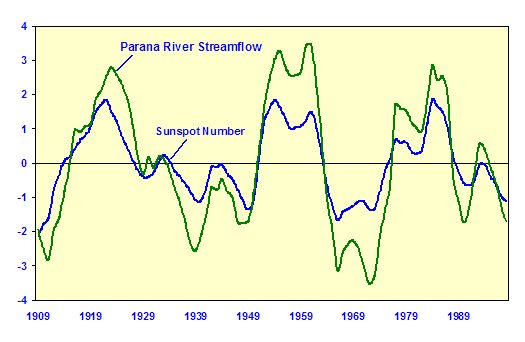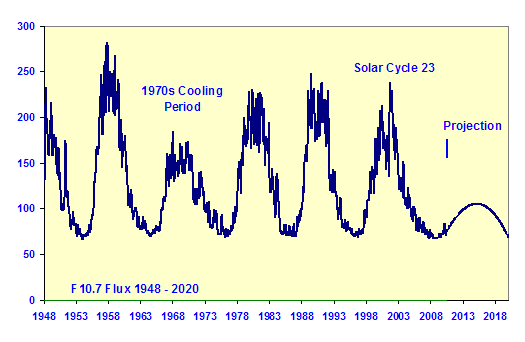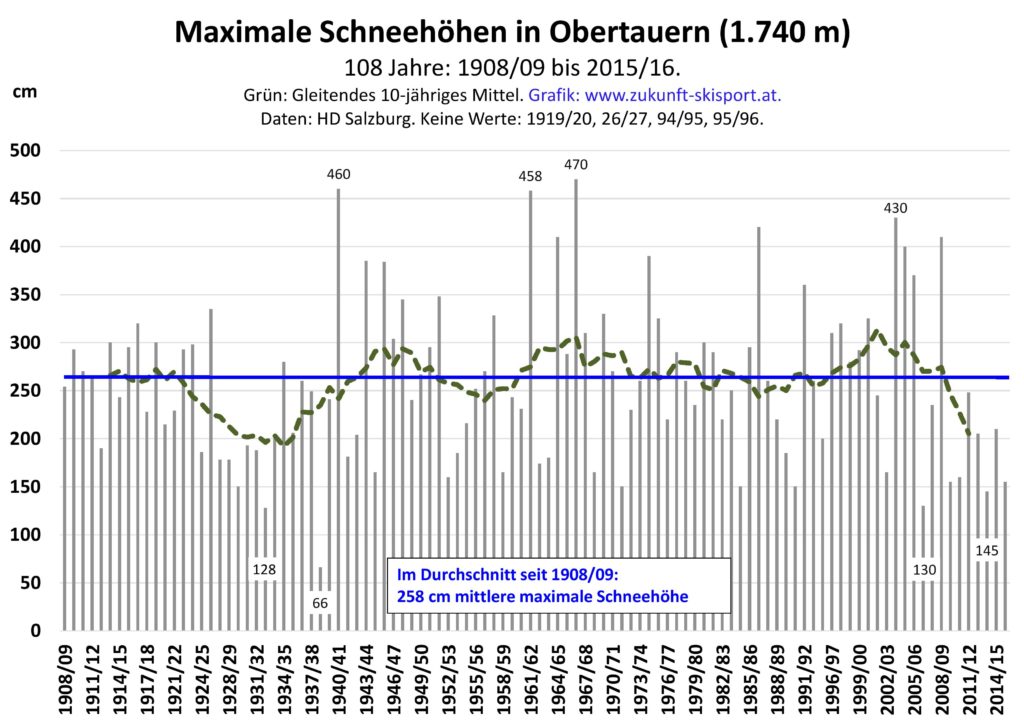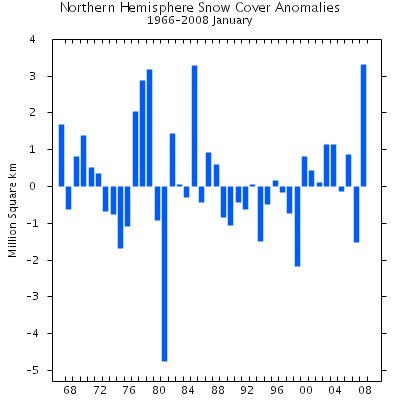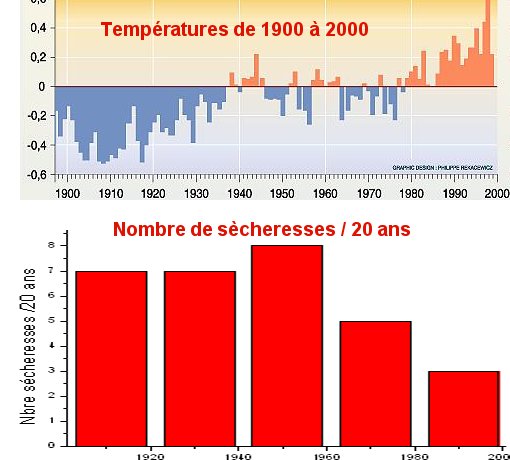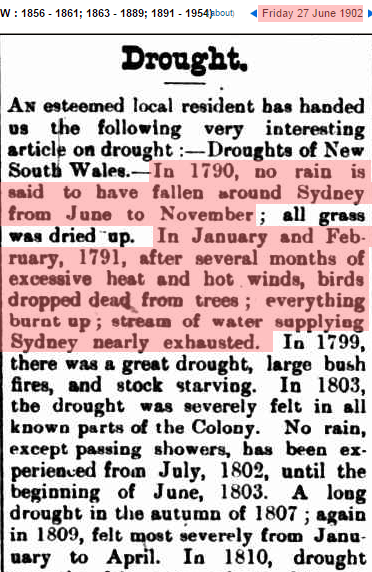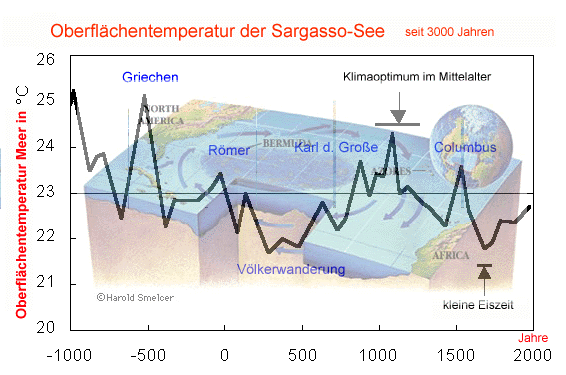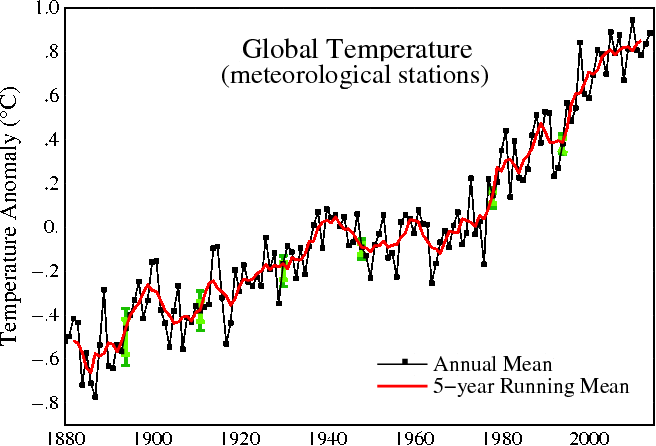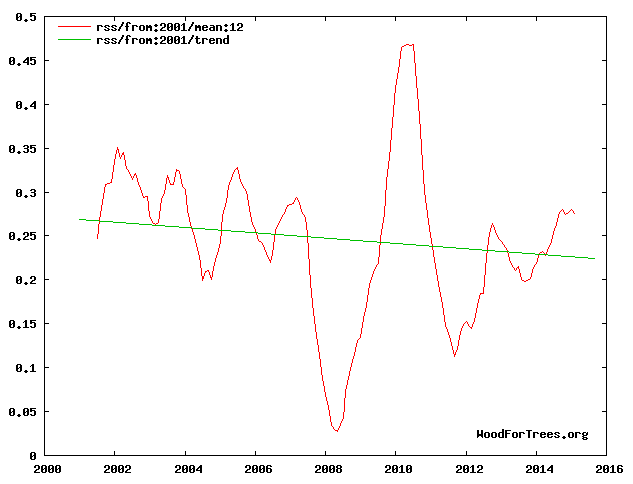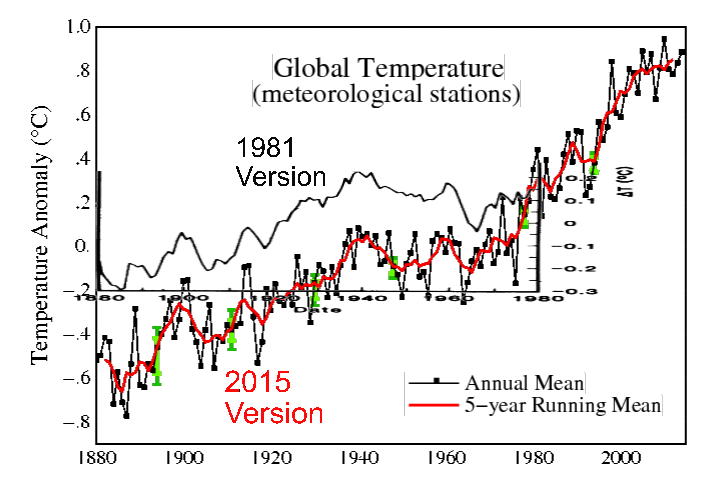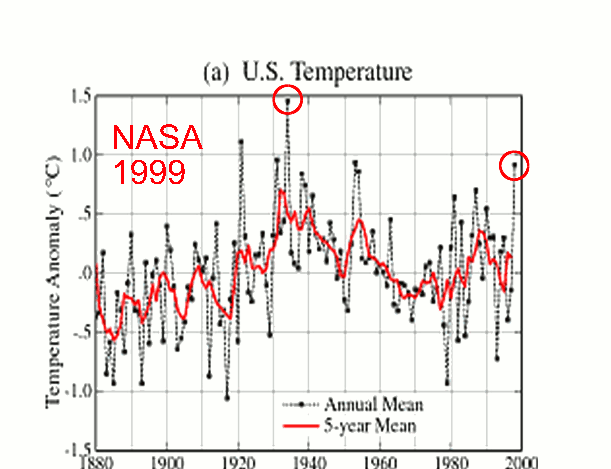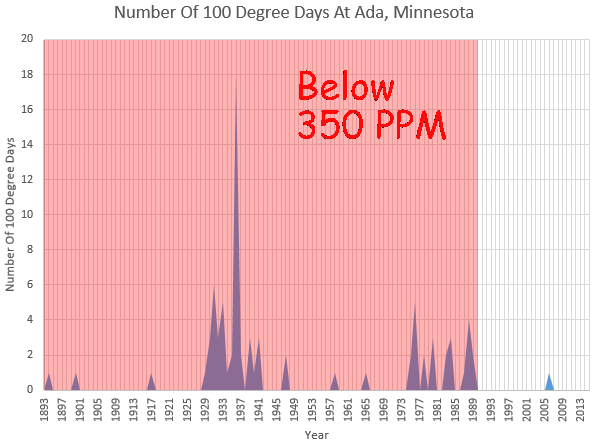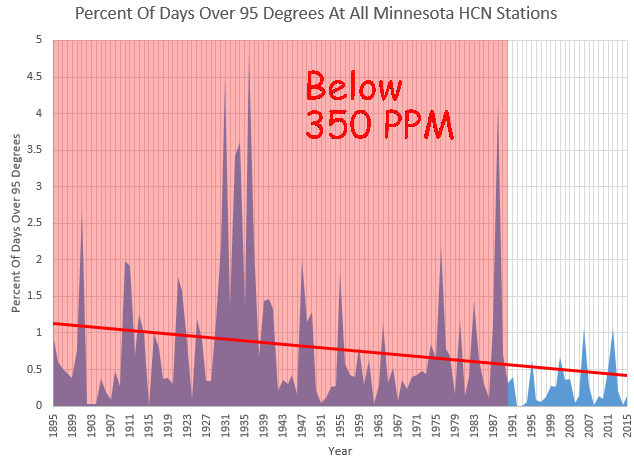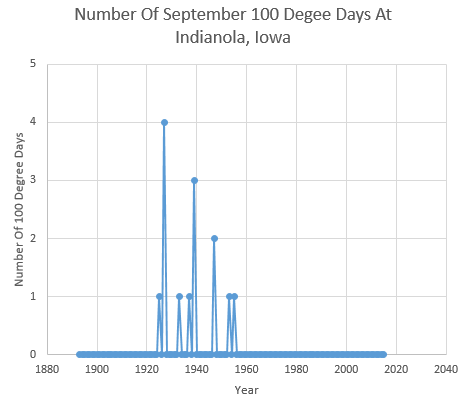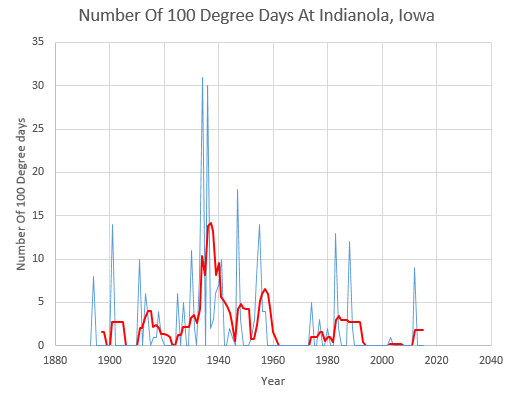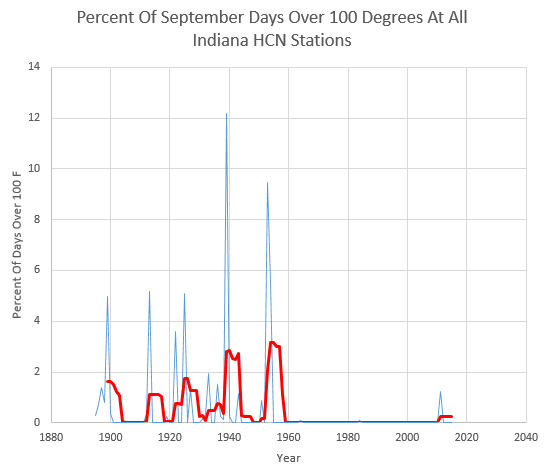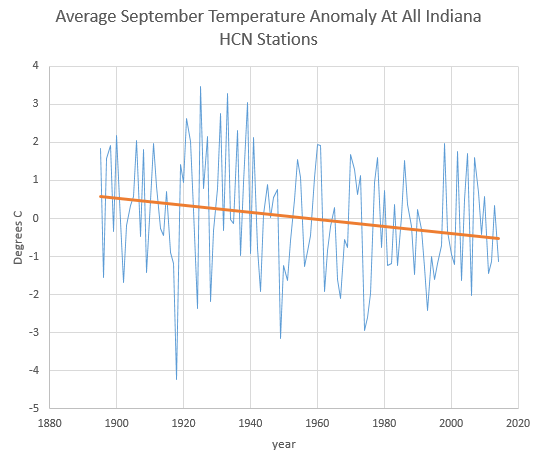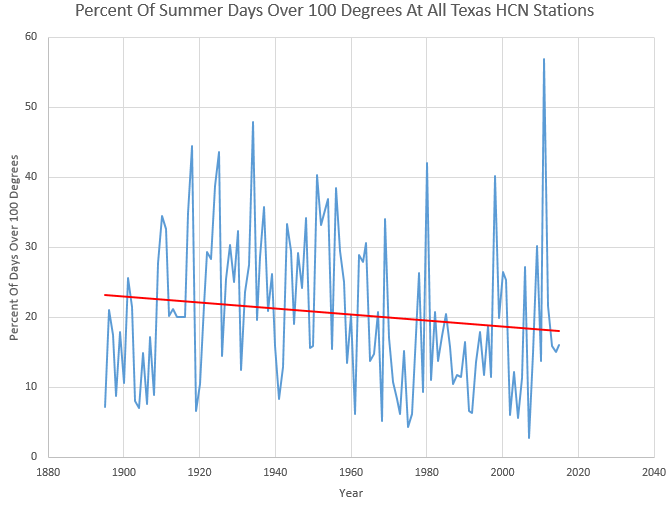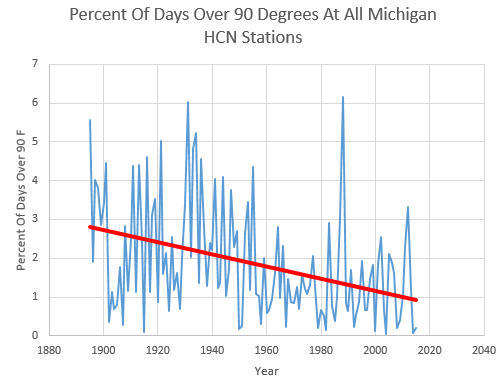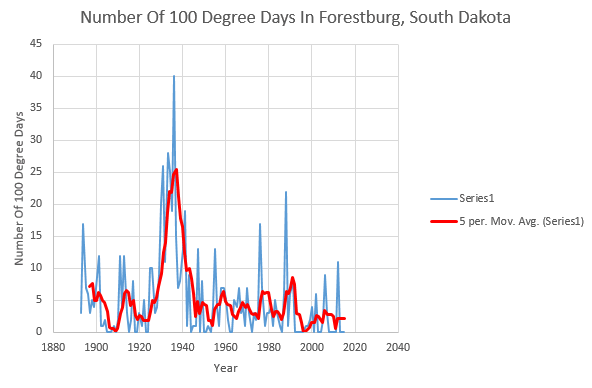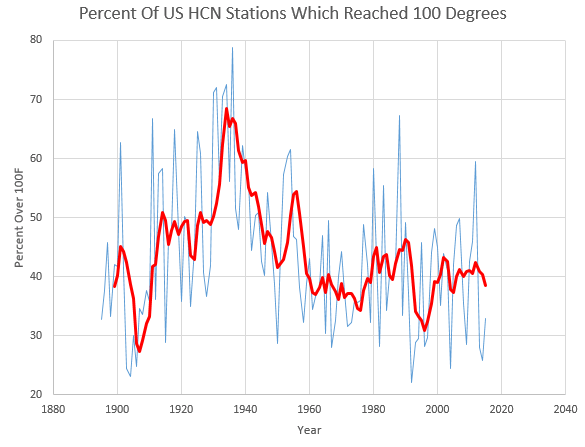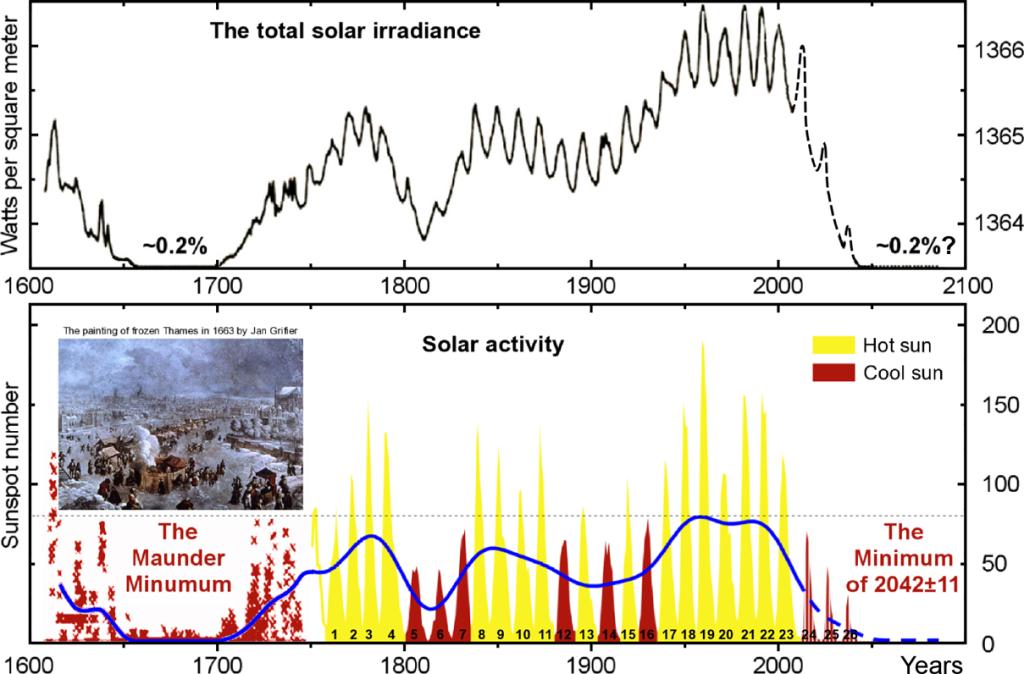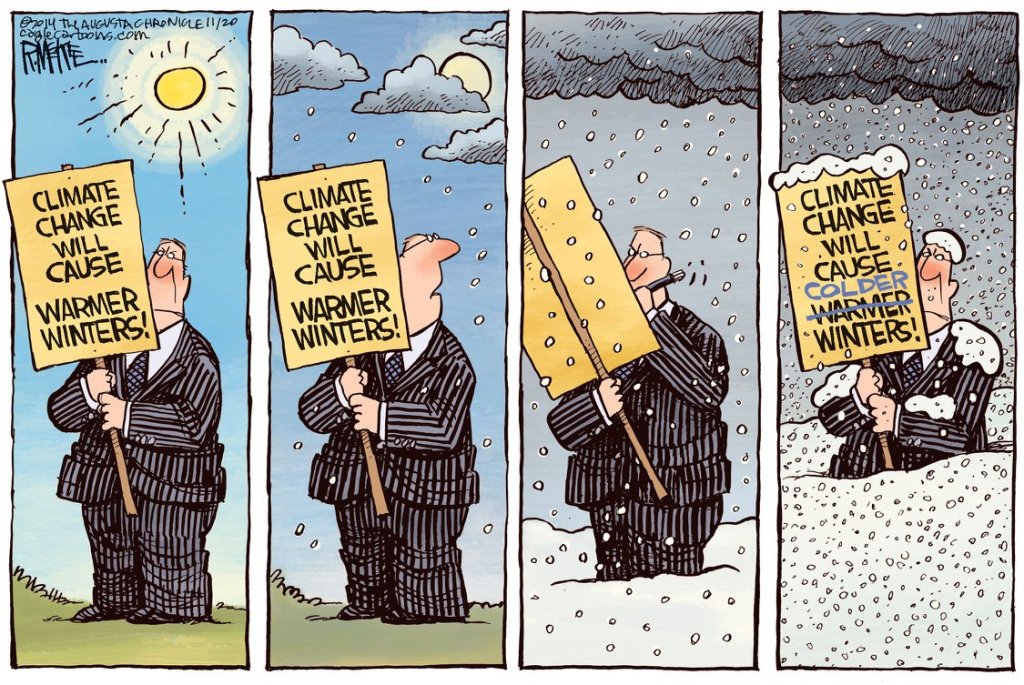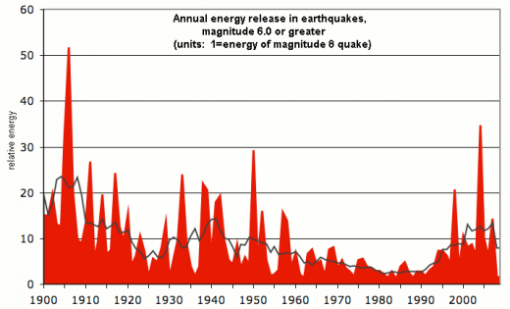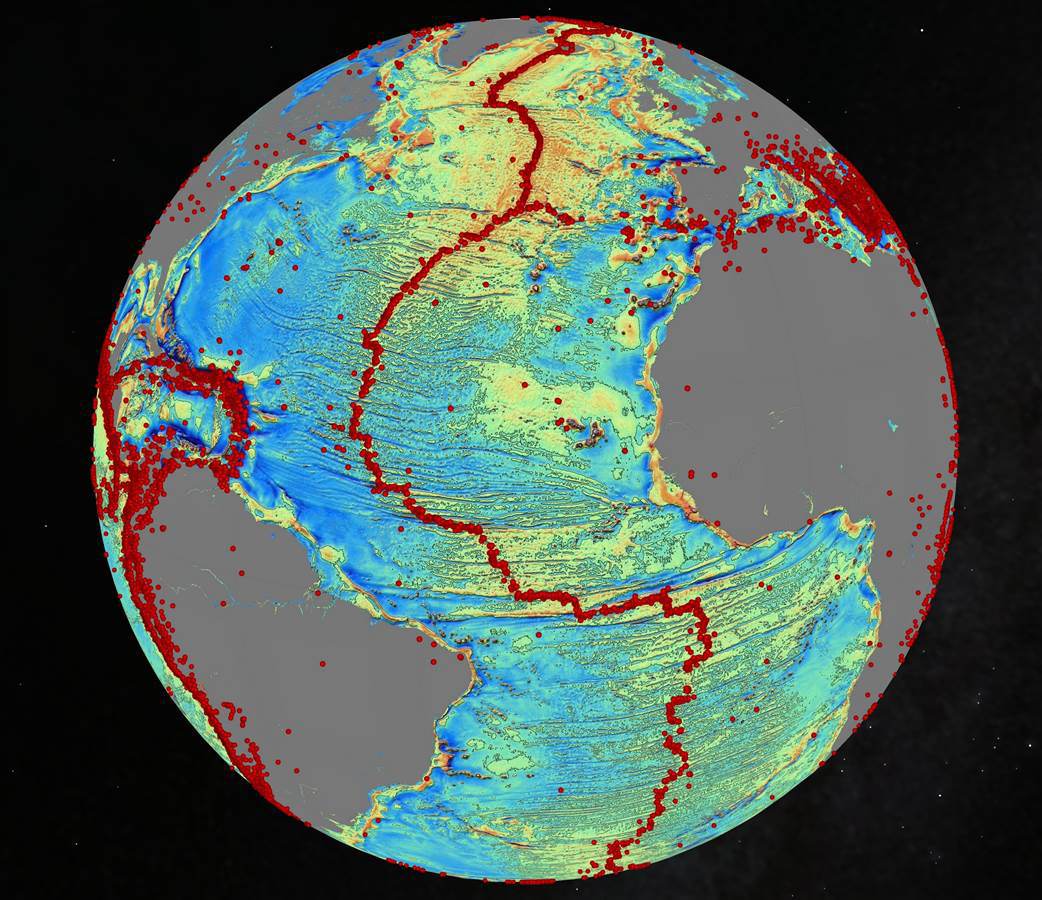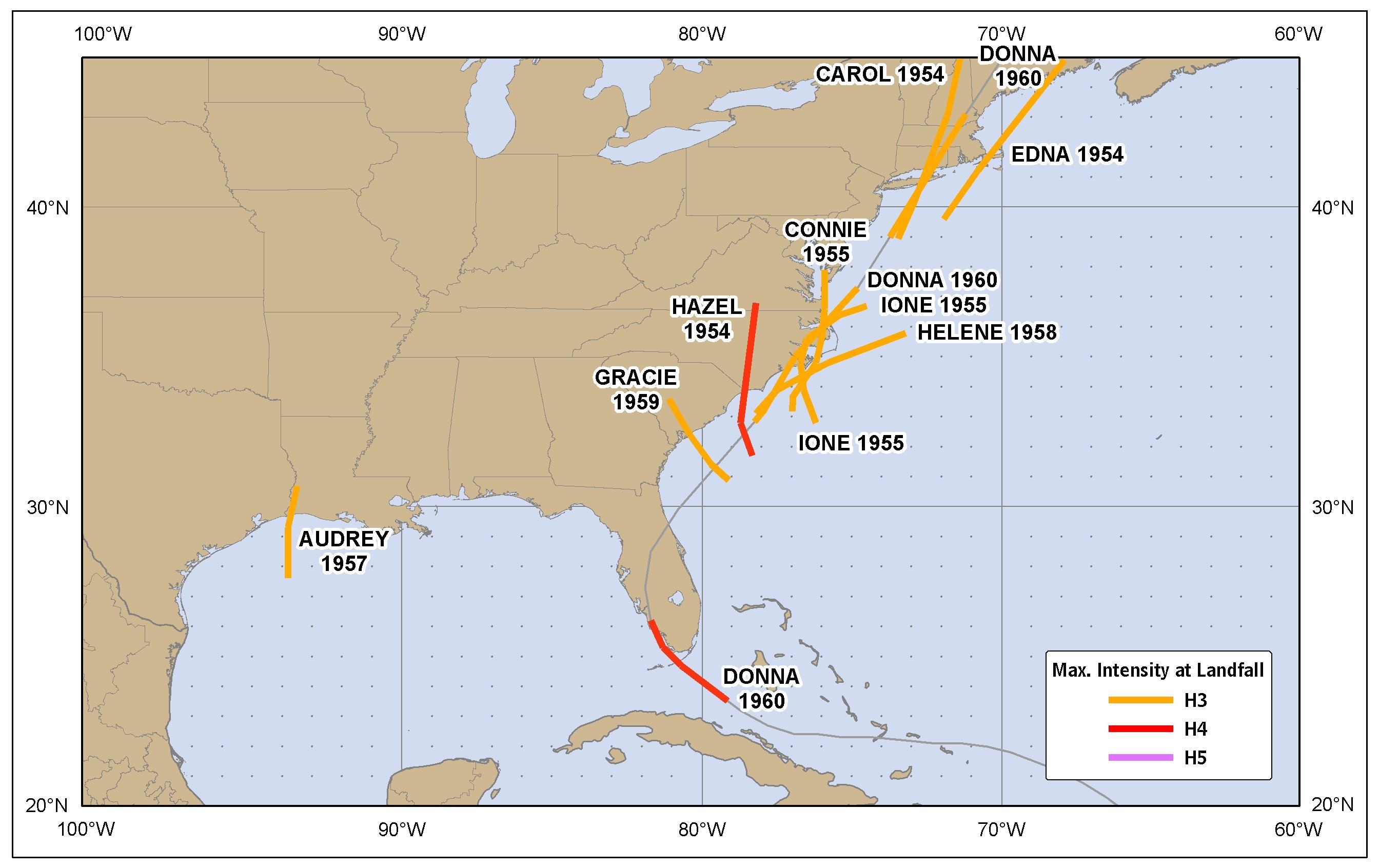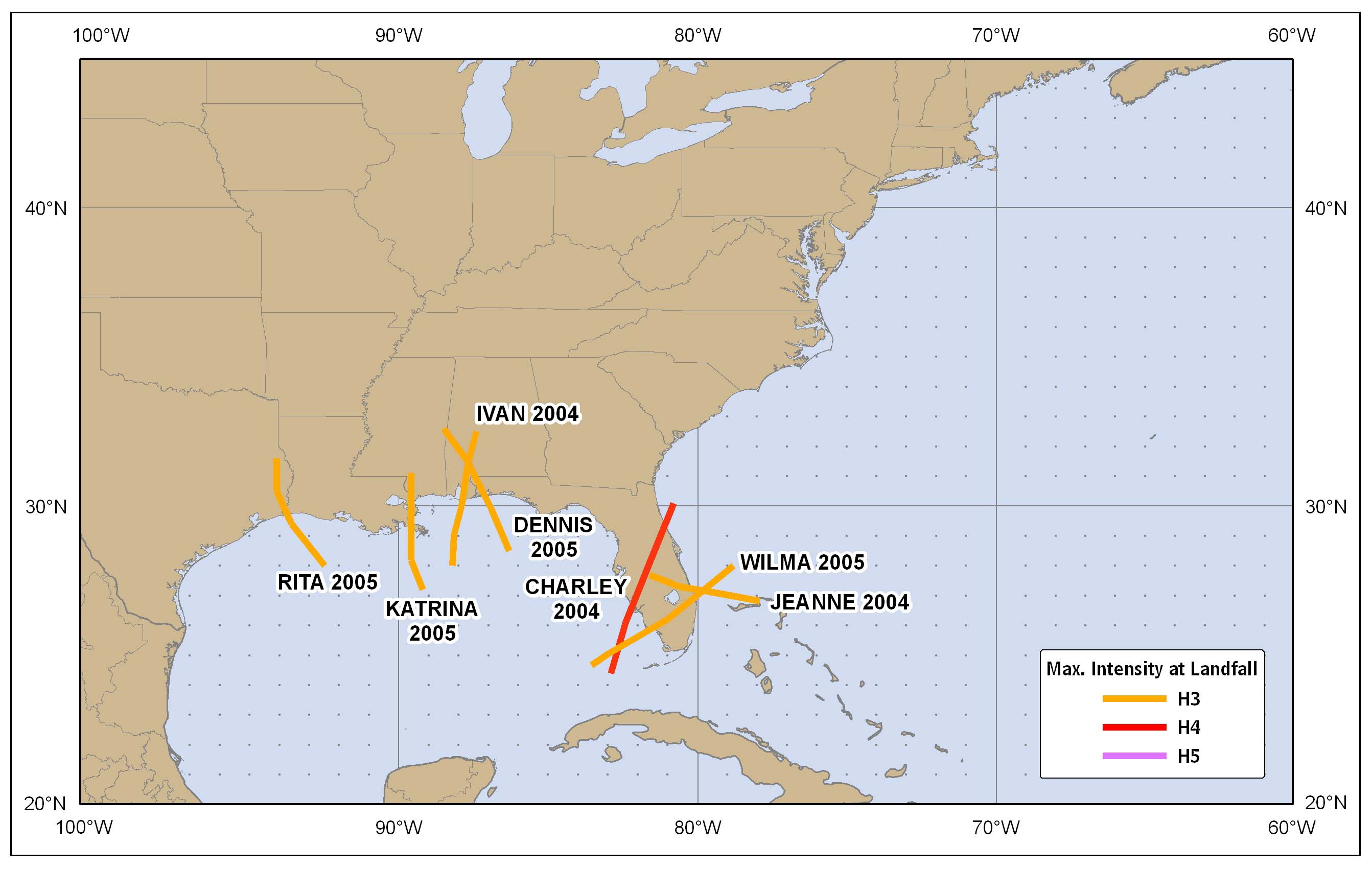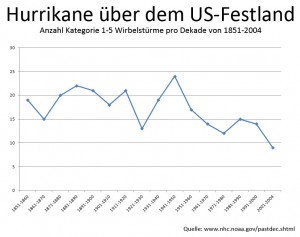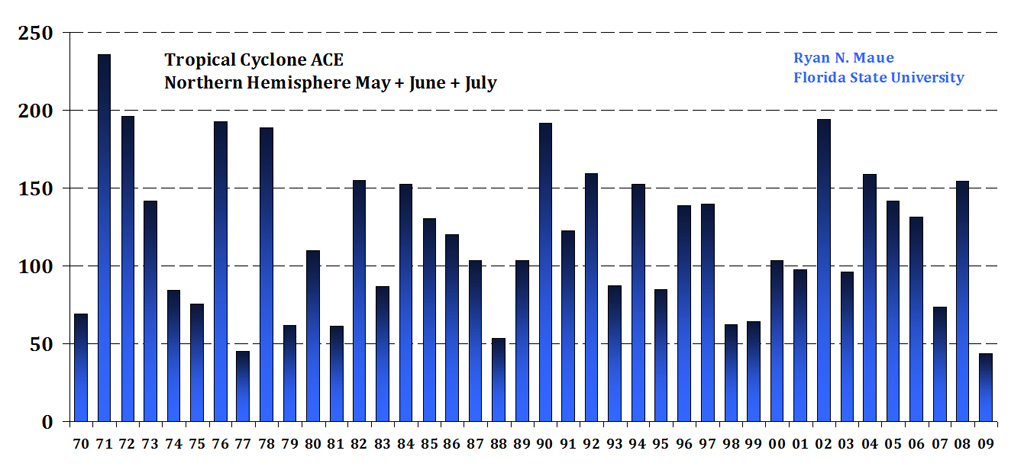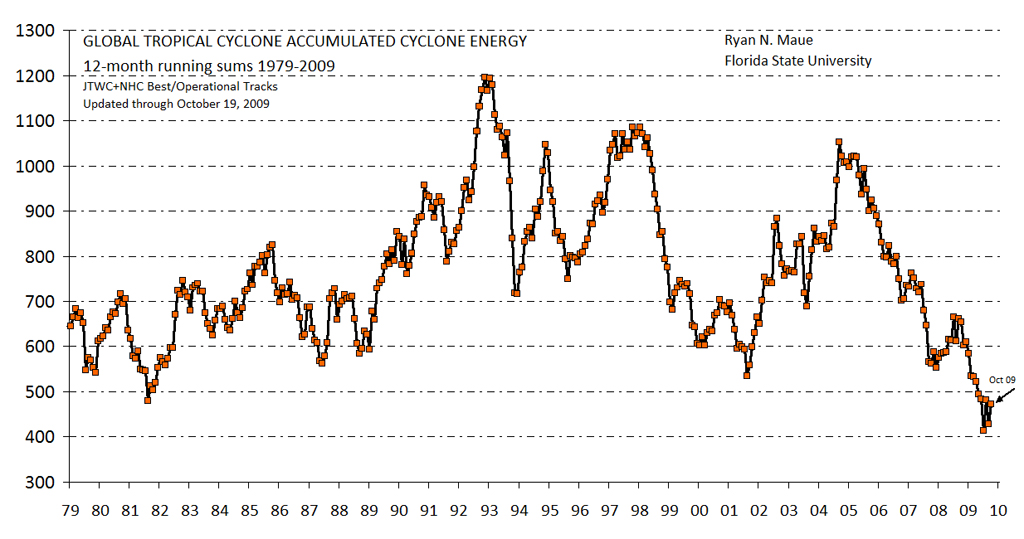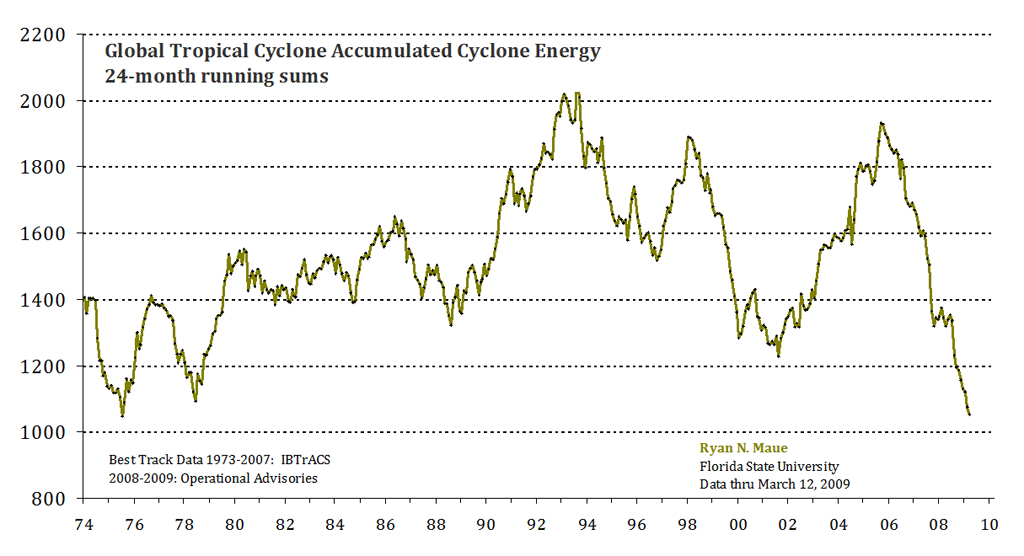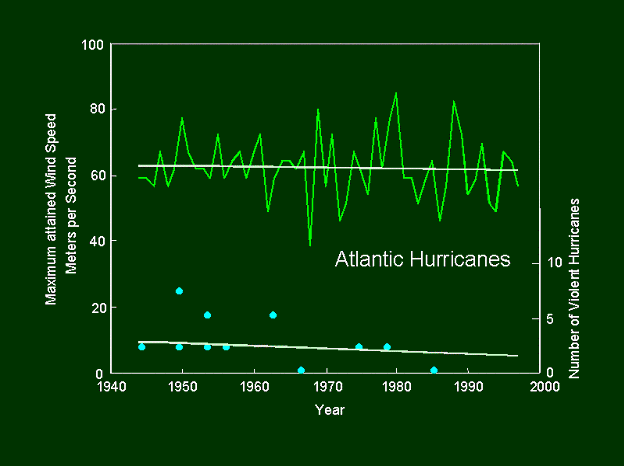3.3.6 Wetterphänomene
en
Weather phenomena
fr
Phénomènes météorologiques
Mit folgenden Links wird von anderen Webseiten auf diese Seite verwiesen:
| de | en | fr |
|---|---|---|
|
Auswirkungen des Klimawandels Wetterphänomene |
Impacts of Climate Change Weather Phenomena |
Impacts du changement climatique Phénomènes météorologiques |
- Verzeichnis │ Welt-Info │ Allgemein │ Text
| Wetterphänomene: Verzeichnis | |
| Wetterlagen, Temperaturen etc. | Welt‑Info: Wetter |
| Extremwetter | Welt‑Info: Extremwetter Welt‑Info: Dürren |
| Stürme | Welt-Info: Stürme |
⇧ de Verzeichnis en Contents fr Sommaire
|
|
⇧ Welt-Info
|
|
Wetter / Weather / Temps (météorologie) | |||
|
meteo.plus (tempsvrai.com) |
de
Sitemap
en
Sitemap Wetter Weltwetter Klima Sonne Geo |
|||
|
Arizona State University World Weather & Climate Extremes Archive |
World Meteorological Organization's World Weather & Climate Extremes Archive | |||
| Wikipedia |
|
|||
| Vademecum |
▶Wetterphänomene
▶Wetterlagen / / Wetterrückblick ▶Klima-Auswirkungen / Wetterphänomene: Temperaturen ▶Welt-Info |
|||
| Siehe auch: | ▶Extremwetter |
⇧ de Allgemein en General fr Générale
| de | en | fr |
|---|---|---|
|
Auswirkungen des Klimawandels Biosphäre der Erde Auswirkungen auf die Lebewelt |
Impacts of Climate Change Biosphere Impacts on the World of Life |
Conséquences du changement climatique Biosphère Impacts sur la vie terrestre |
| de | en | fr |
|---|---|---|
|
Auswirkungen des Klimawandels Bioplanet Pflanzenwachtstum, Sauerstoffproduktion, Ernährung, Grüne Erde |
Impacts of Climate Change Bioplanet Plant growth, Oxygen production, Nutrition, Green Earth |
Conséquences du changement climatique Bioplanet Croissance végétale, Nutrition, Production d'oxygène, Terre verte |
⇧ de Text en Text fr Texte
⇧
1 Wetterlagen / Wetterrückblick
en Weather Conditions / Weather Review
fr Conditions météorologiques / revue météo
Mit folgenden Links wird von anderen Webseiten auf diese Seite verwiesen:
▶Wetterlagen / / Wetterrückblick
| de | en | fr |
|---|---|---|
|
Wetterphänomene Wetterlagen |
Weather Phenomena Weather Condition |
Phénomènes météorologique Conditions météorologiques |
⇧ de Verzeichnis en Contents fr Sommaire
- 2019
- de Kachelmann über Dürre-Warnungen der Medien: "Über 90 Prozent aller Geschichten zu Wetter und Klima sind falsch oder erfunden"
- de
Der Januar kennt keine Klimaerwärmung:
Der Hochwintermonat wird seit über 30 Jahren wieder kälter - de
Kälte in den USA: Das muss wohl der Klimawandel sein, oder?
en The science behind the polar vortex - de Heftige Tornados sind in den USA während der letzten 70 Jahre seltener geworden
- de Globale Temperaturentwicklung seit 2015
- de
 Sechs Tage Eiszeit - Der Katastrophenwinter 1978/79
Sechs Tage Eiszeit - Der Katastrophenwinter 1978/79
Es ist ein Schneesturm der Geschichte schreibt. - 2018
- de Ein Sommermärchen Die Omega Lage
- de Sommerhitze 2018
- de
Der Klimaschwindel - Freispruch für
CO2-Propheten im Kampf um den
Klimathron
Dr. Wolfgang Thüne, Königswinter, 26.-27. Mai 2018
⇧ Welt-Info
|
|
Wetter / Weather / Temps (météorologie) | |||
|
meteo.plus (tempsvrai.com) |
de
Sitemap
en
Sitemap Wetter Weltwetter Klima Sonne Geo |
|||
|
Arizona State University World Weather & Climate Extremes Archive |
World Meteorological Organization's World Weather & Climate Extremes Archive | |||
| Wikipedia |
|
|||
| Vademecum |
▶Wetterphänomene
▶Wetterlagen / / Wetterrückblick ▶Klima-Auswirkungen / Wetterphänomene: Temperaturen ▶Welt-Info |
|||
| Siehe auch: | ▶Extremwetter |
⇧ de Allgemein en General fr Générale
Aus dem Vademecum
| de | en | fr |
|---|---|---|
|
Neue Kälteperiode Meldungen |
New Cold Period News |
Nouvelle periode froide Actualités |
Da irrten sich auch berühmte Professoren
| James (Jim) E. Hansen |
Dr., Former Head of NASA Goddard Institute for Space Studies
in New York City
He also serves as Al Gore's science advisor
▶James (Jim) E. Hansen: Who is who (Aktivisten der anthropogenen Globalen Erwärmung) ▶Ausschluss und Maulkorb für Kritiker (Das renommierte amerikanische Museum für nationale Geschichte (AMNH) in New York Opfer des Klimakriegs) |
| Reto Knutti |
Professor, Dr., Institut für Atmosphäre und Klima, ETH Zürich
Er erforscht den Einfluss des Menschen auf das Klimasystem.
Er ist Hauptautor des Berichts des Uno-Klimarats IPCC, der
2013 erschien.
▶Reto Knutti: Who is who (Anthropogene Globale Erwärmung) ▶Reto Knutti: Wikipedia (Profiteure) |
Kontroverse
| de | en | fr |
|---|---|---|
|
Klima: Wandel Kontroverse über die Ursachen des Klimawandels |
Climate: Change Controversy over the causes of the climate change |
Climat: Changement Controverse sur les causes du changement climatique |
| Anthropogenic Global Warming versus Natürliche Ursachen des Klimawandels | ||
Weitere Storiess
| de | en | fr |
|---|---|---|
|
Diskussionen Klimastreit |
Discussions Climate discussions |
Discussions Discussions sur le réchauffement climatique |
| de | en | fr |
|---|---|---|
|
Klima: Politik Wahn |
Climate: Politics Délire |
Climat: Politique Cycle climatiques |
⇧ de Text en Text fr Texte
⇧ 2019
↑ Kachelmann über Dürre-Warnungen der Medien: "Über 90 Prozent aller Geschichten zu Wetter und Klima sind falsch oder erfunden"
-
Die kalte Sonne (Fritz Vahrenholt & Sebastian Lüning)
2019-05-13 de Kachelmann über Dürre-Warnungen der Medien: "Über 90 Prozent aller Geschichten zu Wetter und Klima sind falsch oder erfunden"Am 26. April 2019 erschien auf Meedia.de ein ausgezeichnetes Interview mit Jörg Kachelmann:
Kachelmann über Dürre-Warnungen der Medien:
"Über 90 Prozent aller Geschichten zu Wetter und Klima sind falsch oder erfunden"
MEEDIA: Wenn man Medien wie Bild, FAZ und "Tagesschau" diese Woche verfolgt hat, steht uns ein weiterer Dürre-Sommer wie im vergangenen Jahr bevor ... müssen wir jetzt alle Angst haben?
KACHELMANN: Nein, alle diese Meldungen sind frei erfunden.
MEEDIA: Die genannten Medien berufen sich auf den Deutschen Wetterdienst - ist der denn nicht seriös?
KACHELMANN: Das ist eine Lüge. Der Deutsche Wetterdienst hat nie behauptet, dass es einen Dürresommer gäbe.
Er schrieb nur, dass es einen geben könnte, wenn es nicht regnet, was nicht weiter überrascht.
Daraus hat dpa dann einfach mal zugedichtet, dass der DWD vor einem Dürresommer warne.
Das wurde dann kurz darauf korrigiert, aber die unbändige Lust der deutschen Medien an klickbarem Horror lässt sich durch eine solche Korrektur nicht mehr aufhalten.
-
MEEDIA
2019-04-26 de Kachelmann über Dürre-Warnungen der Medien: Kachelmann über Dürre-Warnungen der Medien: "Über 90 Prozent aller Geschichten zu Wetter und Klima sind falsch oder erfunden"Wer am gestrigen Mittwoch die Hauptausgabe der "Tagesschau" sah oder heute die Bild-Zeitung sieht, könnte wettermäßig in Panik geraten.
"Wetterdienst warnt vor Dürresommer", meldete die ARD-Nachrichtensendung.
Die Bild übergeigte komplett mit der Schlagzeile:
"Meteorologen sicher! Sahara-Sommer mit Mega-Dürre droht.U.a. auch Greenpeace verbreitete das apokalyptische Szenario.
Alles frei erfunden, sagt der Wetterexperte Jörg Kachelmann im MEEDIA-Interview.
↑ Der Januar kennt keine Klimaerwärmung: Der Hochwintermonat wird seit über 30 Jahren wieder kälter
-
EIKE Europäisches Institut für Klima und Energie
Stefan Kämpfe, Josef Kowatsch
2019-02-06 de Der Januar kennt keine Klimaerwärmung: Der Hochwintermonat wird seit über 30 Jahren wieder kälterDer Januar 2019 überraschte uns bisweilen mit klirrender Kälte und einem Wintereinbruch mitten im Winter, Realitäten, die es angesichts des Glaubens-modells "Klimaerwärmungskatastrophe" eigentlich nicht mehr geben sollte.
↑
Kälte in den USA: Das muss wohl der Klimawandel sein, oder?
en
The science behind the polar vortex
-
Die kalte Sonne (Fritz Vahrenholt & Sebastian Lüning)
2019-02-03 de Kälte in den USA: Das muss wohl der Klimawandel sein, oder?"Klimakommunikatoren" haben immer die gleiche "passende" Deutung für jedes Wetterereignis: Das ist der Klimawandel!
Ein warmer, vor allem trockener Sommer hierzulande: Klimawandel!
Wir berichteten unlängst darüber.
Nun also ein Kaltluftausbruch aus der Arktis bis weit südlich hinunter in die USA, auch das ist Klimawandel.
Hier zitiert ein TV- Sender unter vielen Medien aus einer Agenturmeldung von DPA.
Professor Stefan Rahmstorf (SR) erklärt.
Wer könnte es besser?Wir wollen prüfen, was dran ist.
Zunächst schauen wir bei der NOAA, die es vielleicht am besten wissen sollte.
Der Polarwirbel schwächelt im Winter oft, der Begriff "Vortex" dafür wird in den USA schon seit 1853 gebraucht.
SR behauptet nun: Das passiert immer öfter:
"... dies sei nach einer Datenauswertung des PIK aber in den vergangenen Jahrzehnten um ein Mehrfaches häufiger geworden."
...
Wir wollen das prüfen und stoßen auf eine Statistik von Roy Spencer und John Christy von der Universität Huntsville in Alabama:
Keine Zunahme, auch keine signifikante Abnahme, der lineare Trend ist eher Ausdruck einer Zufälligkeit.
Wir finden keine Bestätigung für die "Datenauswertung des PIK".
Jörg Kachelmann ist kräftig genervt von dem Blödsinn.
Wir auch.
Und wir fragen uns: Warum wird so viel unbewiesener und umstrittener Stoff zur Erklärung auch jedes aktuellen Ereignisses in die Welt gesetzt?
Sind echte Argumente (es wird global wärmer mit einer Rate von ca. 0,125 °C/Dekade seit 1950 (nach der Reihe von Cowtan&Way) zu schwach?
Ist der Klimawandel etwas, wofür es eines hohen Werbe-Etats bedarf, um ihn zu verkaufen?
Dann allerdings entpuppen sich diese PR-Aktionen als Rohrkrepierer:
Jede zu oft laufende Werbung nervt den Konsumenten nur noch.
Der Hintergrund ist nicht Wissenschaft, wie der Konsument glauben soll. Statdessen spielen wohl politische Ambitionen die Hauptrolle.
Wahrhaft dünnes Eis!
-
NOAA
2018-02-03 de The science behind the polar vortexThe polar vortex is a large area of low pressure and cold air surrounding the Earth's North and South poles.
The term vortex refers to the counter-clockwise flow of air that helps keep the colder air close to the poles (left globe).
Often during winter in the Northern Hemisphere, the polar vortex will become less stable and expand, sending cold Arctic air southward over the United States with the jet stream (right globe).
The polar vortex is nothing new - in fact, it's thought that the term first appeared in an 1853 issue of E. Littell's Living Age.
↑ Heftige Tornados sind in den USA während der letzten 70 Jahre seltener geworden
-
Die kalte Sonne (Fritz Vahrenholt & Sebastian Lüning)
2019-01-23 de Heftige Tornados sind in den USA während der letzten 70 Jahre seltener geworden
 Entwicklung starker Tornados in den USA seit 1950
Entwicklung starker Tornados in den USA seit 1950

Die Weltwirtschaftsleistung steigt und steigt.
Das kann man schön am Wachstum der globalen Summe des Bruttoinlandsprodukts sehen.
Insofern wundert es auch nicht, dass Schäden durch Naturkatastrophen ebenfalls stetig ansteigen.
Denn wenn es mehr Werte gibt, die zerstört werden können, dann steigt die Schadenssumme selbst dann an, wenn die Anzahl und Stärke der Naturkatastrophen konstant bliebe.
Dieser Aspekt wird gerne verschwiegen, wenn MunichRe und andere Unternehmen statistische Schadenszahlen verbreiten.
Eine neue Studie von Roger Pielke hat genau diesen Effekt dokumentieren können.
In den letzten 25 Jahren sind die Schäden stark angestiegen, jedoch über das BIP normiert, ist ein Rückgang zu verzeichnen
↑ Globale Temperaturentwicklung seit 2015
-
Die kalte Sonne (Fritz Vahrenholt & Sebastian Lüning)
2019-01-22 de Globale Temperaturentwicklung seit 2015
 Globale Temperaturentwicklung seit 2015
Globale Temperaturentwicklung seit 2015
(rote Kurve, UAH-Satellitendaten),
mit linearem Trend (grüne Linie).
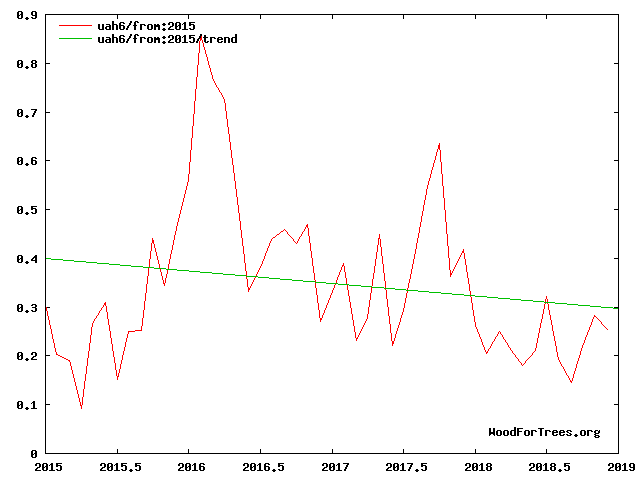
↑
Sechs Tage Eiszeit - Der Katastrophenwinter 1978/79
Es ist ein Schneesturm der Geschichte schreibt.
-
2019-01-02 de
 Sechs Tage Eiszeit - Der Katastrophenwinter 1978/79
Sechs Tage Eiszeit - Der Katastrophenwinter 1978/79
» Es ist ein Winter-Sturm, der aus dem Nichts zu kommen scheint.
Zum Jahreswechsel 1978/79.
Eine Schneehölle, die acht Meter Schneewehen auftürmt, die Wellenkämme gefrieren lässt, die Menschen und Autos verschluckt und ungeahnte Kräfte freisetzt.
In Mitteleuropa gefriert das normale Leben bei zwanzig Grad unter Null.
Sechs Tage in Eis und Schnee.
Es ist ein Schneesturm der Geschichte schreibt.
Die neue Dokumentation des MDR erzählt die Ereignisse der sechs Katastrophentage zum Jahreswechsel 1978/79 in der DDR und in der Bundesrepublik.
Aus neu erschlossenem Archivmaterial, unbekannten Amateurfilmen, historischen Fotos und beeindruckenden Zeitzeugen entsteht ein detailliertes, facettenreiches und chronologisch exaktes Bild der Ereignisse von damals.
Aufwendige Animationen verdeutlichen die einmalige Wetterkonstellation und beschreiben eindrucksvoll, wie zwei extrem unterschiedliche Luftmassen in der Mitte Europas aufeinander prallen und zum Chaos führen.
So ist dieser dramatische Wintereinbruch noch nicht erzählt worden. «
Der Film ist einer von drei Filmen aus der MDR-Zeitreise-Reihe "Der Katastrophenwinter 1978/79".
⇧ 2018
↑
Ein Sommermärchen
Die Omega Lage
-
Die kalte Sonne (Fritz Vahrenholt & Sebastian Lüning)
2018-12-02 de Ein SommermärchenDas war ein Sommer 2018 in Mitteleuropa!
Sehr warm und vor allem sehr trocken war er.So etwas kommt vor, oft wenn sich eine "Blocking"-Wetterlage einstellt. Dann bildet sich im Sommer ein stabiles Hoch über Mitteleuropa und die von Westen anrückenden Tiefdruckgebiete werden im hohen Bogen nach Norden um das Hoch herum geführt.
Die charakteristische Form der Druckverteilung über Europa bescherte der Wetterlage auch den Beinamen "Omega Lage".
↑ Sommerhitze 2018
-
Basler Zeitung / Martin A. Senn
2018-08-16 de Wenn das Denken baden gehtIm Zuge der Klima-Hysterie ist zu befürchten, dass noch vor den Gletschern das menschliche Denken den Hitzetod stirbt.
Bei 23 Grad Celsius, habe ich gelesen, sei die Denkfähigkeit der Leute am besten, dann nehme sie ziemlich rasch ab, und ab 27 Grad sacke sie regelrecht zusammen.
Nun ist es mit Studien zwar so eine Sache, aber diese liess sich ja in den letzten Wochen quasi in Echtzeit verifizieren.
Und was der Hitzesommer an intellektuellen Sonderleistungen hervorgebracht hat, schien den Befund der Studie glasklar zu belegen, ja es nährte gar die Befürchtung, dass noch vor den Gletschern das menschliche Denken den Hitzetod sterben könnte.
de Panik-Küche en Panic laboratory fr Marmite alarmiste
-
ntv
2018-07-30 de "Bestätigt" den Klimawandel: Für Latif ist Sommerhitze "außergewöhnlich"Mehr als 30 Grad und das seit Tagen:
Deutschland ächzt unter einer Hitzeperiode.
Für den Wissenschaftler und Klimaforscher Mojib Latif ist sie erst der Anfang: "Wir erleben immer mehr Hitzetage mit 30 Grad oder mehr."Die derzeitige Hitzewelle ist nach Auffassung des Wissenschaftlers Mojib Latif "außergewöhnlich, weil sie schon so lange anhält".
Es bestätige sich "mehr und mehr, was wir Klimaforscher lange vorausgesagt haben",
und zwar mit Blick auf den Klimawandel in Deutschland,
sagte der Meteorologe und Professor am Kieler Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung der "Passauer Neuen Presse"."Seit Beginn der Messungen hat sich die durchschnittliche Temperatur um 1,4 Grad erhöht.
Das ist mehr als im globalen Durchschnitt", erklärte Latif.
"Die Sommerhitze nimmt zu.
Wir erleben immer mehr Hitzetage mit 30 Grad oder mehr. Zugleich nimmt die Zahl der Tropennächte zu, in denen die Temperatur nicht mehr unter 20 Grad fällt."
Zugleich nehme die Zahl der Frosttage in Deutschland immer weiter ab.
"Das ist ein offensichtlicher Trend."
Kurzfristig lasse sich diese Entwicklung nicht aufhalten, sagte der Kieler Klimaforscher und betonte: "Die internationale Politik tut zu wenig, steuert nicht konsequent um. Der weltweite CO2-Ausstoß steigt immer weiter an, die Erderwärmung nimmt immer weiter zu."
Auch die Bundesregierung tue "zu wenig und wird ihrer Verantwortung nicht gerecht".
So habe beispielsweise die Automobilindustrie "die Selbstverpflichtungen zum Klimaschutz und zum Schadstoffausstoß nie eingehalten".
Latif bedauerte: "Diese kurzfristigen wirtschaftlichen Interessen dominieren die langfristigen Interessen der Umwelt und des Landes.
Je länger wir zögern und nichts tun, desto gefährlicher wird es."
▶Prognosen von Prof. Mojib Latif
▶
![]() Rückkehr der Sintflut: Schellnhuber, Latif, Rahmstorff
Rückkehr der Sintflut: Schellnhuber, Latif, Rahmstorff
| Mojib Latif |
Dr. rer. nat.,
Professor für Meteorologie am Leibniz-Institut für
Meereswissenschaften (IFM-GEOMAR) an der Universität Kiel.
▶Mojib Latif: Who is who (Aktivisten der anthropogenen Erwärmung) |
de Panik-Küche en Panic laboratory fr Marmite alarmiste
-
Die kalte Sonne (Fritz Vahrenholt & Sebastian Lüning)
2018-08-15 de Dürregeschichte Mitteleuropas: Klimaforscher Christian Pfister mit unerklärlichen GedächtnislückenAm 2. August 2018 brachte SRF ein längeres Radiointerview mit dem bekannten Berner Klima-Historiker Christian Pfister zur diesjährigen langen Dürreperiode in Mitteleuropa.
Pfister bezeichnet das Dürrejahr 1540 als Ausreißer, während die Dürre 2018 die zukünftige Norm darstellen könnte.
Eine steile These.
Zumal sie dem widerspricht, was der heute emeritierte Klimahistoriker Pfister noch im Jahr 2000 selber feststellte (pdf hier).
Dürresommer im Schweizer Mittelland seit 1525
Eine seltsame Gedächtnislücke.
Im Fazit der Arbeit lesen wir doch tatsächlich, dass beim Vergleich des Zeitraums von 1525 bis 2000 die häufigsten Dürren in Mitteleuropa während des Maunder-Minimum im 17. Jahrhundert auftraten und am wenigsten im 20. Jahrhundert:
...
Schussfolgerung
Man reibt sich verwundert die Augen.
Was passiert hier genau?
Will oder kann sich Pfister nicht mehr erinnern?
War alles falsch, was er früher gemacht hat?
Steht er lieber auf der Seite der vermeintlich Guten und verbiegt zu diesem Zweck sogar die Realitäten?
| SRF |
Schweizer Radio und Fernsehen
▶SRF: Who is who (Medien der Globalen Erwärmung) |
| de | en | fr |
|---|---|---|
|
Wetterphänomene Dürreperioden |
Weather phenomena Periods of Droughts |
Phénomènes météorologiques Periodes de sécheresses |
| de | en | fr |
|---|---|---|
|
Wetterphänomene Hitzewellen |
Weather phenomena Heat Waves |
Phénomènes météorologiques Canicules |
de Panik-Küche en Panic laboratory fr Marmite alarmiste
-
Tages-Anzeiger / Linus Schöpfer Redaktor Kultur
2018-08-11 de Wissenschaft vs. SVP«Von der Realität überholt», «schlicht falsch»: Klimaforscher kritisieren das Umweltprogramm der Volkspartei scharf.
Knutti bemängelt faktische Fehler.
Etwa die Aussage der SVP, seit 2005 habe es abgekühlt. Dieser «Mythos der Klimapause» sei schon lange widerlegt.
Die Behauptung, «dass in diesem Jahrhundert keine Klimaerwärmung stattgefunden und das Meer sich sogar abgekühlt hat», sei, so der ETH-Wissenschaftler, «schlicht falsch».
Knutti verweist auf den Stand der Forschung. Diesem zufolge sei der Mensch mit einer Wahrscheinlichkeit «von mehr als 95 Prozent der Hauptverursacher der globalen Erwärmung seit 1950».
Und die SVP?
Das Generalsekretariat erklärt, man überarbeite derzeit das Parteiprogramm, somit auch die klimapolitischen Positionen.
Deshalb wolle man die Beanstandungen der Forscher nicht kommentieren.
Der Clinch zwischen Wissenschaft und Volkspartei dürfte jedenfalls weiterbestehen:
Mit «Überraschungen» sei im neuen Papier nicht zu rechnen, so das Sekretariat.
| Reto Knutti |
Professor, Dr., Institut für Atmosphäre und Klima, ETH Zürich
Er erforscht den Einfluss des Menschen auf das Klimasystem.
Er ist Hauptautor des Berichts des Uno-Klimarats IPCC, der
2013 erschien.
▶Reto Knutti: Who is who (Anthropogene Globale Erwärmung) ▶Reto Knutti: Wikipedia (Profiteure) |
| de | en | fr |
|---|---|---|
| Neuste Informationen über den Klimawandel | News on Climate Change | Nouvelles informations sur le changement climatique |
| Die Erwärmungspause | The Hiatus | La pause du réchauffement climatique |
▶
SVP Schweiz: Für eine Klimapolitik mit Augenmass
L'UDC demande le retour à la raison en politique climatique
| TA |
Tages-Anzeiger
▶Tages-Anzeiger (Presse) ▶TA: Who is who (Medien der Globalen Erwärmung) |
de Panik-Küche en Panic laboratory fr Marmite alarmiste
-
2018-08-14 de
 Harald Lesch bei Markus Lanz, 14.08.2018
Harald Lesch bei Markus Lanz, 14.08.2018
-
EIKE Europäisches Institut für Klima und Energie
Stefan Kämpfe
2018-08-17 de Die Irrungen und Halbwahrheiten des ZDF-Fernsehprofessors Harald Lesch - eine Richtigstellung aus meteorologischer SichtDas am 14.08.2018 gesendete Interview von Herrn Lesch enthielt aus meteorologischer Sicht zahlreiche Irrungen und Halbwahrheiten, welche einer Klarstellung bedürfen.
Es wird nur auf die schlimmsten Fehler eingegangen; die Aussagen des Herrn Lesch sind sinngemäß wiedergegeben.
"Noch nie gab es im Sommer Brände diesen Ausmaßes in Deutschland, wie im Sommer 2018".
Das ist falsch- Ältere erinnern sich vielleicht an die verheerenden Brände in der Lüneburger Heide im Dürre-Sommer 1975.
Es brannten etwa 8.000 Hektar Wald. Näheres dazu hier bei Wikipedia.
Und sommerliche Dürren gab es schon immer.
Ältere erinnern sich sicher noch an 1911, 1947, 1959, 1975, 1976 und 1982.
Im Sommer 1969 blieb der Regen in Südschweden zwei Monate gänzlich aus.
Starkregen
"Das Wort Starkregen gibt es im Deutschen noch nicht lange.
90-jährige können sich an so was gar nicht erinnern."Da hätte ein Blick in ältere Aufzeichnungen gewiss geholfen - schwerste Sommer-Überschwemmungen in Deutschland gab es beispielsweise im Juli 1954.
Und auch lokale Ereignisse durch Unwetter traten leider immer wieder auf, so in Bruchstedt/Thüringen 1950, Näheres dazu hier.
Auch in früheren Jahrhunderten traten sie auf, und zwar viel schlimmer als die 2018er Ereignisse, man denke nur an die "Thüringer Sintflut" von Ende Mai 1613 hier und die vermutlich schwerste Naturkatastrophe Deutschlands, das Sommerhochwasser von 1342 hier.
"Wenn die Winter immer trockenen werden... dann bleibt das Grundwasser zu niedrig... ."
Der Langfristtrend der DWD-Niederschlagswerte (Flächenmittel Deutschland) zeigt eindeutig das Gegenteil - unsere Winter werden feuchter:
"Je wärmer die Arktis wird, desto instabiler wird der Jetstream... .
Dadurch kommt es unter anderem zu heißeren, extremeren Sommern."Das ist eine der ganz wenigen Aussagen des Herrn Lesch mit einem gewissen Wahrheitsgehalt.
Allerdings fehlen auch hierfür eindeutige Beweise, denn der Jetstream wird auch sehr stark von anderen Faktoren, wie etwa der Sonnenaktivität oder Vulkanausbrüchen, beeinflusst.
Die Datenlage hierfür ist dünn; der Zonalwind über Deutschland in der Mittleren Troposphäre (500hPa), welcher zumindest ein grobes Maß für die Stärke der Westwind-Zirkulation über Deutschland ist, wehte seit Aufzeichnungsbeginn (1948) sogar stärker;
eigentlich müsste er bei schwindendem Arktiseis schwächer werden:
Auf der Nordhalbkugel ist es zurzeit ungewöhnlich heiß... ."
Es ist, gemessen am Langjährigen Mittel, im Juli auf der Nordhalbkugel um etwa 0,4 bis 0,5 Kelvin (entspricht 0,4 bis 0,5°C) zu warm gewesen
dramatisch ist das nicht, wie ein Vergleich mit dem Juli 1994 zeigt.
(Bildquellen: IRI International Research Institute, siehe Artikel)
Und dass es im März 2018 in großen Regionen der Nordhalbkugel markant zu kalt war, erwähnt Herr Lesch lieber nicht;
auch hierzu die Karte im Artikel (Die Anomalien beziehen sich bei allen 3 Abbildungen auf die Mittelwerte der Normalperiode 1971 bis 2000):
"Die Nutzung der Windenergie ist noch lange nicht ausgeschöpft... ."
Das könnte falsch sein.
Untersuchungen zeigen, dass der Wind in Deutschland bereits schwächer wird;
hier eine Untersuchung mit DWD-Beaufort-Werten aus Norddeutschland:
Zum Abschluss ein Wort zu den Äußerungen über den Hurrikan OPHELIA.
Dass Hurrikane statt zur Karibik Richtung Europa ziehen; kommt immer mal wieder gelegentlich vor; wer alte Wetterkarten sichtet, wird fündig.
Eine "Hitzewelle", wie in dem Interview behauptet, löste OHELIA zumindest in Deutschland nicht aus - denn es war schon Oktober.
(Über den Lebenszyklus des Hurrikans OPHELIA gibt es hier beim EIKE eine gute Dokumentation).
Und dass es da noch mal so um 25 Grad warm wurde, hatte mit der großräumigen Zirkulation zu tun - übrigens kann es immer mal bei uns im Oktober nochmals sommerlich warm werden -
wer sucht, wird beispielsweise 2001, 1995 und 1985 fündig.
Und gibt es immer mehr schwere Wirbelstürme?
Die letzte Grafik zeigt keine Zunahme:
Übrigens - nach der intensiven 2017er Hurrikan-Saison wird eine sehr schwache 2018er Saison erwartet -
Grund sind unter anderem negative Wassertemperaturen im tropischen Nordatlantik.
Wieder einmal zeigt sich: ZDF bedeutet "Zwangsgebührenfinanzierte, desinformierende Falschmelder"
armes Deutschland, wenn Du dafür auch noch Gebühren zahlen musst.
| ZDF |
Zweites Deutsches Fernsehen
▶ZDF: Who is who (Medien der Globalen Erwärmung) |
▶
![]() Harald Lesch: Übrigens zur Klimakatastrophe
Harald Lesch: Übrigens zur Klimakatastrophe
| Harald Lesch |
Astrophysiker, Naturphilosoph, Wissenschaftsjournalist, Fernsehmoderator, Professor für Physik an der LMU München Lehrbeauftragter für Naturphilosophie an der Hochschule für Philosophie München. ▶Harald Lesch: Who is who (Aktivist der anthropogenen Globalen Erwärmung) ▶Harald Lesch: Wikipedia (Profiteure) |
de Fakten en Facts fr Faits
-
EIKE Europäisches Institut für Klima und Energie
Stefan Kämpfe
2018-08-01 de Juli 2018 in Deutschland - kein neuer RekordmonatAuch wenn dieser Juli 2018 vielen rekordverdächtig vorkam - er schaffte es nicht, den bisherigen Rekordhalter von 2006 auch nur annähernd zu gefährden.
Der Titel des "Vizemeisters" bleibt weiterhin dem 1994er Juli erhalten; Platz 3 belegt der Juli 1983.
Dieser Juli war speziell im letzten Monatsdrittel von Hitzewellen geprägt, weil es Ableger des Azorenhochs immer wieder schafften, sich nach Mittel- und Nordeuropa auszubreiten;
zeitweise entwickelten sich daraus kräftige Skandinavien-Hochs.
Dieser Umstand erklärt auch, warum es in diesem Monat, trotz meist positiver NAO- Werte, kaum feucht-kühles "Westwetter" gab.

 Enge "Verzahnung" von Sonnenscheindauer und Temperatur.
Enge "Verzahnung" von Sonnenscheindauer und Temperatur.
Sonnige Juli- Monate sind stets warm;
die Sonnenscheindauer vermag mehr als 70% der Temperaturvariabilität seit 1951 zu erklären;
in keinem anderen Monat besteht ein derart enger Zusammenhang.
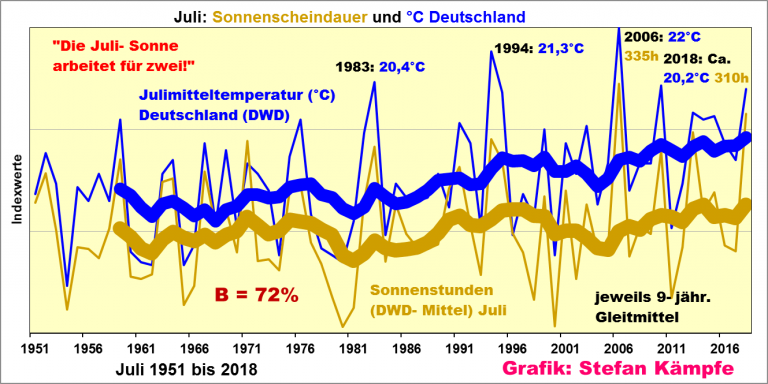
Zusammenfassung
Der 2018er Juli war dank einer hohen Sonnenscheindauer und vieler Hochdruckwetterlagen sehr warm, ohne es unter die drei wärmsten Juli-Monate in Deutschland seit Aufzeichnungsbeginn zu schaffen.
Auch langfristig lässt sich nahezu die gesamte Juli- Erwärmung in Deutschland mit geänderten Großwetterlagenhäufigkeiten und einer längeren Sonnenscheindauer erklären; hinzu kommen wachsende Wärmeinseleffekte, auf welche hier nicht näher eingegangen wird.
| EIKE |
Europäisches Institut für Klima und Energie European Institute for Climate and Energy ▶EIKE: Who is who (Skeptische Institute & Organisationen) ▶EIKE: Wikipedia (Opfer) ▶EIKE: Webseiten (Deutsch) |
-
Die kalte Sonne (Fritz Vahrenholt & Sebastian Lüning)
2018-08-11 de Deutschland hat kein Hitzeproblem - sondern ein HysterieproblemDie Hitzewelle ist in den meisten Teilen Deutschlands jetzt erstmal abgehakt.
Es war ein wahres Fest für alle Aktivisten.
Bei allem Warnen, Drohen und Qungeln vergaßen sie doch glatt, dass Klima das durchschnittliche Wetter von 30 Jahren ist.
Das war nun plötzlich ganz egal.
Es war heiß, da wollte man sich mit diesem dummen Ballast nicht mehr abgeben:
Die Hitze sei ein Vorbote der Hölle, in die alle Klimaalarm-Ungläubigen schnellstmöglich gelangen, wenn sie nicht die Forderungen der Klima-Gottheiten umgehend erfüllen.
Sonst drohe der Weltuntergang.
Zum Glück gab es in der Berichterstattung auch wenige Ausnahmen.
Zum eine wäre da Jörg Kachelmann am 3. August 2018 bei den t-online-Nachrichten:
Kachelmanns Donnerwetter: Kein Sommermärchen
Deutschland hat Angst vorm Klimawandel - und vor Ventilatoren.
Während im Winter die nächste Klimakatastrophe droht, tut die Regierung nichts.
Weil sie die vielen "Dummen" nicht verprellen will.
Manchmal bestimmt Mesut Özil nicht nur die Medienagenda für ein paar Tage, sondern für einen Sommer.
Natürlich nicht er alleine, sondern "Die Mannschaft".
Man kann das wunderbar vergleichen mit 2006.
Damals war der Juli noch mal zwei Grad wärmer als der Juli 2018, also noch mal 50 Prozent weiter über dem Durchschnitt,
aber das, was de facto viel schlimmer war als heute, war damals keine böse Hitzewelle, die alles kaputtmachte, sondern ein WM-Sommertraum oder meist das legendäre "Sommermärchen".
Der zweite Lichtblick zum Thema stammt von Torsten Krauel, der am 8. August 2018 in der Welt schrieb:
Deutschland hat kein Hitzeproblem - sondern ein Hysterieproblem
Sahara-Sommer?
Esst vegan, oder es kommt der Weltuntergang?
Von wegen.
Heiße Sommer hat es viele gegeben, regnerisch-kühle genauso. Deutschland hat kein Hitzeproblem, das zeigt ein Blick in die Vergangenheit.Deutscher Saharasommer 2018!
Glühende Landschaften!
Wer so etwa schreibt, war nie in der Sahara.36 Grad bei nur 55 oder 60 Prozent Luftfeuchtigkeit?
Das wäre in etlichen Weltregionen ein angenehm trockener Erholungstag.Um die 40 Grad bei 95 Prozent Luftfeuchte sind in weiten Teilen Chinas die Regel.
 Weiterlesen in der Welt: Deutschland hat kein Hitzeproblem -
sondern ein Hysterieproblem
Weiterlesen in der Welt: Deutschland hat kein Hitzeproblem -
sondern ein Hysterieproblem
Danke Herr Kachelmann, Danke Herr Krauel.
Sie sprechen das aus, was viele nur insgeheim denken.
Es ist wichtig, dass man in dieser politisierten Materie mitdenkt und sein Meinung kundtut, ansonsten glaubt die Alarmfraktion, die Nation prächtig geleimt zu haben.
| Die kalte Sonne | Die kalte Sonne (Fritz Vahrenholt & Sebastian Lüning) |
Positionspapier der SVP 2009:
Für eine Klimapolitik mit Augenmass
fr
Document de fond de l'UDC Suisse 2009:
Retour au bon sens en politique climatique
-
de
 Für eine Klimapolitik mit Augenmass
Für eine Klimapolitik mit Augenmass
Aus der Zusammenfassung:
Seit jeher ist das Klima auf der Erde Veränderungen unterworfen.
Heute gemessene Entwicklungen stellen daher keine neue Erscheinung dar.Im Verlauf des 20. Jahrhunderts sind die weltweiten Durchschnittstemperaturen um ungefähr 0.6 °C angestiegen.
Seit dem Jahr 1998 hat es weltweit keine Erwärmung mehr gegeben, seit 2005 kühlte es gar ab. In der Arktis, wo heutzutage das Schmelzen gewisser Eisgebiete mit grossem Medienspektakel verfolgt wird, hat bereits zwischen 1925 und 1945 eine ähnlich warme Periode wie heute geherrscht.
Auch in der Schweiz wurde das bisher wärmste Jahr 1994 seit nunmehr über einem Jahrzehnt nicht mehr übertroffen.
Man kann somit keinesfalls von einem kontinuierlichen, starken Anstieg der Temperaturen sprechen.
Die SVP fordert:
-
Das Kyoto-Protokoll regelt die weltweiten Bemühungen zur Senkung des CO2- Ausstosses bis zum Jahr 2010.
Nimmt man die volle Periode hinzu, welche für das Erreichen des Ziels massgebend ist, entfaltet das Kyoto-Protokoll bis spätestens 2012 Wirkung.
Das CO2-Gesetz dient der nationalen Umsetzung des Kyoto-Protokolls.
Es macht keinen Sinn, dass die Schweiz ohne internationale Abstützung dieses Gesetz weiterhin behält.
Wie oben dargelegt, ist die Schweiz nur für 0.1 % der weltweiten menschengemachten CO2-Emissionen verantwortlich und allein der jährliche Anstieg der chinesischen Emissionen übersteigt die schweizerischen Emissionen um ein Vielfaches.
In dieser Situation ist es absolut widersinnig, ohne internationale Abstützung weitere Reduktionsbemühungen zu unternehmen.
Das CO2-Gesetz ist deshalb per Ende 2010, spätestens per Ende 2012 aufzuheben.
Entsprechend ist auf die Erhebung der CO2-Abgabe nach 2010 bzw. 2012 zu verzichten.
-
Entsprechend der baldigen Beendigung der Fristen des Kyoto-Prozesses darf keine Teilzweckbindung eingeführt werden. Dies würde neue Abhängigkeiten schaffen und die bei einer Subventionierung üblichen Marktverzerrungen hervorrufen.
Gerade in der aktuellen Situation einer sich anbahnenden Wirtschaftskrise wäre es genau das Falsche, den Steuerzahlern noch mehr Geld aus der Tasche zu ziehen und die Kaufkraft von Privathaushalten und Unternehmungen zu schwächen.
Die SVP fordert, dass das Versprechen von Bundesrat und Parlament, die Erträge der CO2-Abgabe den Steuerzahlern zurückzuerstatten, auch wirklich eingehalten wird.
-
Das Versprechen, die CO2-Abgabe staatsquotenneutral zu realisieren, wurde bereits durch die Unterstellung dieser Abgabe unter die Mehrwertsteuerpflicht gebrochen.
Die CO2-Abgabe ist umgehend von der Mehrwertsteuer zu befreien.
Die jährlich 18 Millionen Franken, welche den Steuerzahlern damit aus der Tasche gezogen werden, sind zurückzuerstatten.
-
SVP - Schweizerische Volkspartei
Pressekonferenz vom 24. Februar 2009
Ideologie und Angstmacherei prägt nach wie vor die Klimadiskussion.
Wie damals beim Waldsterben überbieten sich Politiker von Links bis Rechts mit oftmals realitätsfremden Forderungen zu staatlichen Umverteilungs- und Fördermassnahmen.
Die SVP fordert eine Rückkehr zur Vernunft.
Ein neues internationales Klima-Abkommen darf es nur geben, wenn alle Länder mit grossem CO2-Ausstoss an Bord sind.
Die SVP erhebt folgende klimapolitischen Forderungen:
-
Aufhebung des CO2-Gesetzes zum Zeitpunkt der Beendigung der vom Kyoto-Protokoll geregelten Periode (2010, spätestens 2012).
-
Bis dahin Beibehaltung der vollständigen Rückgabe der CO2-Abgabe an die Steuerzahler und Verzicht auf die Einführung einer Teilzweckbindung.
-
Keine Beteiligung der Schweiz an einem Nachfolge-Protokoll, wenn sich nicht sämtliche Grossemittenten zu Begrenzungen verpflichten.
-
Keine nationale Regelung, welche weitergeht als die internationalen Verpflichtungen.
SVP - Schweizerische Volkspartei
Videos vom 25. Februar 2009
-
2009-02-25 de
 SVP fordert Klimapolitik mit Augenmass
SVP fordert Klimapolitik mit Augenmass
-
2009-02-25 fr
 L'UDC demande le retour à la raison en politique climatique
L'UDC demande le retour à la raison en politique climatique
Ideologie und Angstmacherei prägt nach wie vor die Klimadiskussion.
Wie damals beim Waldsterben überbieten sich Politiker von Links bis Rechts mit oftmals realitätsfremden Forderungen zu staatlichen Umverteilungs- und Fördermassnahmen.
Die SVP fordert eine Rückkehr zur Vernunft.
Ein neues internationales Klima-Abkommen darf es nur geben, wenn alle Länder mit grossem CO2-Ausstoss an Bord sind.
▶
SVP Schweiz: Für eine Klimapolitik mit Augenmass
L'UDC demande le retour à la raison en politique climatique
| SVP / UDC |
SVP - Schweizerische Volkspartei SVP - Swiss People's Party UDC - Union démocratique du centre |
NZZ: Trinkwasser ist im Kanton Zürich
Trotz Trockenheit wäre es gar nicht nötig, Wasser zu sparen
-
NZZ Neue Zürcher Zeitung / Jan Hudec
2018-08-07 de Trotz Trockenheit wäre es gar nicht nötig, Wasser zu sparenTrinkwasser ist im Kanton Zürich trotz Trockenheit in Hülle und Fülle vorhanden - man muss es nur richtig verteilen.
Dafür sorgt der kantonale Trinkwasserverbund.
Doch noch sind nicht alle Gemeinden an das Netz angeschlossen.
100 Schwimmbecken pro Tag
Rund 380 Millionen Liter Trinkwasser, also der Inhalt von 100 Olympia-Schwimmbecken, werden im Kanton Zürich täglich verbraucht -
pro Person entspricht dies über 250 Litern.
An Spitzentagen kann der Verbrauch aber bis auf über 600 Millionen Liter ansteigen.
Das System ist damit bei weitem nicht ausgereizt.
Mit den 700 Reservoirs im Kanton können pro Tag 800 Millionen Liter bereitgestellt werden.
Es handelt sich also eher um ein Verteil- als ein Mengenproblem, denn nicht alle Regionen sind gleichermassen mit grossen Wasservorkommen gesegnet.
| de | en | fr |
|---|---|---|
| Wasser, Land, Nahrung Wasser |
Water, Land, Food Water |
Eau, terre, nourrit Eau |
| Wassermangel | ||
-
Zürichsee-Zeitung / Martin Steinegger
2015-05-08 de Der Tag, an dem es einen ganzen Zürichsee regneteWie viel Wasser kann es in der Schweiz an einem Tag regnen?
Meteoschweiz gibt in einem aktuellen Blogbeitrag dazu die Antwort:
Einmal den ganzen Zürichsee.Der regenreichste Tag seit 1961 war der 7. August 1978.
An diesem Tag fielen gemäss der Berechnung von Meteoschweiz 3,6 km3 (Kubikkilometer) Wasser.
Das entspricht 3,6 Milliarden Kubikmeter. Oder anders umgerechnet:
es entspricht ziemlich genau dem Wasservolumen des Zürichsees, der etwa 3,9 Kubikkilometer fasst.Güterzug, 16-Mal um die Erde gewickelt
In der Schweiz kann es also an einem Tag einen ganzen Zürichsee regnen. Meteoschweiz bietet dazu eine anschauliche Umrechnung:
Würde man diese Wassermenge auf Kesselwagen der SBB verteilen, die 85000 Liter fassen und gut 15 Meter lang sind, benötigte man rund 42 Millionen Wagen.Aneinandergereiht würden diese einen 640000 Kilometer langen Zug bilden.
Diesen könnte man 16-Mal um die Erde «wickeln».
Auf Rang zwei der niederschlagsreichsten Tage folgen übrigens der 21. Dezember 1991 und der 8. August 2007.
An diesen beiden Tagen fielen aber gemäss Meteoschweiz deutlich geringere Wassermengen.
Oder anders ausgedrückte: es regnete keinen ganzen Zürichsee - sondern eher einen Walensee.
| de | en | fr |
|---|---|---|
|
Wetterphänomene Wassermenge |
Weather phenomena Water amount |
Phénomènes météorologiques Débit d'eau |
Prof. Dr. Werner Kirstein sagt Claus Kleber die Meinung
-
Prof. Dr. Werner Kirstein
2018-08-06 de Klimatologe sagt Claus Kleber die Meinung
Klimatologe sagt Claus Kleber die Meinung
Der Klimatologe und Physiker Prof. Dr. Werner Kirstein richtete am 04.08.2018 eine Mail an Claus Kleber vom 'heute-journal' im Zweiten, bzgl. des Beitrages
"Trockener Sommer: Woher kommt die Hitze?"
in der heute-journal-Sendung vom 03.08.2018.
Hier nach besagtem Beitrag aus der Sendung, verlesen.
Sehr aufschlussreich.
Quelle/Source:
-
EIKE Europäisches Institut für Klima und Energie
2018-08-07 de Dr. Claus Kleber (ZDF heute Journal 3.8.18): ".. sich die Atmophäre 'grundstürzend' ändert!"Am 3.8.18 brachte das ZDF im heute Journal angekündigt von seinem Moderator, dem bekannten Klimakatastrophenprediger und Sachbuchautor in nämlicher Sache, Dr. Claus Kleber einen Beitrag zur Hitzeperiode dieses Sommers.
Der Physiker und Klimatologe Prof. Dr. Werner Kirstein fühlte sich bemüßigt, diese permanent wiederholte Klimaktastrophenmeldung, diesmal
sogar als mögliche "grundstürzenden" Änderung der Atmosphäre angekündigt
zu widerlegen mehr Objektivität und Sachlichkeit anzumahnen. Wohl wissend, dass diese beiden Begriffe für das ZDF und Claus Kleber lästige Fremdworte sind.
Schauen und lesen Sie selbst
▶
![]() Prof. Dr. Werner Kirstein: Erdklima vs. Klimapolitik
Prof. Dr. Werner Kirstein: Erdklima vs. Klimapolitik
| Werner Kirstein |
Prof. Dr.
▶Werner Kirstein: Who is who (Skeptiker) ▶Werner Kirstein: Video (Präsentationen) ▶Ausschluss und Maulkorb für Kritiker (Uni Leipzig (Dekan Prof. Dr. Haase) ⬌ Prof. Dr. W. Kirstein) |
| ZDF |
Zweites Deutsches Fernsehen
▶ZDF: Who is who (Medien der Globalen Erwärmung) |
de
Die jahrelange beispiellose Hitze- und Dürreperiode in Europa um 1540
en
The year-long unprecedented European heat and drought of 1540
-
EIKE Europäisches Institut für Klima und Energie
Oliver Wetter, Christian Pfister, Johannes P. Werner, Eduardo Zorita und weitere
2018-08-04 de Die jahrelange beispiellose Hitze- und Dürreperiode in Europa um 1540 - ein Worst CaseAbstract
Die Hitzewellen der Jahre 2003 in Westeuropa und 2010 in Russland, welche allgemein als seltene klimatische Anomalien außerhalb bisheriger Erfahrungen apostrophiert werden, werden oftmals als Warnungen vor noch häufigeren Extremen in einer von der globalen Erwärmung beeinflussten Zukunft herangezogen.
Eine neue Rekonstruktion der Temperaturen in Westeuropa im Frühjahr und Sommer zeigt jedoch, dass es im Jahre 1540 signifikant höhere Temperaturen gegeben haben muss.
Um die Plausibilität dieses Ergebnisses zu überprüfen, untersuchten wir die Schwere der Dürre 1540, indem wir das Argument der bekannten Rückkopplung zwischen Austrocknung des Bodens und Temperatur untersuchten.
Quelle/Source:
-
Springer Nature
Oliver Wetter, Christian Pfister, Johannes P. Werner, Eduardo Zorita and others
2018-06-28 en The year-long unprecedented European heat and drought of 1540 - a worst caseAbstract
The heat waves of 2003 in Western Europe and 2010 in Russia, commonly labelled as rare climatic anomalies outside of previous experience, are often taken as harbingers of more frequent extremes in the global warming-influenced future.
However, a recent reconstruction of spring-summer temperatures for WE resulted in the likelihood of significantly higher temperatures in 1540.
In order to check the plausibility of this result we investigated the severity of the 1540 drought by putting forward the argument of the known soil desiccation-temperature feedback.
Based on more than 300 first-hand documentary weather report sources originating from an area of 2 to 3 million km2, we show that Europe was affected by an unprecedented 11-month-long Megadrought.
The estimated number of precipitation days and precipitation amount for Central and Western Europe in 1540 is significantly lower than the 100-year minima of the instrumental measurement period for spring, summer and autumn.
This result is supported by independent documentary evidence about extremely low river flows and Europe-wide wild-, forest- and settlement fires.
We found that an event of this severity cannot be simulated by state-of-the-art climate models.
Wie ungewöhnlich ist die aktuelle Trockenperiode?
-
EIKE Europäisches Institut für Klima und Energie
Prof. Dr. Horst-Joachim Lüdecke
2018-08-08 de Wie ungewöhnlich ist die aktuelle Trockenperiode?Kaum spielt das Wetter wieder einmal Kapriolen, kreisen auch schon die Krähen des Untergangs über unseren Häuptern und fordern CO2-Buße.
Ein nüchterner Blick auf die Daten beweist dagegen nur Eines:
"Das Gewöhnliche am Wetter ist seine Ungewöhnlichkeit".

 Summe der Niederschlagsmengen von Mai+Juni+Juli für Deutschland
und Mittelengland
Summe der Niederschlagsmengen von Mai+Juni+Juli für Deutschland
und Mittelengland
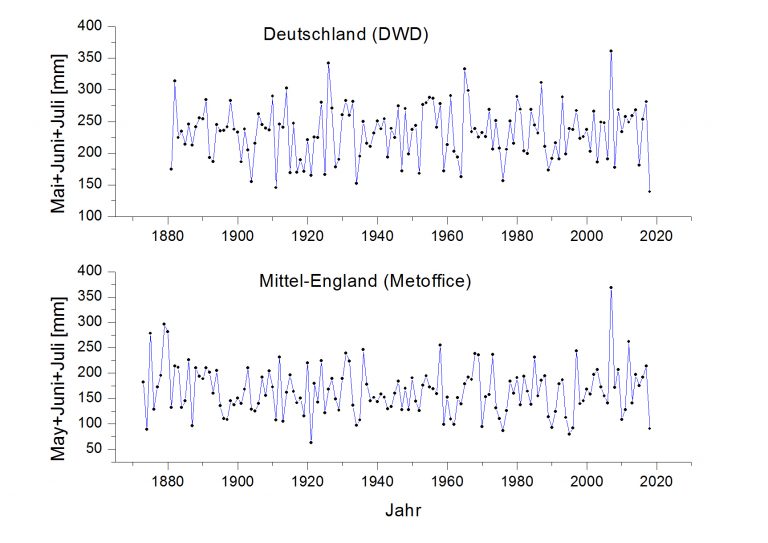
Was ist zu sehen?
Jedenfalls kein säkularer Trend, wie er seitens des IPCC durch den angestiegenen CO2-Gehalt in der Luft vermutet wird.
Wir sehen Wetterereignisse (zur Erinnerung: Klima ist definiert als der statistischen Mittelwert von Wetter über mindestens 30 Jahre).
Der Summenregenwert Mai+Juni+Juli von Deutschland in 2018 ist tatsächlich ein Wetterrekord, wenn auch nur knapp. Seine 139,4 mm Regensumme in 2018 unterbieten die 145,7 mm in 1911 nur geringfügig.
| de | en | fr |
|---|---|---|
|
Wetterphänomene Dürreperioden |
Weather phenomena Periods of Droughts |
Phénomènes météorologiques Periodes de sécheresses |
Es gibt keine "globale Hitzewellen"
-
EIKE Europäisches Institut für Klima und Energie
Michael Bastasch / Andreas Demmig
2018-08-04 de Es gibt keine "globale Hitzewellen""Globale Hitzewelle" ist ein nur Schlagwort, das in Überschriften verwendet wird
Was tatsächlich zutrifft, sind Hitzewellen, die gleichzeitig in verschiedenen Teilen der Welt auftreten.
"Globale Hitzewellen ist also weder ein wissenschaftlicher Begriff noch eine gute Beschreibung dessen, was passiert", sagt Cliff Mass, ein Klimawissenschaftler an der Universität von Washington.
In letzter Zeit Sie sind wahrscheinlich auf Schlagzeilen über die "globale Hitzewelle" gestoßen, die verheerende Schäden von Japan über Europa bis nach Nordafrika anrichtet.
Falls Sie den Begriff "globale Hitzewelle" zum ersten Mal hören, sind Sie damit nicht allein.
Das liegt daran, dass es sich um einen Begriff handelt, der in hanebüchenden Schlagzeilen verwendet wird, um die Aufmerksamkeit zu steigern.
"'Global Heat Wave' scheint ein neuer Begriff zu sein, den einige Leute in den Medien- und Klima-Lobbygruppen erfunden haben", sagte Cliff Mass, ein Klimawissenschaftler an der Universität von Washington, dem Daily Caller.
Der Juli scheint über einen Großteil der nördlichen Hemisphäre hinweg glühende Hitze zu haben, einschließlich Rekordhochs in Kalifornien und Kanada.
Dreistellige Wärmegrade (in Fahrenheit 100 F = 38°C) wurden mit Todesfällen in Japan in Verbindung gebracht und brutzelnde Temperaturen trugen zu massiven Waldbränden in Skandinavien bei - Es ist mal wieder richtig Sommer.
Aber der Begriff "globale Hitzewelle" weckt Bilder von Hitzeglocken, die den gesamten Planeten kochen.
Was gemeint ist, sind Hitzewellen, die gleichzeitig in verschiedenen Teilen der Welt auftreten.
"Hitzewellen sind zwangsläufig lokalisierte Angelegenheiten, die normalerweise mit anomal hohem Luftdruck verbunden sind", sagte Mass in einer E-Mail.
"Globale Hitzewellen sind also weder ein wissenschaftlicher Begriff noch eine gute Beschreibung dessen, was passiert ist."
Auch der Klimawissenschaftler des Cato-Instituts, Ryan Maue, kritisierte Schlagzeilen, in denen von einer "globalen Hitzewelle" die Rede ist und von Wissenschaftlern, die ihre Namen für solche haarstäubenden Behauptungen zur Verfügung stellen.
Abgesehen davon, dass es Winter in der südlichen Hemisphäre ist, bemerkte Maue,
dass die Temperatur der nördlichen Hemisphäre derzeit dem Durchschnitt der letzten 18 Jahre entspricht.
Er stellte außerdem fest,
dass die Landtemperaturen der nördlichen Hemisphäre derzeit insgesamt unter dem Normalwert lagen.
| de | en | fr |
|---|---|---|
|
Wetterphänomene Hitzewellen |
Weather phenomena Heat Waves |
Phénomènes météorologiques Canicules |
Schellnhuber-Evergreen: Und ewig kippt das Klima
-
EIKE Europäisches Institut für Klima und Energie
Dirk Maxeiner
2018-08-09 de Schellnhuber-Evergreen: Und ewig kippt das KlimaSeit vielen Jahren erfindet das PIK bis vor kurzem von Hans-Joachim Schellnhuber geleitet, neue Klima-Bedrohungen, in der nicht falschen Hoffnung dass die Medien diese verstärkend aufgreifen und so die hoch lukrative Klimafurcht-Politik weiter am Leben zu halten.
Dazu gehört auch seit einigen Jahren die durch nichts gestützte Hypothese, dass das "Weltklima" durch die menschlichen CO2 Emissionen zum "kippen" gebracht werden könne.
Natürlich ins dann unvermeidbare Elend. Weltuntergang à la Schellnhuber.
Bisher war dieser apokalyptischen Weissagung nicht viel mediale Aufmerksamkeit beschieden.
Das müsse sich nun ändern befand das rührige Meidienteam.
Motto: Lasse keine (und sei sie noch so dürftig) Krise ungenutzt.
Also flugs alten Wein in neue Schläuche gegossen und an die derzeitige Hitzewelle angehängt.
Die Journos werden schon den Rest erledigen.
Dirk Maxeiner berichtet die ganze Story
-
Süddeutsche Zeitung
2018-08-06 de Studie: Klimasystem könnte in Heißzeit kippende Panik-Küche en Panic laboratory fr Marmite alarmiste
Die Gefahr einer Heißzeit kann aus Sicht von Klimaforschern selbst beim Einhalten des Pariser-Klimaabkommens nicht ausgeschlossen werden.
Dabei würde sich die Erde langfristig um etwa vier bis fünf Grad Celsius erwärmen und der Meeresspiegel um 10 bis 60 Meter ansteigen.
Das schreibt das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK).
Ein internationales Team von Wissenschaftlern diskutiert diese Möglichkeiten in den "Proceedings" der US-nationalen Akademie der Wissenschaften ("PNAS") und blickt dabei insbesondere auf Kippelemente im Klimasystem.
Dazu gehören laut Studie etwa die auftauenden Permafrostböden in Russland, die sich erwärmenden Methanhydrate auf dem Meeresboden und die großen Ökosysteme wie der Amazonas-Regenwald.
Sie könnten sich wie eine Reihe von Dominosteinen verhalten, sagte Mitautor Johan Rockström, Direktor des Stockholm Resilience Centre und designierter Ko-Direktor des PIK.
"Wird einer von ihnen gekippt, schiebt dieses Element die Erde auf einen weiteren Kipppunkt zu."
"Der Mensch hat als geologische Kraft bereits seine Spuren im Erdsystem hinterlassen", sagte Mitautor und PIK-Gründungsdirektor Hans Joachim Schellnhuber.
"Werden dadurch empfindliche Elemente des Erdsystems gekippt, könnte sich die Erwärmung durch Rückkoppelungseffekte selbst weiter verstärken.
Das Ergebnis wäre eine Welt, die anders ist, als alles, was wir kennen", ergänzte er.
"Die Forschung muss sich daran machen, dieses Risiko schnellstmöglich besser abzuschätzen."
Nach Angaben der Autoren könnte es schwieriger werden als bislang angenommen, die globale Erwärmung wie im Pariser Klimaabkommen vereinbart zwischen 1,5 und unter 2 Grad Celsius zu stoppen.
Man könne sich nicht darauf verlassen, dass das Erdsystem bei 2 Grad langfristig sicher "geparkt" werden könne, sagte Schellnhuber.
Derzeit ist die Erde im Durchschnitt bereits gut 1 Grad wärmer als noch vor Beginn der Industrialisierung.
Selbst bei vorläufiger Begrenzung der menschengemachten Erderwärmung auf maximal 2 Grad könnten kritische Prozesse im Klimasystem angestoßen werden, die eine noch stärkere Erwärmung - auch ohne weiteres menschliches Zutun - bewirken, erläuterte Erstautor Will Steffen von der Australian National University (ANU) und dem Stockholm Resilience Centre (SRC).
Nach PIK-Angaben könnte das bedeuten, dass sich der Klimawandel dann selbst verstärkt - "auf lange Sicht, über Jahrhunderte und vielleicht Jahrtausende".
Kippelemente im Erdsystem seien mit schweren Felsbrocken am Strand vergleichbar, erläuterte Schellnhuber.
Würden diese langsam, aber unaufhörlich unterspült, könnte irgendwann schon die Landung einer Fliege an einer neuralgischen Stelle ausreichen, um die Brocken kippen zu lassen.
"Wir weisen in unserem Artikel darauf hin, dass es im planetarischen System bereits derart unterspülte Felsbrocken gibt, die wir als Kippelemente bezeichnen.
Ist die Erderwärmung weit genug fortgeschritten, reicht vielleicht schon eine kleine Veränderung aus, um diese Elemente in einen ganz anderen Zustand zu stoßen."
In Teilen der Westantarktis seien bereits einige Kipppunkte überschritten worden. "Der Verlust des Eises in einigen Regionen könnte dort schon ein weiteres, noch umfangreicheres Abschmelzen über lange Zeiträume vorprogrammiert haben", sagte Schellnhuber.
Und der Kollaps des grönländischen Eisschildes könnte bereits bei einer Temperaturerhöhung um 2 Grad einsetzen.
"Die roten Linien für einige der Kippelemente liegen wohl genau im Pariser Korridor zwischen 1,5 und 2 Grad Erwärmung."
| de | en | fr |
|---|---|---|
|
Klima: Fragen Klima-Kipp-Punkte |
Climate: Questions Climate Tipping Points |
Climat: Questions Points de non retour dans le climat |
|
Hans-Joachim Schellnhuber *1950-06-07 |
Professor, Bis September 2018 war er Direktor des 1992 von ihm gegründeten Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung (PIK) ▶Hans-Joachim Schellnhuber: Who is who (Aktivisten der anthropogenen Erwärmung) |
| SZ |
Süddeutsche Zeitung
▶SZ: Who is who (Medien der Globalen Erwärmung) |
de
'Heiß-Haus Erde': Extrem fragwürdig
en
Hothouse Earth: It's extremely dodgy
-
EIKE Europäisches Institut für Klima und Energie
Dr. David Whitehouse, GWPF Science Editor / Chris Frey
2018-08-09 de 'Heiß-Haus Erde': Extrem fragwürdigKeine neue Wissenschaft, kein neues Szenario und folglich kein neuer Grund für Panik.
Es war eine lange Hitzewelle in weiten Teilen Europas, die Fragen ausgelöst hat wie "welche Rolle spielt der Klimawandel bei der diesjährigen Hitzewelle"?
Einige behaupten, dass es zweimal so oft dazu kommt, andere behaupten, dass der Klimawandel alles immer schlimmer macht.
"So sieht Klimawandel aus!", sagt Prof. Michael Mann.
Es wird das Gefühl verbreitet, dass dieser Sommer zeigt, wie es in Zukunft aussehen könnte.
"Man erwarte so etwas immer öfter!", lautet der Aufschrei.
-
The Global Warming Policy Forum (GWPF)
Dr. David Whitehouse, GWPF Science Editor
2018-08-07de Hothouse Earth: It's extremely dodgyNo new science, no new data, no new scenario and consequently no new cause for panic.
It's been a long heatwave in much of Europe which has prompted questions like 'what is the influence of climate change on this year's heatwave?'
Some claim that it's twice as likely to occur, while others claim that climate change is making it worse.
"This is the face of climate change," says Professor Michael Mann.
There is a feeling in the hot air that this summer is showing the way of the future.
'Expect this kind of thing more often', is the cry.
| de | en | fr |
|---|---|---|
| Klimawandel: Diskussionen | Climate change: Discussions | Changement climatique: Discussions |
| Hiobs-Prognosen | ||
Woher kommt die Dürre und Wärme des Sommers 2018?
-
EIKE Europäisches Institut für Klima und Energie
Hartmut Hüne
2018-08-09 de Woher kommt die Dürre und Wärme des Sommers 2018?
 Die Sonne ist mehr als die sichtbare Strahlung
Die Sonne ist mehr als die sichtbare Strahlung

Die aktuelle extreme Hitze und länger dauernde Trockenheit, die wir derzeit erleben, lässt sich gut mit ungewöhnlichen Koronaentladungen auf der Sonne erklären, meint unser Autor Hartmut Hüne und liefert auch den passenden Mechanismus dazu.
Die diesjährige Trockenheit und grosse Wärme darf man zu Recht als ein besonderes "Naturereignis" klassifizieren.
Die diesjährigen Wetterverhaeltnisse werden wirklich durch "natürliche" und nicht voraussehbare Vorgänge bewirkt.
Nämlich:
Auf der Sonne sind, wie es öfter passiert, Plasmaringe (die Zigaretten-Rauchringen in ihrer Physik als "Wirbelschlauchringe" verwandt sind ) aufgebrochen. Siehe Abb. 1

 Abb. 1 Geschlossene Plasmaringe (A) brechen auf (B)
Abb. 1 Geschlossene Plasmaringe (A) brechen auf (B)
und bewirken einen starken Parttikelstrom (Rot)
Magnetfeldlinien sind (Schwarz) dargestellt

Das wirkt so als ob man einen Wasserschlauch aufschneidet.
Aus dessen Enden spritzt dann das Wasser heraus.
Nach dem Aufbrechen der solaren Plasmaringe wird dann Materie aus den tieferen Schichten der Sonne, d. h. hochenergetische, ionisierte Teilchen (sonst Sonnenwind genannt) mit hoher Geschwindigkeit in gewaltigen Mengen ausgestoßen.
Die Röntgenaufnahmen der Sonne dieses Jahres zeigen die Enden der aufgebrochenen Plasmaschläuche dunkel, sogenannte "Koronarlöcher".

 Abb. 2 Röntgenbilder der Sonne im Frühjahr 2018 zeigen die
"Koronalen Löcher"
Abb. 2 Röntgenbilder der Sonne im Frühjahr 2018 zeigen die
"Koronalen Löcher"
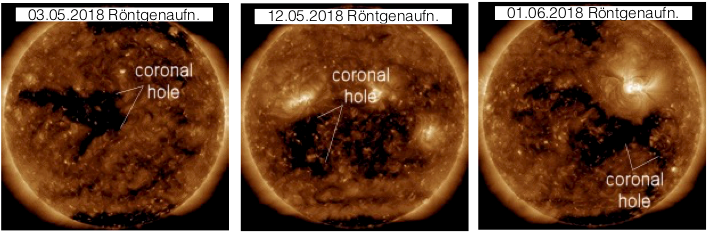

Meistens brechen die Plasmaringe in den Polregionen der Sonne.
Der Teilchenstrom geht dann senkrecht zur Ebene, in der die Planeten umlaufen, und trifft und beeinflusst die Planeten nicht.
Wie aber in Abb. 2 zu sehen, brachen dieses Jahr Ringe vorzugsweise in der Äquatorialregion, so dass der Teilchenstrom die Planeten, und eben auch die Erde, sozusagen "volle Breitseite" trifft.
Derzeit liegt der Teilchenstrom, der die Erde trifft, bei 600% (!!) des gewöhnlichen.
Das mit dem Teilchenstrom mitgeführte Magnetfeld von der Sonne hat das Erdmagnetfeld so gestört, dass es über dem Nordpol in Millionen von Quadratkilometern aufgerissen (d. h. sehr schwach) ist.
Das Erdmagnetfeld leitet gewöhnlich den Teilchenstrom um die Erde herum.
Da es jetzt fehlt, trifft der Teilchenstrom ungehindert die Erdatmosphäre.
Die gewaltige Energie der Sonnenwindteilchen trifft die Arktis und erwärmt diese massiv.
Weiterhin verdrängt der starke Sonnenwind die noch höher-energetische Höhenstrahlung aus dem Kosmos ("Forbush-Effekt"), welche auf Grund ihrer hohen Energie die Kondensationskeime für die Wolkenbildung stellen.
Folglich wird Wolkenbildung und Niederschlag signifikant reduziert.
Weniger Wolken, viel Sonnenschein, der die Erde erwärmt, und Ausfall von Regen.
Dies ist der Mechanismus, der das ungewöhnliche Wetter dieses Jahr unser Wetter bestimmt.
Was können wir aus dieser Einsicht lernen?
Nicht all zu viel.
Eine Voraussage, wie lange Koronarlöcher existieren werden, die in Richtung Erde emittieren, ist auf Grund unserer beschränkten Kenntnisse der Sonnenphysik nicht möglich.
Das Erdwetter kann also durchaus noch ins nächste Jahr fort dauern , aber auch abrupt aussetzen.
Immerhin lehrt uns dies Jahr, dass wir, und das heißt das gesamte organische Leben auf der Erde, Naturereignissen, die wir nicht beeinflussen können, relativ hilflos ausgeliefert sind.
Dies gibt uns eine etwas realistischere Sicht der Welt, als die politische Propaganda, welche uns, entgegen allen Forschungsergebnissen (!), einreden will, der Mensch beherrsche die Natur schon so intensiv, dass bereits ein "Antroprozän" angebrochen sei, indem der Mensch die Erde so stark forme, dass sie zerstört zu werden drohe.
Zum Vergleich:
Die am weitesten zurückreichende Temperatur Messreihe ist die von Mittelengland, von 1659 bis Juni 2018 - mit den zwei höchsten Monatsmittel-Temperaturwerten von 18 und 18.2 Grad C. für den Juni.
Im Juli wurden Werte von 18 bis über 19 Grad C. ca. 25 mal gemessen.
Nach dieser Tabelle war der wärmste Juni 1846!
Das diesjährige Sommerwetter ist also, obwohl für unsere Erinnerung ungewöhnlich, im historischen Kontext nicht so selten.
Auch in Zeiten, wo es eine industrielle Emission praktisch noch nicht gab.
Die historischen Daten über Niederschläge vermitteln ein ähnliches
▶ Weizenpreise und Sonnentätigkeit
| de | en | fr |
|---|---|---|
|
Die Sonne Sonnenaktivität |
The Sun Solar Activity |
Le soleil Activité solaire |
↑ Der Klimaschwindel - Freispruch für CO2-Propheten im Kampf um den Klimathron
-
Dr. Wolfgang Thüne / Königswinter, 26.-27. Mai 2018
2018-06-10 de Der Klimaschwindel - Freispruch für
CO₂-Propheten im Kampf um den Klimathron
Der Klimaschwindel - Freispruch für
CO₂-Propheten im Kampf um den Klimathron
⇧
2 Temperaturen (Wetterphänomene)
en Temperatures
fr Températures
Mit folgenden Links wird von anderen Webseiten auf diese Seite verwiesen:
▶Klima-Auswirkungen / Wetterphänomene: Temperaturen
| de | en | fr |
|---|---|---|
|
Wetterphänomene Temperaturen |
Weather phenomena Temperatures |
Phénomènes météorologiques Tampératures |
⇧ de Verzeichnis en Contents fr Sommaire
|
|
⇧ Welt-Info
⇧ de Allgemein en General fr Générale
Topics
|
|
||
|
|
▶Niederschläge: Kommt ein Dürresommer? |
|
| de | en | fr |
|---|---|---|
|
Klima: Fragen Temperatur |
Climate: Questions Temperature |
Climat: Questions Température |
| de | en | fr |
|---|---|---|
|
Klimawandel: Wissenschaft Temperatur |
Climate change: Science Temperature |
Changement climatique: Science Température |
| Temperatur-Zyklen | Temperature Cycles | Cycles des températures |
| Temperatur und Wärmeinhalt der Ozeane | Temperatures and Heat content of the oceans | Températures et contenu thermique des océans |
|
Gefälschte Temperaturdaten Prinzip der Temperatur-Manipulationen Nachträgliche Temperatur-Manipulationen durch NASA-GISS |
||
⇧ de Text en Text fr Texte
↑ Aktuelle Webseiten
⇧ 2020
↑ Kommt ein Dürresommer? Eine experimentelle Prognose auf Basis der schwankenden Sonnenaktivität
-
Die kalte Sonne (Fritz Vahrenholt & Sebastian Lüning)
Dr. Ludger Laurenz
2020-04-19 de Kommt ein Dürresommer? Eine experimentelle Prognose auf Basis der schwankenden SonnenaktivitätDie schwankende Sonnenaktivität beeinflusst unser Wetter nach neueren Untersuchungen wesentlich stärker als gedacht.
Die Aktivität der Sonne schwankt in einem elfjährigen Zyklus, die Energie der Sonnenstrahlung ändert sich dabei aber nur um etwa 0,1 Prozent.
Dennoch beeinflusst die Variation der Sonnenstrahlung unser Wetter erheblich und für jeden spürbar.
Mögliche Verstärkermechanismen befinden sich noch in der Erforschung.
Laut folgender These wird der solare Einfluss auf unser Wetter erkennbar:
Der solare Einfluss auf unser Wetter wird sichtbar, wenn der Beginn des Sonnenzyklus auf das Jahr des Sonnenflecken-Maximums gelegt wird.
In jenem Jahr erzeugt die Sonne einen Startimpuls.
Ausgelöst durch diesen Impuls werden in jedem Zyklus für etwa 10 Jahre wiederkehrende Wettermuster gebildet.
Das betrifft alle Schichten der Atmosphäre.
Aus den wiederkehrenden Wettermustern lassen sich Trendprognosen erstellen.
Dazu hat der Autor in den letzten Monaten mehrere Beiträge verfasst (hier & hier).
-
Die Kalte Sonne / Dr. Ludger Laurenz
2010-03-06 de Handschrift der Sonne in Daten zahlreicher Wetterstationen fordert Meteorologen und Klimaforscher herausZusammenfassende Hypothesen
Im 11-jährigen Sonnenzyklus (Schwabezyklus) erzeugt die Sonne im Jahr des Sonnenfleckenmaximums einen Startimpuls.
Ausgelöst durch diesen Startimpuls werden in jedem Sonnenfleckenzyklus für etwa 10 Jahre ab dem Sonnenfleckenmaximum wiederkehrende Wettermuster gebildet.
Der Vergleich zwischen Sonnensignalen einzelner Stationen mit dem Sonnensignal im Mittelwert größerer Regionen hat gezeigt, dass der solare Einfluss an einzelnen Wetterstationen deutlicher ausgeprägt ist als in Mittelwerten über größere Regionen wie Bundesländer oder Staaten.
Das solare Wettermuster des Schwabezyklus ist beim Niederschlag ausgeprägter als bei der Sonnenscheindauer oder Temperatur.
Eigentlich dürfte es die gezeigten solaren Wettermuster nicht geben.
Sowohl der IPCC als auch führenden Klimaforschungs- und Klimafolgenforschungseinrichtungen in Deutschland betonen bis heute, dass von der Sonne kein bedeutender Einfluss auf den Wettertrend ausgehen kann.
Dafür sei die Variabilität der Sonnenaktivität innerhalb des Schwabezyklus viel zu gering.
Mit diesem Beitrag werden insbesondere die Klimawissenschaftler angesprochen,
die den aktuellen Klimawandel fast allein auf die Zunahme der CO₂-Konzentration zurückführen
und zur Stellungnahme hinsichtlich des nachgewiesenen solaren Einflusses auf den Wettertrend aufgefordert.
Mit dem aufgezeigten solaren Einfluss wird die Argumentation gestützt, dass die Sonne der Haupttreiber für Klimaveränderungen und die aktuelle Warmzeit ist.
Die im ersten KALTESONNE-Beitrag dargestellte positive Korrelation zwischen der Anzahl der Sonnenflecken im Jahr des Fleckenmaximums und der Temperaturanomalie im äquatorialen Pazifik unterstützt die Annahme, dass die globale Erwärmung der letzten Jahrzehnte solar beeinflusst ist (s. bit.ly/2VIKA7R, Abbildung 7).
Mit Hilfe der These vom Impuls der Sonne im Jahr des Fleckenmaximums sind erstmalig Prognosen des monatlichen Niederschlagstrends bis zu 10 Jahre im Voraus möglich.
Die bisher gefundenen Muster sind aber nur in 10 bis 20 Prozent des Jahres so eindeutig, dass eine Trendprognose Sinn ergibt.
Auch in der restlichen Zeit des Jahres ist ein solarer Einfluss auf die Wettermuster zu vermuten.
Allerdings muss nach dem oder den Schlüsseln gesucht werden, die den solaren Einfluss aufzeigen.
Ein Schlüssel dürfte bei den Phasenverschiebungen und unterschiedlichen Verzögerungen in der Wirkungskette Sonne, Stratosphäre und Troposphäre liegen.
Sollte ein solcher Verzögerungsschlüssel gefunden werden, wären noch wesentlich bessere Wettertrend-Prognosen als in diesem Beitrag skizziert möglich sein.
Klimaforschung sollte die Sonne als zentrale Einflussgröße einbeziehen.
Es ist Aufgabe von Sonnenphysikern und Atmosphärenforschern, die Signale der Sonne zu identifizieren, die eine den Wettertrend beeinflussende Wirkung haben.
Alle EDV-gestützten Klimaprojektionen und Zukunftsszenarien, die bisher die Sonne nicht als wesentlichen Wetter- und Klimagestalter einbezogen haben, dürften wertlos sein.
Erst mit Einbeziehung der Sonne als wichtigen Wetter- und Klimagestalter in die Computerprogramme ist mit belastbaren Zukunftsprojektionen zu rechnen.
-
Die Kalte Sonne / Dr. Ludger Laurenz
2020-01-31 de Handschrift des 11-jährigen Sonnenfleckenzyklus in Atmosphäre und OzeanenINHALT:
Kapitel 1: These vom Impuls der Sonne im Jahr des Sonnenfleckenmaximums
Kapitel 2: Vom Sonnenfleckenzyklus im australischen Buschfeuer zur globalen Erwärmung
Kapitel 3: Handschrift der Sonnenfleckenzyklus in der Atmosphäre (17 km, 10 km)
Kapitel 4: Handschrift der Sonnenfleckenzyklus in den Daten einzelner Wetterstationen
Dr. Ludger Laurenz gelang in Zusammenarbeit mit zwei weiteren Wissenschaftlern der Nachweis, dass die Niederschlagsverteilung in weiten Teilen von Europa vom Sonnenfleckenzyklus beeinflusst wird.
Die Ergebnisse sind 2019 im Journal Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics veröffentlicht worden
▶ en Influence of solar activity on European rainfall
Laurenz, L., H.-J. Lüdecke, S. Lüning (2019)
J. Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics,
185: 29-42, doi: 10.1016/j.jastp.2019.01.012
Der Einfluss des Startimpulses der Sonne lässt sich im Sommer in den Monaten Juni und Juli nachweisen, wenn die Sonne bei uns am höchsten steht.
Der Deutsche Wetterdienst (DWD) stellt die Wetterdaten von Deutschland, den und vieler Stationen ab 1881 zur Verfügung.
Seitdem hat es 12 vollständige Sonnenzyklen (von Maximum zu Maximum) gegeben, von 1883 bis 2013, und den aktuellen Zyklus, der 2014 mit einem weiteren Maximum begonnen hat.
Wird der Beginn eines jeden Zyklus auf das Impulsjahr gelegt, entsteht der Kurvenschwarm in Abbildung 1.
Das Impulsjahr entspricht meist dem nach SILSO definierten Jahr mit dem Sonnenfleckenmaximum.
SILSO Sunspot Index and Long-term Solar Observations
en Sunspot number series: latest updateSolar Cycle 25
An international panel of experts coordinated by the NOAA and NASA,to which the WDC-SILSO contributed, released a preliminary forecast for Solar Cycle 25 on April 5, 2019.
Based on a compilation of more than 60 forecasts published by various teams using a wide range of methods, the panel reached a consensus indicating that cycle 25 will most likely peak between 2023 and 2026 at a maximum sunspot number between 95 and 130.
This prediction is now given in the scale of sunspot number Version 2.
Therefore, solar cycle 25 will be similar to cycle 24, which peaked at 116 in April 2014.
The next minimum between the current cycle 24 and cycle 25 is predicted to occur between July 2019 and September 2020.
Given the previous minimum in December 2008, this thus corresponds to a duration for cycle 24 between 10.6 and 11.75 years.
Je nach Monat oder Jahreszeit, in denen solare Wettermuster auftreten, können sich die Impulsjahre geringfügig unterscheiden.
Das dürfte nicht an unterschiedlichen Zeitpunkten des Sonnenimpulses liegen, sondern an unterschiedlichen Verzögerungen, bis das Sonnensignal im Wettertrend erscheint.
Die These vom Impuls im Jahr des Sonnenfleckenmaximums ist so jung, dass Fragen zur Definition des Impulsjahres und der Verzögerungszeiten noch näher analysiert werden müssen.
...
Abbildung 1: Trend der Niederschlagssumme Juni/Juli im Deutschlandmittel

 Abbildung 1: 11-jähriger Sonnenfleckenzyklus und
Trend der Niederschlagssumme Juni/Juli im Deutschlandmittel
Abbildung 1: 11-jähriger Sonnenfleckenzyklus und
Trend der Niederschlagssumme Juni/Juli im Deutschlandmittel
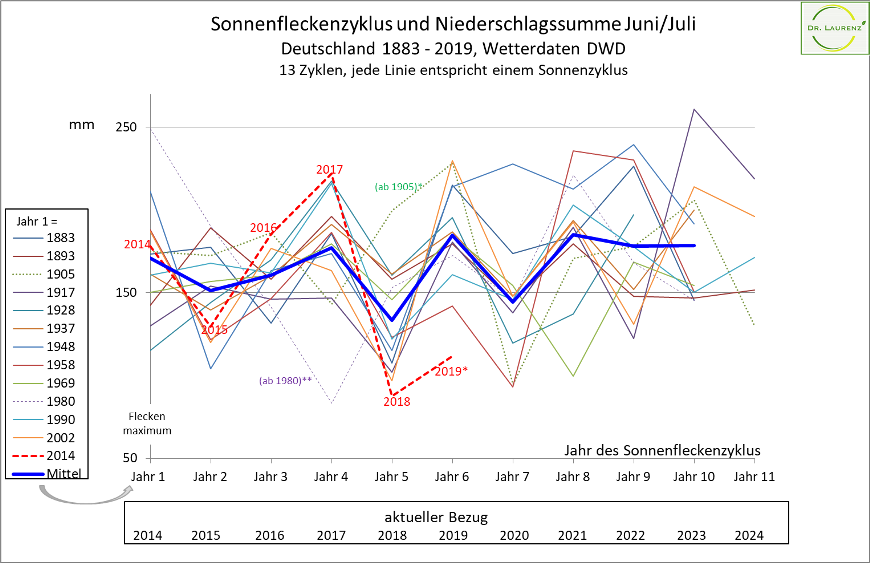
Jede Linie entspricht dem Verlauf der Niederschlagssumme in einem Sonnenzyklus.
Beim erstmaligen Betrachten irritiert der Kurvenverlauf.
Ein ähnliches Muster findet sich weltweit in allen solaren Wettermustern, wenn der Beginn des Sonnenzyklus auf das Jahr des Fleckenmaximums gelegt wird.
Eine Erklärung dafür wird am Ende dieses Beitrages gegeben.
Zeitweise verlaufen alle 13 Kurven gleichsinnig parallel.
Das ist ein Hinweis darauf, dass von der Sonne im Jahr des Fleckenmaximums ein Impuls ausgeht, der für diesen Trend verantwortlich ist.
Mit dieser Parallelität kommt das Signal zum Ausdruck, das die Sonne im Verlauf des Sonnenfleckenzyklus an die Sommerniederschlagsaktivität in Deutschland sendet.
...
Abbildung 2: Wettertrend im Juni/Juli im Deutschlandmittel

 Abbildung 2: 11-jähriger Sonnenfleckenzyklus und
Wettertrend im Juni/Juli im Deutschlandmittel
mit Trendprognose für die nächsten Jahre
Abbildung 2: 11-jähriger Sonnenfleckenzyklus und
Wettertrend im Juni/Juli im Deutschlandmittel
mit Trendprognose für die nächsten Jahre

▶Niederschläge: Kommt ein Dürresommer?
▶Sonnenscheindauer: Kommt ein Dürresommer?
▶Temperaturen: Kommt ein Dürresommer?
▶Auftreten von Dürre: Kommt ein Dürresommer?In Abbildung 2 ist das Sonnensignal für die Klimagrößen Niederschlagssumme, Sonnenscheindauer und Temperatur für Juni/Juli im Mittel von Deutschland dargestellt.
Für den Niederschlagstrend und die Sonnenscheindauer werden Relativwerte verwendet.
Dadurch sind diese Größen leichter vergleichbar.
Die Sonnenscheindauer ist erwartungsgemäß negativ korreliert zur Niederschlagssumme.
Die Temperatur verläuft weitgehend parallel zur Sonnenscheindauer.
Das Zyklusjahr 5 ist das trockenste, sonnenscheinreichste und wärmste Jahr aller Zyklusjahre.
Das Hitze- und Dürrejahr 2018 ist ein Jahr 5.
Die Sonnenaktivität war offensichtlich verantwortlich für den Wettercharakter im Sommer 2018.
Der Kurvenverlauf in Abbildung 2 lässt sich für Trendprognosen nutzen.
Dazu sind die Jahreszahlen des aktuellen Sonnenzyklus, beginnend mit 2014, am unteren Rand eingefügt.
Für 2020 sind erneut niedrige, eventuell sogar sehr niedrige Niederschlagssummen wahrscheinlicher als durchschnittliche oder sogar überdurchschnittliche Regensummen.
In 11 von 12 Zyklen sinkt die Niederschlagssumme von Jahr 6 zu Jahr 7, s. Abbildung 1.
Der aktuelle Sonnenzyklus mit dem zu Beginn sehr schwachem Impuls verläuft nicht normal.
So ist der in anderen Zyklen regelmäßig auftretende Windrichtungswechsel in der QBO (s.u.) von Jahr 1 zum Jahr 2 ausgeblieben.
Wikipedia
de Quasi-zweijährige SchwingungDie quasi-zweijährige Schwingung (kurz: QBO vom englischen "quasi-biennial oscillation"), auch quasi-biennale Oszillation, ist eine quasi-periodische atmosphärische Welle des zonalen Windes in der äquatorialen Stratosphäre der Erde.
Wenn sich 2020 entsprechend den Kurvenverläufen in Abbildung 1 zu einem historischen Dürrejahr entwickelt,
könnte das allein durch den aktuellen Verlauf der Sonnenaktivität verursacht worden sein.
Für Deutschland lässt sich in Zukunft ein Trend für die Niederschlagssumme Juni und Juli für ca. 10 Jahre im Voraus aufstellen, sobald der Zeitpunkt und die Qualität des Sonnenfleckenmaximums bzw. des Sonnenimpulses bekannt sind.
In wieweit das auch in Zyklen mit zu Beginn sehr niedriger Fleckenzahl und schwachem Impuls möglich sein wird, müssen weitere Untersuchungen zeigen.
...
Abbildung 3: Wettertrend im Juni/Juli in verschiedenen Regionen Deutschlands und den Niederlanden

 Abbildung 3: 11-jähriger Sonnenfleckenzyklus und
Wettertrend im Juni/Juli in verschiedenen Regionen Deutschlands
und den Niederlanden
Abbildung 3: 11-jähriger Sonnenfleckenzyklus und
Wettertrend im Juni/Juli in verschiedenen Regionen Deutschlands
und den Niederlanden

In allen Bundesländern ähnliches Sonnensignal
Zur Berechnung des Sonnensignals in unterschiedlichen Regionen Deutschlands sind die Datensätze aus 12 Bundesländern verwendet, die Niederschlagssummen in Relativwerte umgewandelt worden.
Die Werte eigenständiger Städte sind in umgebenden Bundesländern integriert.
Zur besseren Übersichtlichkeit sind die Bundesländer mit ähnlichem Kurvenverlauf in Gruppen zusammengefasst, s. Abbildung 3.
Zu den Ergebnissen der Bundesländer ist der Niederschlagstrend der Niederlande hinzugefügt, um zu zeigen, dass sich das in Nordwest-Deutschland besonders starke Sonnensignal auf dem Gebiet der Niederlande fortpflanzt.
Der Kurvenverlauf von Schleswig-Holstein und Baden-Württemberg wechselt mehr oder weniger gleichförmig von Jahr zu Jahr zwischen niedriger und hoher Niederschlagssumme, auch in den Zyklusjahren 9 bis 11.
Die Kurven der drei anderen Regionen bleiben ab dem Zyklusjahr 8 auf hohem Niveau.
Die Ausschläge zwischen den Extremen sind im Nord-West-Deutschland mit maximal 40 Prozent (Jahr 5 zu Jahr 6) am größten.
In den benachbarten Niederlanden steigt der Betrag sogar auf beachtliche 45 Prozent.
Ähnlich hoch sind die Ausschläge in Belgien und Luxemburg.
Auch mit Hilfe dieser Abbildung können Juni/Juli-Niederschlagsprognosen für die verschiedenen Regionen erstellt werden.
Das aktuelle Jahr 2020 entspricht dem Zyklusjahr 7, einem Jahr mit deutlichem Trend zu unterdurchschnittlicher Sommer-Niederschlagssumme.
2021, dem Zyklusjahr 8, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit für erstmalig wieder überdurchschnittlich viel Regen im Hochsommer.
...
Abbildung 4: Niederschlagssumme verschiedener Zeiträume

 Abbildung 4: 11-jähriger Sonnenfleckenzyklus und
Niederschlagssumme verschiedener Zeiträume
Abbildung 4: 11-jähriger Sonnenfleckenzyklus und
Niederschlagssumme verschiedener Zeiträume
 -
-
...
Mit Abbildung 4 wird die Struktur des Sonnensignals sowohl hinsichtlich des Auftretens in einzelnen Zyklusjahren als auch im Verlauf des Jahres sichtbar.
Das Sonnensignal ist im Juni/Juli wesentlich stärker ausgeprägt als im Zeitraum Mai bis August und dem Gesamtjahr.
Das Signal ist auf die Monate Juni und Juli begrenzt.
Bei der hier nicht dargestellten Betrachtung der Einzelmonate ist das Sonnensignal im Juni stärker ausgeprägt als im Juli.
Schon im vorgelagerten Mai als auch im nachgelagerten August ist es kaum noch erkennbar.
Die jährlichen Ausschläge steigern sich vom Jahr des Sonnenfleckenmaximums bis zur Phase des Fleckenminimums mit den Zyklusjahren 5, 6 und 7.
Ab dem Zyklusjahr 8 verschwindet das Sonnensignal, die Niederschlagssummen bleiben bis zum nächsten Sonnenfleckenmaximum meist auf überdurchschnittlichem Niveau.
Prognosen haben in den Zyklusjahren 3 bis 8 und Monaten Juni/Juli eine hohe Eintrittswahrscheinlichkeit.
Das für Deutschland typische Sonnensignal in der Juni/Juli-Niederschlagssumme erstreckt sich in Europa auf die eher westlich gelegenen Länder von Dänemark über Großbritannien/Irland, Benelux-Länder, Alpenrepubliken, Frankreich und die Iberische Halbinsel.
In den unmittelbar östlich Nachbarschaft ist das Sonnensignal nur etwa halb so stark.
Das Signal ist kaum vorhanden in einem großen Bogen um Deutschland herum von Island über Norwegen, Finnland, Weißrussland, Bulgarien, Rumänien sowie dem zentralen und östlichen Mittelmeerraum.
Übertragungsweg für das Sonnensignal des Schwabezyklus auf unser Wetter
Die hohe Qualität des Sonnensignals in den Juni/Juli-Niederschlagssummen in Abbildung 1 setzt voraus, dass der Impuls der Sonne im Jahr des Fleckenmaximums durch ein festes Zusammenspiel von Planetenstellung, Sonnenaktivität, Vorgängen in der Mesosphäre (50 bis 80 km Höhe), Stratosphäre (12 bis 50 km Höhe) und Troposphäre (bis 12 km Höhe) übertragen wird.
Zu diesem Übertragungsweg gibt es weltweit viele neue Publikationen.
Auch deutsche Forschungseinrichtungen wie das Max-Planck-Institut für Meteorologie in Hamburg [1] oder GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel [2] sind an der Forschung beteiligt.
[1] Geophysical Research Letters
2019-11-20 en Realistic Quasi-Biennial Oscillation Variability in Historical and Decadal Hindcast Simulations Using CMIP6 Forcing[2] Atmospheric Chemistry and Physics
2019-11-20 en Quantifying uncertainties of climate signals related to the 11-year solar cycle.
Part I: Annual mean response in heating rates,temperature and ozoneAus dem Studium der Literatur kann abgeleitet werden, dass die Übertragung des Sonnensignals wahrscheinlich über fünf Ebenen erfolgt:
-
Ebene 1 (vorgeschaltet)
Laufbahn der Planeten im Sonnensystem, die je nach ihrer Stellung das Schwerefeld der Sonne verändern
und damit die Sonnenfleckenaktivität im 11-Jahresrythmus und die Variabilität der UV-Strahlung steuert.
-
Ebene 2
Sonne mit Sonnenflecken, "Sonnenwind" und UV-Strahlung, die das Ozon in der Mesosphäre (50 bis 80 km Höhe) und Stratosphäre (12 bis 50 km Höhe) chemisch-physikalisch beeinflusst.
Die UV-Strahlung variiert während des Sonnenzyklus um ca. 10 Prozent.
-
Ebene 3
Mesophäre und Stratosphäre mit der Ozonchemie und -physik:
je stärker die UV-Strahlung, umso mehr Ozon, umso höher die Temperatur.
Die Ozondynamik wird von der UV-Strahlung gesteuert.
Dadurch verändern sich während des Sonnenzyklus die Temperaturgradienten zwischen Äquator und Polen sowie zwischen verschiedenen Höhen der Atmosphäre.
-
Ebene 4
Quasi-Biennale Oszillation (QBO), die von den Temperaturgradienten in 12 bis 80/nbsp;km Höhe beeinflusst wird.
In der QBO, eine Windzone in 20 bis 40 km Höhe über dem Äquator, wechselt die Windrichtung von Jahr zu Jahr mehr oder weniger regelmäßig von West nach Ost und umgekehrt.
Der Sonnenimpuls wird auf die QBO übertragen, indem die Windrichtung in der QBO im Jahr des Fleckenmaximums in jedem Zyklus von Mai bis Dezember auf Ost dreht.
Der jährliche Windrichtungswechsel (in 20 bis 25 km Höhe) bleibt in den Folgejahren nach eigenen Berechnungen für mehrere Jahre exakt im 12‑Monatsrythmus erhalten, bevor sich der Rhythmus im Verlauf eines jeden Zyklus auf mehr als 12 Monate verlängert.
-
Ebene 5
Zirkulationssystem der Troposphäre mit den wetterbildenden Hoch- und Tiefdruckgebieten, das von der QBO beeinflusst wird.
Der fast jährliche Windrichtungswechsel in der QBO dürfte für das Zick-Zack-Muster in den Niederschlagskurven in den obigen Abbildungen verantwortlich sein.
Fazit
Es gibt unzweifelhaft einen starken Einfluss der Variabilität der Sonne im Rahmen des 11-jährigen Sonnenfleckenzyklus auf unser Wetter,
der wesentlich größer ist als bisher vermutet.
Der Einfluss konzentriert sich auf die Sommermonate Juni und Juli, den Zeitraum höchster Sonneneinstrahlung.
Er zeigt sich in den Niederschlagssumme stärker als in der Sonnenscheindauer oder Temperatur.
Die Niederschlagssumme Juni/Juli reagiert in jedem einzelnen Jahr des Sonnenzyklus unterschiedlich auf die Variabilität der Sonnenstrahlung.
Während der Phase des Sonnenfleckenminimums, in der wir uns zurzeit befinden, betragen die solar verursachten jährlichen Schwankungen der Niederschlagsumme im Juni/Juli 30 bis über 40 Prozent.
Diese Schwankungen haben sich mit hoher Zuverlässigkeit in fast allen 13 Zyklen seit 1883 wiederholt.
Auf Basis dieser Zuverlässigkeit lassen sich für Deutschland Prognosen erstellen.
Prognose für Juni/Juli 2020: Die Niederschlagssumme erreicht nur ca. 80 Prozent des langjährigen Mittels, mit dem Trend zu noch niedrigerem Wert.
Prognose für Juni/Juli 2021: Die Niederschlagssumme erreicht ca. 110 Prozent des langjährigen Mittels.
Diese experimentellen Prognosen sind selbstverständlich ohne Gewähr.
Ziel der Übung ist es, mittelfristige Klimavorhersagen zu entwickeln bzw. zu überprüfen, ob dies möglich ist.
-
|
|
Kommt ein Dürresommer? Sonnenzyklen: Webseiten / Solar cycles / Cycles solaires Wetterphänomene: Niederschläge Wetterphänomene: Sonnenscheindauer |
⇧ 2019
↑ Die "Wissenschaft" des Professors Rahmstorf
-
Aufruhrgebiet
Hanns Graaf
2019-03-25 de Die "Wissenschaft" des Professors RahmstorfEs geht um die Frage der CO₂-Emissionen Deutschlands.
Dazu führt Rahmstorf aus: "Die Frage ist doch: wie viel Erwärmung würden wir verursachen, wenn wir so weiter machen und jedes Jahr wieder 0,8 Milliarden Tonnen CO₂ in die Atmosphäre blasen?
Das CO₂ sammelt sich dort an wie Wasser in einer Badewanne.
Wenn wir also zehn Jahre weiter dieselbe Menge emittieren, dann verursachen wir auch das Zehnfache an Erwärmung, und wenn wir das bis 2100 tun, verursachen wir das 80-fache Ihrer Zahl.
Also 0,05 °C Erwärmung." [wirklich ?!?]
Siehe Kommentar von Prof. Stefan Rahmstorf zu den Antworten der AfD auf die Fragen der der KlimaLounge
2019-03-20 de Herr Hilse von der AfD beantwortet die Fragen der KlimaLoungeFacebook-Seite von AfD Bundestagsabgeordneten Karsten Hilse
2019-03-18 de Herr Rahmstorf kann die im Quiz angegeben Fakten nicht widerlegen!Bezug auf:
Bundestag-Drucksache 19/2998
2018-06-27 de Antrag der Abgeordneten Karsten Hilse, Dr. Heiko Wildberg, Dr. Rainer Kraft, Udo Theodor Hemmelgarn, Marc Bernhard und der Fraktion der AfDAuch bei völliger Emissionsabsenkung auf Null,
also völliger "Dekarbonisierung" und in jedem denkbaren Fall,
selbst unter Verwendung des um den Faktor 3 erhöhten vom "Weltklimarat" Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) verwendeten ECS (Equilibrium Climate Sensitivity)-Wertes
vermindert sich die zukünftige Welttemperatur nur um ein von Null messtechnisch nicht zu unterscheidendes Δ T von max. 0,000653 °C.
Weitere Analysen und Berechnungen:
►Nur 0,00004712 Prozent CO2 aus Deutschland
►Prof. Dr. Horst-Joachim Lüdecke, Dr. Rainer Link: Der Treibhauseffekt
0,001 Grad von Deutschland eingesparte globale Erwärmung [in 15 Jahren] bis 2020.▶CO₂-Senken & CO₂‑Verweildauer
...
Nehmen wir an, wir würden bis 2100 den CO₂-Gehalt von heute 400 auf 800 ppm erhöhen.
Dann hätten wir bei dieser Verdoppelung der Rate eine bestimmte Erwärmung.
Die Höhe des Betrags der "Klimasensitivität" ist ebenfalls umstritten - in der Klimawissenschaft insgesamt wie auch in beiden Lagern.
Das IPPC hat diese Rate seinen Berichten wiederholt korrigiert und nennt aktuell den Wert von 3 Grad.
Ein Blick in die neuere Fachliteratur zeigt, dass die Werte für die "Klimasensitivität" meist deutlich niedriger angegeben werden als beim IPCC.
Einige Beispiele:
Das internationale Modtran-Programm der Atmosphärenphysik zeigt zwischen 400 und 800 ppm einen Temperaturanstieg von nur 1,7°C mit Berücksichtigung der Sättigung.
Das ergibt in 100 Jahren einen Anstieg um ca. 0,85°C.
Die folgende Grafik zeigt sehr gut, dass es ein lineare Beziehung CO₂-Erwärmung, wie Rahmstorf behauptet, nicht gibt.
-
2013 erschien ein Papier von Otto et al., das 2,0 °C angab.
-
2015 verwies Feldhaus darauf, dass die aktuellen Messungen des Strahlungsantriebs bzw. der Strahlungsflüsse von Satelliten (ERBE 1985 und 1999) und CERES (2000-15) und der Bodentemperatur einen Rückkopplungsparameter von 6 W/Quadratmeter zeigen.
Daraus ergibt sich bei einer CO₂-Verdopplung ein Temperaturanstieg von nur 0,7 °C.
-
2017 räumten Millar et al. ein, dass die IPCC-Klimamodelle zu viel Erwärmung angeben, und
das 1,5-Grad-Ziel auch mit den dreifachen CO₂-Emissionen erreichbar sei.
Selbst bei einem ungebrochenen Trend der Erhöhung des CO₂-Anteils in der Atmosphäre ist also eine bedrohliche Erwärmung nicht möglich oder zumindest sehr unwahrscheinlich.
Gravierende Maßnahmen zur wären also überflüssig - nicht zuletzt im Hinblick auf andere, wirklich dramatische Probleme, etwa dass über 2 Milliarden Menschen keinen Zugang zu sauberem Wasser haben.
Sollten die Milliarden nicht eher dafür ausgegeben werden?!
de en fr Klimawandel: Wissenschaft
Der CO2-TreibhauseffektClimate change: Science
The CO2 Greenhouse EffectChangement climatique: Science
L'éffet de serre du CO2Einleitung Introduction Introduction Die Klimasensitivität von CO₂ Climate sensitivity of CO₂ La sensibilité climatique du CO₂ Die CO₂-Sättigung:
Wenn die CO₂-Konzentration zunimmt, ist die Erwärmung wegen der Sättigung kleinerThe CO₂ Saturation:
As Carbon Dioxide increases it has less Warming EffectLa saturation du CO₂:
Lorsque la concentration du CO₂ augmente, son effet de réchauffement diminueDer Streit um die Rückkopplungen The argument about the feedbacks L'argument des rétroactions Der fehlende Hotspot (warme Zone) The missing Hotspot Le 'hotspot' (point chaud) manque ERBE Earth Radiation Budget Experiment ERBE Earth Radiation Budget Experiment ERBE Earth Radiation Budget Experiment Lt. IPCC gebe es eine positive Wolkenrückkopplung zum CO₂-Effekt, was diesen um das 3-4 fache verstärken würde.
Nun ist dieser Effekt aber nicht nachgewiesen oder beobachtet und bleibt daher eine reine Behauptung.
Zudem ändert auch dieser Effekt nichts an der nicht-linearen Wirkung von CO₂.
Was ist das Fazit aus der Betrachtung der Argumentation von Rahmstorf?
Er missachtet wesentliche Fragen, die für die (behauptete) Wirkung von CO₂ von grundlegender Bedeutung sind.
Dieses Vorgehen ist so unwissenschaftlich wie notwendig, um den Klimakatastrophismus zu stützen, ja überhaupt zu ermöglichen.
Da wir nicht annehmen, dass es Rahmstorf an Wissen und geistigen Fähigkeiten mangelt, bleibt nur ein Schluss übrig: er ist ein Demagoge, der die Wissenschaft im Dienste von Ideologen und Klima-Abkassierern in ein Prokrustesbett zwängt.
Stefan Rahmstorf Professor, Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung
▶Stefan Rahmstorf: Who is who (Aktivisten der anthropogenen Erwärmung) -
↑ Sachgebiete
⇧ de Verzeichnis en Contents fr Sommaire
- A de
Klimawandel in Deutschland
- Die Fakten / Temperaturen in Deutschland
en Climate Change in Germany
fr Changement climatique en Allemagne - B de
Klimawandel in Österreich
- Die Fakten / Temperaturen in Österreich
en Climate Change in Austria
fr Changement climatique en Autriche
⇧ de Text en Text fr Texte
↑ Klimawandel in Deutschland - Die Fakten / Temperaturen in Deutschland
Mit folgendem Link wird von anderen Webseiten auf diese Seite verwiesen.
▶Deutschland: Klimawandel in Deutschland │ ▶Wetterphänomene/Temperaturen: Klimawandel in Deutschland
Links zur Klimaschau
|
|
▶Klima heute ▶Klima-Auswirkungen / Wetterphänomene: Temperaturen ▶Temperatur und Wärmeinhalt der Ozeane ▶WMO World Meteorological Organization ▶UK Met Office ▶Deutschland: Klimawandel in Deutschland │ ▶Wetterphänomene/Temperaturen: Klimawandel in Deutschland |
↑ Video
-
Die kalte Sonne (Fritz Vahrenholt & Sebastian Lüning)
2020-04-25 de Klimawandel in Deutschland: Neues Video informiert über bisherige Temperaturentwicklung
-
Klimawandel Crashkurs / Dr. Sebastian Lüning
2020-04-25 de Klimawandel in Deutschland: Temperaturen
Klimawandel in Deutschland: Temperaturen
Der Klimawandel geht uns alle an.
Dieses kurze Video erläutert, wie sich die Temperaturen in Deutschland während der vergangenen 30 und 150 Jahren bereits verändert haben.
Zudem wird die Erwärmung in den klimahistorischen Kontext der vergangenen Jahrtausende gestellt.
Das Video richtet sich an alle Schüler, Lehrer und andere interessierte Erwachsene, die sich mit den Basisfakten der Klimadiskussion vertraut machen möchten.
Sämtliche Daten- und Literatur-Quellen sind auf http://www.klimawandel-in-deutschland... für eine vertiefende Beschäftigung mit der Materie nachschlagbar.
Die Fakten
-
Dr. habil. Sebastian Lüning
de Klimawandel in Deutschland - Die FaktenTemperaturen

 Jahresdurchschnittstemperaturen in Deutschland während der
vergangenen 30 Jahre (1988-2017)
Jahresdurchschnittstemperaturen in Deutschland während der
vergangenen 30 Jahre (1988-2017)
[Bemerkung zum Überlegen: Die Temperaturen schwanken bis zu 3 Grad pro Jahr.
0,5 Grad in 30 Jahren ≙ 0,17 Grad in 10 Jahren ≙ 0,017 Grad pro Jahr
Bei gleichbleibender Erwärmung würde theoretisch die Temperatur in 80 Jahren bis 2100 um 1.33 Grad steigen (wahnsinnig?!?)]

↑ Monats-Temperaturen in Deutschland
↑ Januar
![]()
![]() Klimawandel: So haben sich die Januar-Temperaturen in Deutschland
während der letzten 32 Jahren verändert
Klimawandel: So haben sich die Januar-Temperaturen in Deutschland
während der letzten 32 Jahren verändert

↑ Februar
-
Die kalte Sonne (Fritz Vahrenholt & Sebastian Lüning)
2018-03-18 de Was ist da los? Der Februar wird in Deutschland immer kälterDie Kältewelle in Mitteleuropa ist vorbei.
Wie ordnen sich die deutschen Temperaturen des Februar 2018 in den langjährigen Kontext ein?
Josef Kowatsch hat die Graphik für uns gezeichnet:
Der Februar wird immer kälter, wenn man die letzten knapp 20 Jahre anschaut.
Die Temperaturen zappeln zwar ziemlich auf und ab, aber der Trend zeigt eindeutig nach unten.
Zuletzt war es in Deutschland im Jahr 2012 so kalt, im Jahr als unser Buch auf den Markt kam.
Nun könnte jemand kommen und sagen, naja, bitte die letzten 30 Jahre zeigen.
Denn das ist doch der Maßstab für die Definition "Klima".
Bitteschön, auch diese Graphik wollen wir Ihnen nicht vorenthalten:

 Wieder dasselbe Bild:
Wieder dasselbe Bild:
Der Februar wird immer kälter.
In welcher Zeitung haben Sie diese Schlagzeile zuletzt gelesen?
Antwort: In keiner! Diese Nachricht möchte man den Bürgern Deutschlands offenbar nicht zumuten.
Wieder dasselbe Bild:
Der Februar wird immer kälter.
In welcher Zeitung haben Sie diese Schlagzeile zuletzt gelesen?
Antwort: In keiner! Diese Nachricht möchte man den Bürgern Deutschlands offenbar nicht zumuten.
-
EIKE Europäisches Institut für Klima und Energie
Stefan Kämpfe, Josef Kowatsch
2018-03-02 de Die Februar-Abkühlung in Deutschland - nicht erst seit 2018Der Februar ist der letzte der drei Wintermonate und zugleich der Übergang zum Vorfrühling.
Davon war 2018 nichts zu spüren.
Überall in Deutschland war es der kälteste Wintermonat, in Nordostdeutschland noch einen Tick winterlicher.
Der Deutsche Wetterdienst gibt ihn nach der ersten Auszählung seiner 2000 Wetterstationen mit einem Schnitt von - 1,7 C an, was 2,1 C unter dem (bereits kühlen) Vergleichsschnitt 1961 bis 90 liegt.

 Seit 1787, also seit Mozarts Zeiten haben sich die Februartemperaturen
auf dem Hohenpeißenberg kaum verändert.
Seit 1787, also seit Mozarts Zeiten haben sich die Februartemperaturen
auf dem Hohenpeißenberg kaum verändert.
Das Startjahr der Betrachtung lag auf dem Höhepunkt einer Warmphase, wie die letzten 30 Jahre, also das rechte Ende der Grafik.
Der wärmste Februar war 1990.
Der diesjährige liegt deutlich unter dem Schnitt und deutet die weitere Abkühlung innerhalb der letzten 30 Jahre an.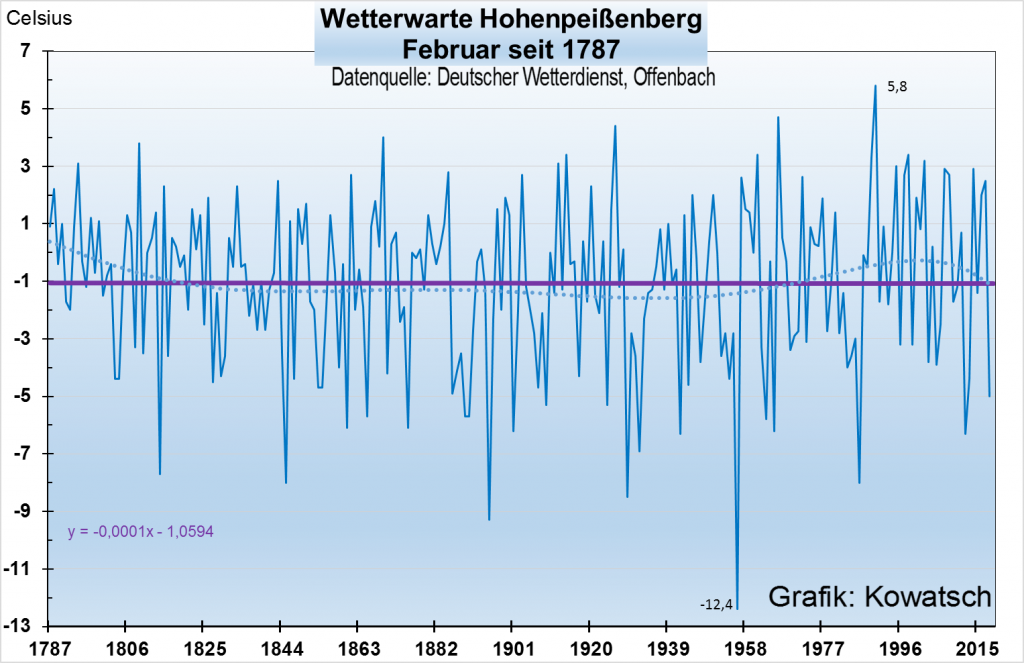
↑ März
![]()
![]()
![]() März‑Temperaturen während der
letzten 33 Jahre
März‑Temperaturen während der
letzten 33 Jahre
Der Wert für 2020 ist da - und die Überraschung ist groß.
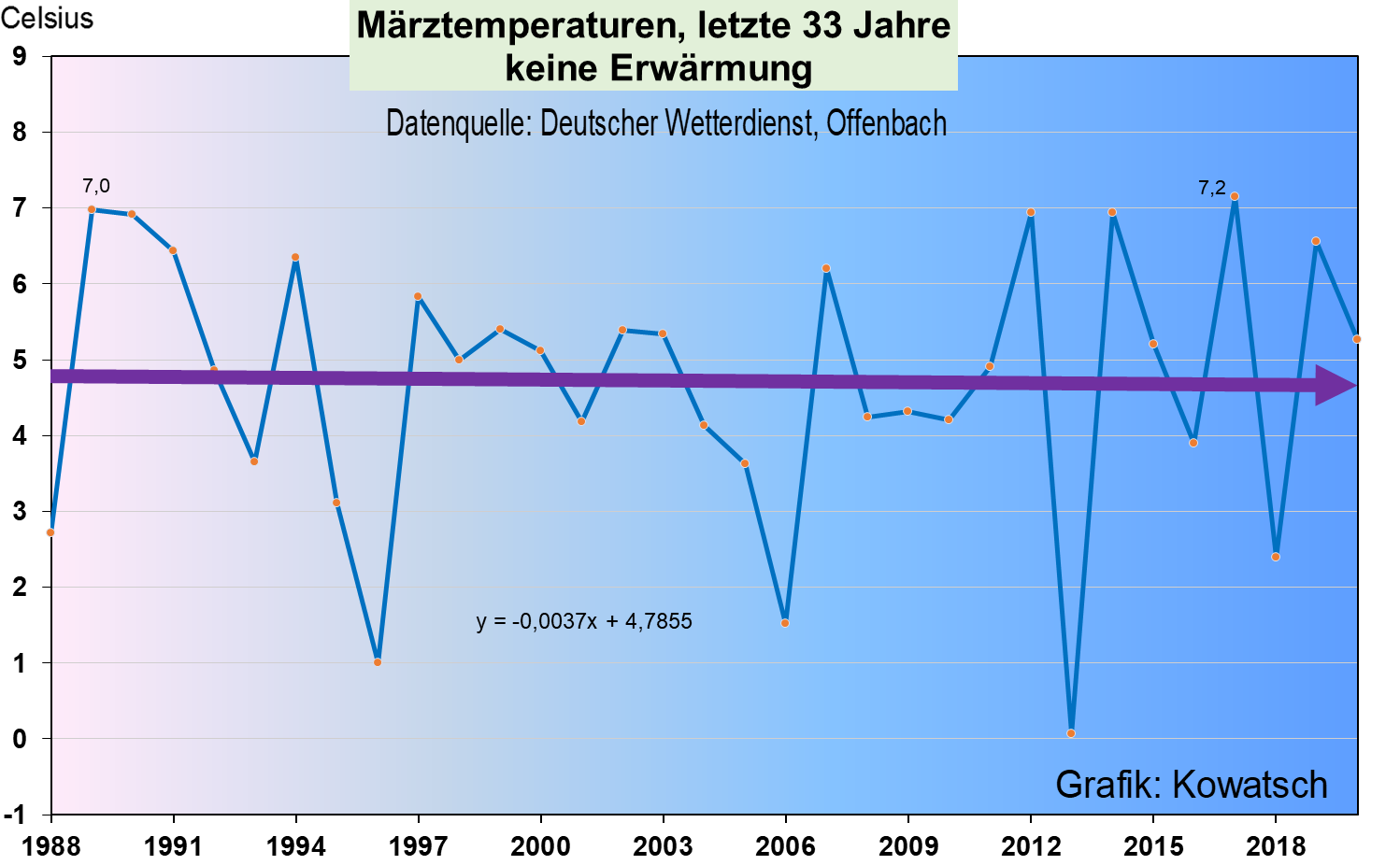
↑ April 2020
-
EIKE Europäisches Institut für Klima und Energie
Josef Kowatsch
2020-05-12 de Der April wurde durch einen Temperatursprung im Jahre 2007 wärmer.Unter Temperatursprünge versteht der Artikel nicht das jährliche Auf und Ab, sondern einen Sprung innerhalb ein oder zwei Jahre auf ein anderes Temperatur-Niveau, das anschließend viele Jahre gehalten wird.

 April in Deutschland seit 1943 (bis und mit 2020)
April in Deutschland seit 1943 (bis und mit 2020)


 Der Apriltemperatursprung im Jahre 2007
bei den Deutschlandtemperaturen
Der Apriltemperatursprung im Jahre 2007
bei den Deutschlandtemperaturen
Die Durchschnittstemperaturen der Zeitabschnitte betragen 7,8 °C und 9,5 °C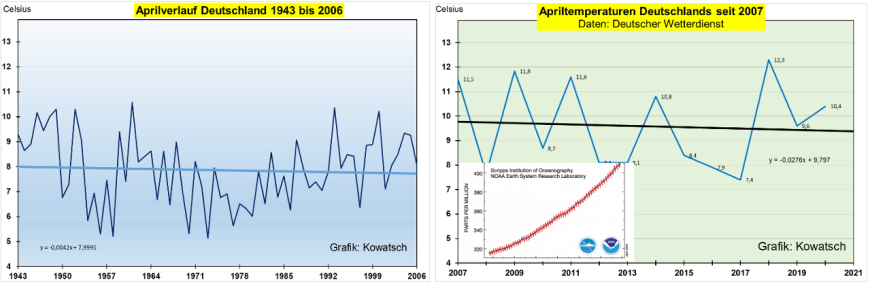
Feststellungen
Die Durchschnittstemperaturen der Zeitabschnitte betragen 7,8 °C und 9,5 °C
Es gibt keinerlei Übereinstimmung zwischen dem Anstieg der CO₂-Konzentationen und dem Apriltemperaturverlauf in Deutschland.
Der Begriff Treibhausgas ist eine unsinnige Worterfindung.
Zusammenfassung
-
Der Monat April wurde in Deutschland deutlich wärmer.
Die Erwärmung erfolgte jedoch nicht kontinuierlich, sondern hauptsächlich durch einen Temperatursprung im Jahre 2006 auf 2007.
Seitdem liegt das Temperaturniveau um fast 2 Grad bei den DWD-Durchschnittstemperaturen höher.
-
Seit 14 Jahren ist vor allem die 2. Aprilhälfte zu einem angenehmen vorgezogenen Maimonat geworden, was sich auch auf die Verfrühung der April- und der Anfang-Mai-Frühlingsvegetation ausgewirkt hat.
Eine Freude für alle Naturbeobachter.
Der Wonnemonat Mai beginnt nun 14 Tage früher.
-
Der Temperatursprung des Aprils ist natürlichen Ursprungs und vor allem bedingt durch die Zunahme der Sonnenstunden und die Abnahme des kalten NW-Niederschlages.
-
Mit einer CO₂-Treibhauserwärmung hat der Temperatursprung nichts zu tun.
Alle Grafiken des Artikels zeigen: CO₂ hat keinen Einfluss auf das Temperaturverhalten.
-
Es wird Zeit, dass endlich Natur- und Umweltschutz in den Mittelpunkt einer all umfassenden Politik gestellt werden.
Der Erhalt einer sauberen Luft, sauberes Wasser und intakte Naturlandschaften sollten das gemeinsame Ziel sein.
-
↑ Mai 2020
t-
EIKE Europäisches Institut für Klima und Energie
Josef Kowatsch
2020-06-02 de Der Mai will nicht wärmer werden. Wo bleibt die CO₂-Treibhauswirkung?Den Mai 2020 gibt der Deutsche Wetterdienst mit 11,9 °C an.
Er liegt damit unter dem Mittelwert seit 1888.

 Keine Maierwärmung seit 1888.
Keine Maierwärmung seit 1888.
Der rote Temperaturkurvenverlauf zeigt das übliche Auf und Ab mit leicht wärmeren und kälteren Phasen.
Unten rechts die ins Diagramm eingeblendete CO₂-Konzentrationsgrafik vom Mouna Loa, die allerdings bereits 2019 endet.
Derzeit soll die Konzentration bei 417 ppm sein.
↑ Juli 2020
-
EIKE Europäisches Institut für Klima und Energie
Josef Kowatsch
2020-08-09 de Die Julierwärmung der letzten 100 Jahre - hat das was mit der CO₂-Zunahme zu tun?Der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit seinen etwa 1900 Wetterstationen über Deutschland verteilt, ermittelte für den Juli 2020 einen Monatsschnitt von 17,7 °C, die Presseveröffentlichung trug die Überschrift: "Ein warmer, erheblich zu trockener und sonnenscheinreicher Juli".
Für die letzten 100 Jahre ergibt sich folgende Temperaturgrafik:

 Schon auf den ersten Blick auf die Jahrestemperaturen einzelner
Jahre ist erkennbar, dass der Eindruck einer kontinuierlichen Erwärmung
nicht stimmen kann.
Schon auf den ersten Blick auf die Jahrestemperaturen einzelner
Jahre ist erkennbar, dass der Eindruck einer kontinuierlichen Erwärmung
nicht stimmen kann.


 Der Zeitraum 1921 bis 2004: Der Juli zeigt keine Erwärmung.
Der Zeitraum 1921 bis 2004: Der Juli zeigt keine Erwärmung.


 Der Monat Juli ab dem Jahre 2005 bis 2020
Der Monat Juli ab dem Jahre 2005 bis 2020
Ergebnis: Der Monat Juli ist durch einen Temperatursprung im Jahre 2005 wärmer geworden.
Auf diesem höheren Plateau halten sich die Temperaturen laut DWD Wetterstationen bis heute.
Der Juli wurde vor 16 Jahren zu einem angenehmen Hochsommermonat.
Wie lange wird sich der Monat wohl auf diesem Niveau halten?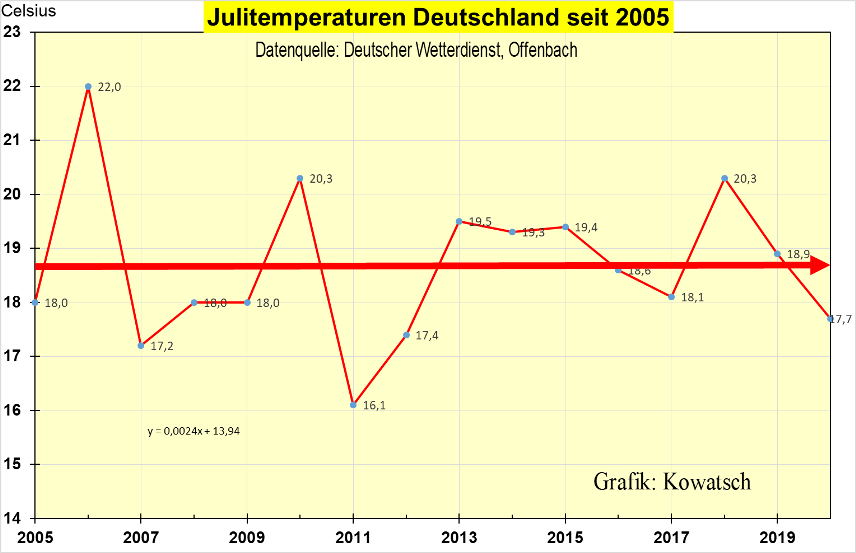

 Gibt uns Kohlendioxid die Antwort?
Gibt uns Kohlendioxid die Antwort?
Die CO₂ Konzentration ist seit 1958 überall auf der Welt von 315 ppm auf nunmehr fast 420 ppm angestiegen.
Und man staune: Trotz Corona ist auch im Jahre 2020 die CO₂-Konzentration im gleichen Maße weiter gewachsen.
Kein Stillstand.
Dies zeigt, dass die wegen der Pandemie weltweit unfreiwilligen Maßnahmen einer anthropogenen CO₂-Reduktion keinen Einfluss auf die Anstiegskurve hatten.
Und die Zunahme korreliert auch nicht mit den DWD-Julitemperaturen.
↑ Klimawandel in Österreich - Die Fakten / Temperaturen in Österreich
Mit folgendem Link wird von anderen Webseiten auf diese Seite verwiesen.
▶Österreich: Klimapolitik │ ▶Wetterphänomene/Temperaturen: Temperaturen in Österreich
-
Dr. habil. Sebastian Lüning
de Klimawandel in Österreich - Die FaktenTemperaturen
Letzte 30 Jahre
Die Jahresdurchschnittstemperaturen haben sich in Österreich während der vergangenen 30 Jahre um mehr als ein halbes Grad erhöht
Allerdings schwankten die Temperaturen von Jahr zu Jahr um bis zu 2 Grad.

 Entwicklung der Jahresdurchschnittstemperaturen in Österreich während der vergangenen 30 Jahre (1988-2017).
Entwicklung der Jahresdurchschnittstemperaturen in Österreich während der vergangenen 30 Jahre (1988-2017).
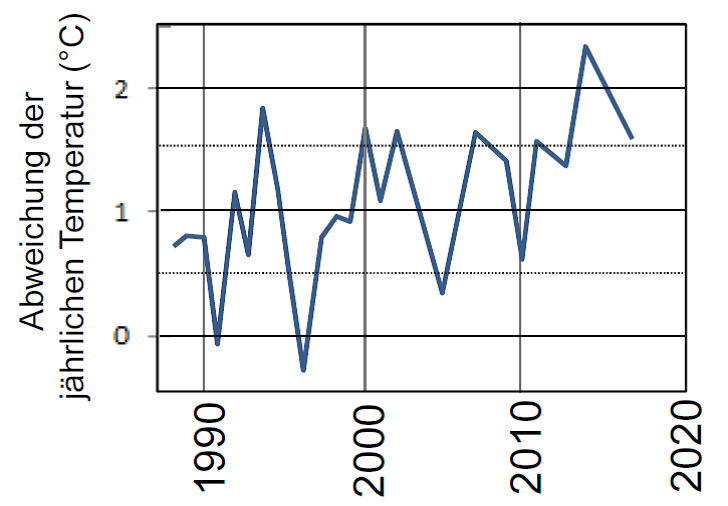
Interessanterweise läuft die Erwärmung nicht in allen Jahreszeiten und Monaten gleichmäßig ab.
So ist die Temperatur in den Monaten Februar und Oktober während der vergangenen 30 Jahre in Österreich nicht angestiegen und blieb stabil
Februar
![]()
![]() Entwicklung der Februartemperaturen in Österreich während der
vergangenen 30 Jahre (1990-2019).
Entwicklung der Februartemperaturen in Österreich während der
vergangenen 30 Jahre (1990-2019).
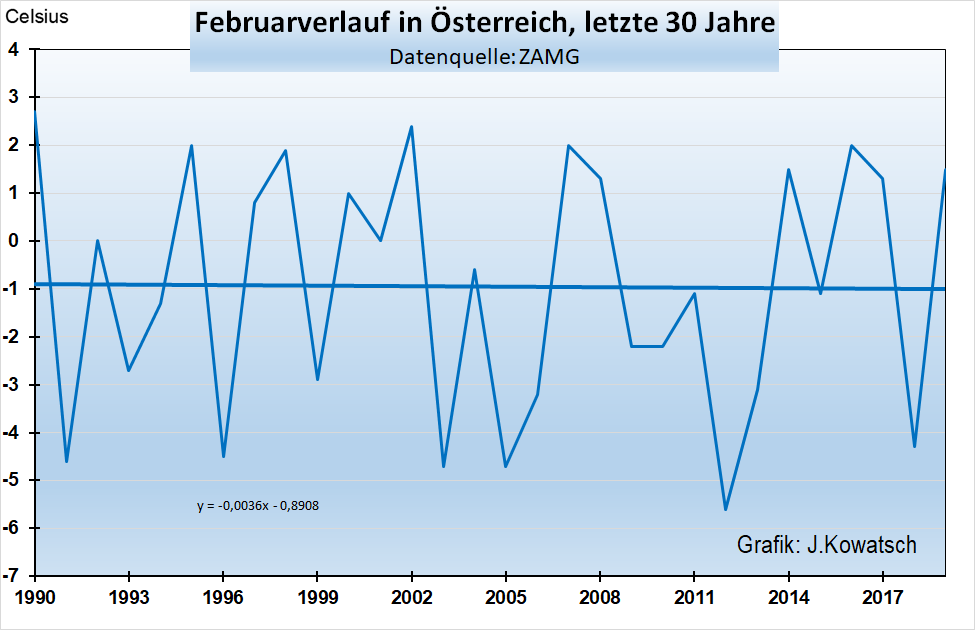
⇧
3 Extremwetter
en Extreme Weather Events
fr Intempéries extrèmes
Mit folgenden Links wird von anderen Webseiten auf diese Seite verwiesen:
▶Extremwetter| de | en | fr |
|---|---|---|
|
Wetterphänomene Extremwetter |
Weather phenomena Extreme Weather Events |
Phénomènes météorologiques Intempéries extrèmes |
⇧ de Verzeichnis en Contents fr Sommaire
|
⇧ Welt-Info
|
|
Extremwetter / Extreme Weather / Intempéries extrèmes | ||
| ▷Die Kalte Sonne Blog‑Themen Vahrenholt/Lüning ▶Die kalte Sonne |
de
▷Extreme Wetterphänomene
▷Solare Millenniumszyklen ▷Hitzewellen ▷Kältewellen ▷Überschwemmungen (Flüsse) ▷Stürme ▷Artikel: Extremwetter |
||
| Science Skeptical Blog | en Schnee und Eis | ||
| ►Der Wasserplanet (Ernst-Georg Beck) |
de
▷Was ist Wärme?
(Wayback‑Archiv)
▷Atmosphäre und Wetterentstehung (Wayback ohne Bilder) ▷Wetterentstehung und Klima (Wayback ohne Bilder) |
||
| WUWT | en "Extreme Weather" Page | ||
| NoTricksZone | en Weather en Cooling | ||
| Wikipedia |
|
||
| Vademecum |
▶Extremwetter
▶Welt-Info |
||
| Siehe auch: | ▶Wetterphänomene |
⇧ de Allgemein en General fr Générale
![]()
![]() Was finden die Wetterdienste?
Was schreibt der Klimarat IPCC?
Was finden die Wetterdienste?
Was schreibt der Klimarat IPCC?

⇧ de Text en Text fr Texte
⇧ 2022
↑ Extremwetter: In Kälte-, nicht in Wärmeperioden
-
Die Schweizerzeit / Ueli Gubler
2022-05-20 de Die Schweizerzeit: In Kälte-, nicht in Wärmeperioden* (Zahlschranke/Paywall)Die extremen Wetterereignisse der letzten 1'000 Jahre fanden alle während der Abkühlung zwischen 1350-1450 statt.
Sie widerlegen, dass sie bei zunehmender Wärme auch zunehmen werden.
Kein Zusammenhang zwischen dem CO₂-Gehalt und der Erdtemperatur
Während den 12'000 Jahren seit der letzten Eiszeit ist kein Zusammenhang zwischen dem CO₂-Gehalt und der Erdtemperatur festzustellen.
Der CO₂-Gehalt war während allen Klimaschwankungen konstant bei 280 ppm (parts per million bzw. Millionstel).
Es fällt auf, dass in letzter Zeit die Klimaerwärmung medial etwas in den Hintergrund gerückt ist.
An ihrer Stelle werden nun «Extremwetter» gross aufgemacht.
Der deutsche Klimaforscher Hans von Storch räumte im Magazin «Der Spiegel» ein, dass es mit der Erwärmung nicht mehr so recht klappen will.
«In unseren Modellen steckt wohl ein fundamentaler Fehler».
Unter sich sprechen die Klimawarner von einem «Hiatus» (Pause) und hoffen - im Gegensatz zu uns - dass es schon wieder wärmer werde.
CO₂-bedingt in eine Eiszeit
Die Klimadebatte begann 1974 mit der Drohung des amerikanischen Aussenministers Henry Kissinger, dass die Menschheit CO₂-bedingt in eine Eiszeit schlittern werde.
Die Forscher präzisierten, dass es im Jahre 2015 Null Grad kalt sein werde.
Prognosen: «Die Selbstverbrennung»
Im gleichen Jahr veröffentliche der persönliche Klimaberater von Angela Merkel, H.J. Schellnhuber, entgegen allen Befürchtungen sein Buch «Die Selbstverbrennung».
Mit ihren Prognosen hatten die Klimawarner noch nie sonderlich Glück.
Al Gore prophezeite 2006 in seinem Film «Eine unbequeme Wahrheit», dass im Jahre 2013 das Eis der Arktis geschmolzen sein werde.
Er erhielt dafür den Nobelpreis.
Angela Merkel drohte uns 2009 anlässlich des Klimagipfels in Kopenhagen, dass bis 2015 die Zunahme des CO₂ gestoppt werden müsse - sonst sei es zu spät.
Sie schenkte uns etwas später grosszügig noch einmal fünf Jahre.
Die Liste missratener Drohungen kann fast beliebig fortgesetzt werden.
Extremwetter?
Mit den seit neuerer Zeit angedrohten Extremwettern ist den Klimaforschern der argumentative Befreiungsschlag gelungen, denn damit liegen sie immer richtig.
Irgendwo ist es immer zu heiss oder zu kalt, zu trocken oder zu nass.
Sie können nun stressfrei ihre Prophetie zum Besten geben.
Die Botschaft lautet nun: «Auch wenn die Erwärmung nicht so recht voranschreitet wie geplant, es werden uns die Extremwetter zu schaffen machen».
Aufzeichnungen von Wetterkatastrophen können 1'000 Jahre zurückverfolgt werden.
So weit reichen Aufzeichnungen und Berichte, die uns in Archiven erhalten geblieben sind.
Es sei deshalb der Frage nachgegangen, wann es extreme Ereignisse gab, und in welche klimatischen Epochen sie fielen.
Wenn warme Epochen belastet sind, müssen gemäss der Logik kalte Epochen wettermässig ruhige Zeiten gewesen sein.
Der Vergleich von Klimaschwankungen beschränkt sich medial meist nur auf die letzten 150 Jahre.
Das ist in etwa so, wie wenn man aufgrund des Wetters eines einzigen Tages, auf das ganze Jahre schliessen würde.
Seit 1800 erholt sich das Klima aus der Kleinen Eiszeit, in welche die Menschheit unverschuldet zwischen 1350 und 1450 geraten ist.
Wir befinden uns in der Warmzeit (Holozän) zwischen der letzten, vierten und der mutmasslich bevorstehenden fünften Eiszeit.
Das sind gut und gerne 15'000 Jahre.
Anzumerken gilt es, dass während allen nachfolgend beschriebenen Klimaschwankungen der CO₂-Gehalt konstant bei ca. 280ppm lag.
Die Jahrtausendsturmfluten und Hochwasser



Es waren die beiden Marcellus-Sturmfluten von 1219 und 1362 und die Burchhaldi-Flut von 1634, die vierzig Prozent der friesischen Inseln binnen weniger Tage verschwinden liessen.
Der Chronist spricht bei diesem Ereignis von dreissig Kirchen, welche samt den Menschen und dem Vieh verschwanden, darunter Rungholt, eine damals wichtige Handelsstadt.
Man geht von 50'000-100'000 Ertrunkenen aus.
Zwischen dem 12. bis 19. Jh. waren die Sturmfluten konstant hoch, im 13. und 16. Jh. im Besonderen.
Zu weiteren schweren Sturmfluten kam es 1612, 1615 und jährlich zwischen 1617-31.
In KöIn und weiteren deutschen Städten an Donau, Elbe, Rhein usw. findet man Pegelstände an Brücken, Mauern und Gebäuden, welche an vergangene Hochwasser erinnern.
Überschwemmungen an Flussoberläufen (Schweiz) entstehen durch regional beschränkte Regengüsse.
Am Unterlauf (Deutschland) sind jedoch grossflächige, über mehrere Tage anhaltende Regenfälle verantwortlich.
Das Magdalenen-Hochwasser vom 24. Juli 1342 übersteigt alle Vorstellungskraft.
Betroffen wurden Rhein, Main, Mosel, Donau, Elbe, Fulda und Weser.
Entstandene Runsen sind heute noch Zeitzeugen jener Katastrophe.
Man schätzt den Materialverlust auf fünf Milliarden Kubikmeter, was einer (normalen) Erosion während 2'000 Jahren entspricht.
60'000 Menschen ertranken.
In Köln reichte die Hochwassermarke bis zum Altar des Domes.
Die hohen Pegelstände stammen alle aus der vorindustriellen, aus der Kleinen Eiszeit.
Auf das Hochwasser des Jahres 1342 folgte eine Serie von nassen Jahren, was zu den verheerenden Pestjahren von 1346-1353 führte.
Während dieser Zeit starb rund ein Drittel der Bevölkerung.
In der Schweiz verteilten sich die Hochwasser über all die Jahrhunderte ziemlich regelmässig.
Hitzesommer und Heuschreckenplagen
Im Hitzesommer 1540 gab es während elf Monaten keinen Regen.
Die Temperatur lag ca. 7° über dem Durchschnitt.
Rhein, Elbe, Seine und andere Flüsse waren ausgetrocknet.
In Basel badeten die Leute am Silvester.
Die Insel Lindau war mit dem Festland verbunden.
Weitere Hitzejahre waren 1616, 1893 und 1921.
Atypisch ist der Umstand, dass der Jahrtausendsommer mitten in die Kleine Eiszeit fiel.
Heuschreckenplagen gab es nördlich der Adria und nördlich des Schwarzen Meeres.
Davon betroffen war das 14. und 15. Jahrhundert, zur Zeit der grossen Pestzüge, als die Abkühlung in die Kleine Eiszeit erfolgte, nämlich 1310-1341 / 1350 / 1473-1480 und 1693.
Jahrtausendwinter
Der Jahrtausendwinter fand 1709 statt.
Die Jahrestemperatur lag knapp 10° unter dem Schnitt.
Es gefroren der Golf von Genua, die Lagune von Venedig.
Wölfe drangen bis in die Dörfer.
Wildtiere erfroren und Vögel fielen tot von den Bäumen.
Menschen und Tiere erfroren in den Häusern und Ställen.
Es gab ca. 100'000 Tote.
Im Frühjahr führte die grosse Schneeschmelze zu Überschwemmungen.
Missernten verursachten Hungersnot und Epidemien.
Die sich zurückziehenden Gletscher entstanden alle während der Kleinen Eiszeit.
Ungewöhnlich muss der Winter 1010/1011 gewesen sein, schwamm doch Treibeis den Nil herunter.
Schlussfolgerung
Die Behauptung, dass warme Epochen mehr von extremen Wetterereignissen betroffen seien, bestätigen die letzten 1'000 Jahre nicht.
In diese Zeit fielen das mittelalterliche Klimaoptimum (Gotik) und die Kleine Eiszeit (1400-1800).
Es war letztere, die von Extremereignissen heimgesucht wurde.
Zufälligerweise begann das Industriezeitalter am Ende der Kleinen Eiszeit, jedoch fünfzig Jahre später.
Die heutige Erwärmung ist die Kompensation der Abkühlung in die Kleine Eiszeit.
Wenn sich das wiederholen würde, bekämen wir wohl die Gletscher zurück.
Allerdings war diese Zeit geprägt von Missernten, Hungersnöten und Seuchen.
Wir könnten die in der Zwischenzeit um das Vierfache angewachsene Bevölkerung nicht mehr ernähren.
Die erwähnten Extremwetter werden gerne als regionale Ereignisse heruntergespielt.
Sie können jedoch sowohl in Südamerika (Mayakultur) als auch über ganz Asien (Mongolenreich) nachgewiesen werden.
Offen bleibt die Frage, ob ohne die Zunahme des CO₂-Gehaltes die Erwärmung moderater ausgefallen wäre.
Ueli Gubler ueli.gubler@outlook.com bietet Vorträge an zu folgenden Themen:
• Der anthropogene Klimawandel im Widerspruch zur Klimageschichte
• Die Grenzen der alternativen Energien von Sonne und Wind
• Von tatsächlichen Extrem-Wetter-Ereignissen
⇧ 2021
↑ Droht uns jetzt das Extrenwetter? Risiko-Analyse der Bundesregierung
Vom Umgang mit Klimaalarmismus in den USA
-
EIKE Europäisches Institut für Klima und Energie
Axel Robert Göhring
2021-06-20 de Droht uns jetzt das Extrenwetter? Risiko-Analyse der BundesregierungDie aktuelle Klimaanalyse wurde vom Dessauer Umweltbundesamt, von Dirk Maxeiner zärtlich "bestausgestattete Versorgungsanstalt für ehemalige Funktionäre von Greenpeace & Co." genannt, NGOs wie Adelphi, und einigen Bundesbehörden aus neun Ressorts erstellt.
Was den Steuerzahler das Mammutprojekt gekostet hat, ist uns nicht bekannt.
In den Teilberichten, die insgesamt über 1.000 Seiten umfassen, geht es um die Bereiche Land, Wasser, Wirtschaft, Gesundheit und Infrastruktur.
Die Studie warnt vor Extremwetterereignissen, die angeblich häufiger werden würden.
Was erstaunt, da selbst der Weltklimarat IPCC klar sagte, daß sich Naturkatastrophen nicht häufen:
In einigen Aspekten des Klimasystems, einschließlich Änderungen der Aktivität tropischer Wirbelstürme bei Dürren, Erwärmung der Antarktis, Ausdehnung des antarktischen Meereises und antarktische Massenbilanz, bleibt das Vertrauen in die Zuschreibung auf menschlichen Einfluß aufgrund von Modellunsicherheiten und geringer Übereinstimmung zwischen wissenschaftlichen Studien gering. (AR5, WG1, Technical summary, TS.6.3, S. 114. 10.3.1, 10.5.2, 10.6.1)
Wirbelstürme
In den letzten 100 Jahren wurden im Nordatlantikbecken keine robusten Trends bei der jährlichen Anzahl tropischer Stürme, Hurrikane und der Anzahl großer Hurrikane festgestellt. …
Aktuelle Datensätze zeigen keine signifikanten beobachteten Trends bei der globalen Häufigkeit tropischer Wirbelstürme im letzten Jahrhundert und es bleibt ungewiss, ob die gemeldeten langfristigen Zunahmen der Häufigkeit tropischer Wirbelstürme robust sind, nachdem in der Vergangenheit Veränderungen in den Beobachtungskapazitäten berücksichtigt wurde. (IPCC 2013, AR5, WG1, Kapitel 2.6, Seite 216)
Dürren
Zusammenfassend kommt die aktuelle Bewertung zu dem Schluß, daß es aufgrund fehlender direkter Beobachtungen derzeit nicht genügend Beweise gibt, um auf ein mehr als geringes Vertrauen in einen weltweit beobachteten Trend der Dürre oder Trockenheit (Niederschlagsmangel) seit Mitte des 20. geografische Inkonsistenzen in den Trends und Abhängigkeiten der abgeleiteten Trends von der Indexauswahl.
Basierend auf aktualisierten Studien wurden die Schlussfolgerungen des AR4 zu den weltweit zunehmenden Dürretrends seit den 1970er Jahren wahrscheinlich überbewertet.
Es ist jedoch wahrscheinlich, dass die Häufigkeit und Intensität von Dürren im Mittelmeerraum und Westafrika seit 1950 zugenommen und in Zentralnordamerika und Nordwestaustralien abgenommen hat. (ebenda, Seite 215)
Aber irgend etwas muß man ja sagen, damit Umweltministerin Svenja Schulze mahnen kann, es müsse rasch gehandelt werden.
Heißt: mehr Steuergeld umleiten.
Axel Bojanowski von der Welt meint dazu:
Dabei haben Wissenschaftler den Szenarien längst widersprochen.
Die Bundesregierung aber will ihre Politik offenbar an unrealistischen Extremprognosen ausrichten ….
Die Zukunftsszenarien, die es der Öffentlichkeit präsentiert hat, sind unrealistisch und irreführend,
das hatten Wissenschaftler längst festgestellt.
Konkret soll Deutschland in Zukunft durch "tödliche Hitzebelastung besonders in Städten", Wassermangel in Böden und Starkregen bedroht sein.
Seltsam, Eisstürme fehlen;
das waren ja die wichtigsten Extremwetterereignisse auf der Nordhalbkugel im letzten halben Jahr.
Aber das würde ja auch nicht zum Narrativ passen.

Texas (USA)
Texas: Winter 2020/2021
 What Really Happened During the Texas Power Grid Outage?
(2021‑03‑23)
What Really Happened During the Texas Power Grid Outage?
(2021‑03‑23)
Texas: Rekord-Kälte und Blizzard stellte die Gefahren bloß, alles zu elektrifizieren (2021‑03‑03)
This Blizzard Exposes The Perils Of Attempting To 'Electrify Everything' (2021‑02‑15)Strom-Zusammenbruch in Texas demonstriert die politische Klima-Idiotie (2021‑02‑25)
Texas power freeze-down demonstrates political climate craziness (2021‑02‑21)Texas: Der nächste System-Kollaps (2021‑02‑22)
Texas Failed Because It Did Not Plan (2021‑02‑21)
 Blackoutchaos/Stromausfall in Texas? -
15 Millionen Texaner ohne Strom und Heizung
(2021‑02‑20)
Blackoutchaos/Stromausfall in Texas? -
15 Millionen Texaner ohne Strom und Heizung
(2021‑02‑20)
Eingefrorene Windkraftanlagen lösen Stromausfälle in Texas aus (2021‑02‑16)
Frozen wind turbines trigger Texas blackouts (2021‑02‑15)5 Million Americans Have Lost Power From Texas to North Dakota After Devastating Winter Storm (2021‑02‑15)
Siehe auch: Abhängigkeit
Lastabwurf / Rolling blackout / Délestage électriqueDürre und sommerliche Hitze sind ja neben den steigenden Meeresspiegeln in der letzten Zeit so etwas wie der Basistreibstoff der Klimahysterie geworden.
Daß es dank Wärmeinseleffekt in Siedlungen hochsommers sehr heiß werden kann, ist eine Binse, wird aber nun aufs Klima geschoben.
Wer weiß denn noch, daß es im Sommer 199x viel heißer war?
Die Behauptung, Julihitze würde immer häufiger und tödlicher, kann kein Medienkonsument so leicht überprüfen.
Außer, er stöbert stundenlang beim DWD; aber wer macht das schon?
Und die Bodentrockenheit, vulgo Dürre, das wissen wir vor allem von unseren Lesern, ist hauptsächlich auf örtliche Bodenversiegelung und ähnlich unkonstruktive Baumaßnahmen zurückzuführen.
Viele Bodentypen wirken wie ein Schwamm und saugen sich nach Regengüssen mit Wasser voll, und zwar langsam.
Wird der Regen aber schnell durch Kanäle und Gräben abgeleitet, kann der natürliche Speicher sich nicht mehr richtig vollsaugen.
Daß bislang nur wenig vom Behaupteten zu spüren war, wird sogar zugegeben.
Aber mit Hilfe von "Szenarien" ("Representative Concentration Pathway 8.5", RCP 8.5), die von den berühmten Computermodellen des Potsdam-Instituts für Klimaforschungsfolgen kennen, habe man herausgefunden, daß vor allem der Westen und Süden sich am stärksten "verändern" werde.
Im Südwesten und Osten seien später "Extreme" am deutlichsten zu spüren.
Bojanowski schreibt:
Um "RCP 8.5" zu erreichen, müsste sich die Konzentration von CO₂ in der Luft auf knapp 1400 Teile pro Million Luftteile (ppm) erhöhen, sie muüßte sich im Vergleich zu heute also mehr als verdreifachen ….
Um das "RCP 8.5"-Szenario zu erreichen, müßte die Menschheit die Verbrennung fossiler Energien also stark ausweiten.
Die Kohleverfeuerung müßte verfünffacht werden, aber auf solch eine Steigerung deutet nichts hin.
Ob es überhaupt so viel Kohle in der Erde gibt, ist zweifelhaft.
Zwei der renommiertesten Experten für Klimaszenarien meinten unlängst in "Nature" wer die Szenarien dennoch nutze, sollte sie "deutlich als unwahrscheinlicher schlimmster Fall" deklarieren.
Daher warnen die beiden vor der Verwendung von RCP 8.5.
Die angeblichen Veränderungen würden im Sinne eines "Dominoeffektes" zu "Wirkungsketten" führen, an deren Ende die menschliche Gesundheit stehe - Gruß an die Klimamediziner wie Karl Lauterbach, Eckart von Hirschhausen, die Kollegen von Klug und an den Chef der Urologen-Vereinigung, der durch kochende Männerhoden Probleme bei der Zeugungsfähigkeit auf uns zukommen sieht.
Neben dem pessimistischen Szenario RCP 8.5 gibt die Analyse auch optimistische Zukunftsaussichten als Alternative an.
Bojanowski süffisant:
Die Anzahl der Düretage in Deutschland würde demnach bis Ende des Jahrhunderts sogar kleiner, die jährliche Niederschlagsmenge bliebe in etwa gleich.
Sekundiert wird die apokalyptische Studie vom Vorstand "Klima und Umwelt" des Deutschen Wetterdienstes, der meint, seit 1881 sei die Jahresdurchschnittstemperatur schon um 1,6° gestiegen.
Und 2020 sei das zweitwärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen gewesen.
Das kann schon sein, da wir uns bekanntlich in einer natürlichen Warmphase befinden, die um 1850 einsetzte.
Die weltweit wieder wachsenden Gletscher,
vielleicht auch schon die Eisstürme von Dezember bis Februar, weisen dennoch auf einen allmählichen Wechsel Richtung Kühlphase hin.
Ein Blick nach Amerika zeigt übrigens dasselbe Bild:
Wie unser Referent James Taylor von Heartland darlegte, sind Extremwetterereignisse wie Dürre und Tornados gar nicht häufiger geworden.
⇧ 2019
↑ Vom Umgang mit Klimaalarmismus in den USA
-
13. Internationale EIKE-Klima- und Energiekonferenz (IKEK-13) am 22. und 23. November 2019 in München.
en / de James Taylor - DEUTSCHE VERSION -
Vom Umgang mit Klimaalarmismus in den USA
James Taylor - DEUTSCHE VERSION -
Vom Umgang mit Klimaalarmismus in den USA
James Taylor, Senior Fellow für Umwelt- und Energiepolitik am Heartland Institute
Der Referent beleuchtet die Falschbehauptungen von Alarmisten, nach denen Ernterträge durch Klimawandel rückläufig seien und Naturkatastrophen angeblich deutlich zunähmen.
⇧ 2017
↑ Westeuropäische Extremwettergeschichte der letzten 1200 Jahre auf 5000 Seiten
-
Die kalte Sonne (Fritz Vahrenholt & Sebastian Lüning)
2017-12-25 de Wer es ganz genau wissen möchte: Westeuropäische Extremwettergeschichte der letzten 1200 Jahre auf 5000 Seiten
⇧ 2015
↑ Extremwetter: Was finden die Wetterdienste? Was schreibt der Klimarat IPCC?
-
9. IKEK am 11.12.15 im Haus der Technik in Essen
Dipl.-Meteorologe Klaus-Eckart Puls
de Extremwetter-Ereignisse : Was finden die Wetterdienste? Was schreibt der
Klimarat IPCC?
Extremwetter-Ereignisse : Was finden die Wetterdienste? Was schreibt der
Klimarat IPCC?
![]()
![]() Was finden die Wetterdienste?
Was schreibt der Klimarat IPCC?
Was finden die Wetterdienste?
Was schreibt der Klimarat IPCC?

IPCC AR 5/WG 1 Technical Summary: TS.6 Key Uncertainties (page 114)
Coordinating Lead Authors: Thomas F. Stocker (Switzerland),
Qin Dahe (China), Gian-Kasper Plattner (Switzerland)
Klaus-Eckart Puls, Dipl.-Meteorologe und ehemaliger Leiter der Wetterämter Essen und Leipzig stellt die Fakten zur Extremwetterentwicklung der letzten Jahrzehnte den Behauptungen in den Medien, dem IPCC in der "Summary for Policymakers", div. Klimafolgenforscher, wie dem PIK Direktor Hans-Joachim Schellnhuber und anderen, gegenüber.
Sein Ergebnis, die Daten zeigen in fast allen Kategorien fallende, statt - wie vielfach behauptet - steigende Trends.
Auch die Führung des Deutschen Wetterdienstes DWD verkündet, entgegen ihren eigenen Daten, dass die Extremwetter nach Zahl und Stärke zunehmen werden.
Es stimmt aber nur in einer Kategorie. Die Zahl der Sommertage hat in den letzten Jahren in Deutschland etwas zugenommen.
Ob der Trend anhält ist offen.
Das Fazit von K.-E. Puls
von einer Zunahme von Extremwettern kann weltweit keine Rede sein, die meisten Trends sind sogar negativ.
Und, Überraschung:
Diese Feststellungen finden sich wiederkehrend auch samt und sonders in den viele tausend Seiten der IPCC-Berichte.
Sie schaffen es nur nicht in die politisch redigierte Summary for Policy Makers.
Nur die aber werden von den Journalisten und Politikern gelesen.
Und darauf bauen die Alarmisten.
↑ en Scientists Weren't Always This Stupid
-
Real Science (Tony Heller alias Steven Goddard)
2015-09-27 en Scientists Weren't Always This Stupid
⇧ 2013
↑ «Gegen das Wetter sind wir machtlos»
-
Basler Zeitung / Jean-Martin Büttner
2013-06-22de «Gegen das Wetter sin wir machtlos»Der Berner Klimahistoriker Christian Pfister rät zu Gelassenheit angesichts von Kälte, Hitze, Bise, Hagel und Sturm.
Es sei schon viel schlimmer als dieses Jahr gekommen.
1540: Dürre
Im Jahr 1540. Eine fast einjährige Dürre von der Toskana bis an die deutsche Nordgrenze, von Frankreich bis nach Polen.
Mit einem Rauchschleier über dem Kontinent, bedingt durch die brennenden Wälder, wie wir es 2010 in Russland wieder erlebten.
1588: stürmischen Sommer
1588 kam dann ein Antisommer: Es regnete und stürmte an 88 von 92 Sommertagen.
Die Traubenernte fand in einem Hut Platz.
So einen stürmischen Sommer hätten sie noch nie erlebt, bekannten die Admirale der spanischen Armada wie der englischen Flotte, die damals im Ärmelkanal aufeinandertrafen.
2013: Jahr ohne Frühling
2013 könnte als Jahr ohne Frühling in die Geschichte eingehen.
In der Kleinen Eiszeit von 1300 bis 1900 gab es immer wieder Jahre ohne Frühling und solche ohne Sommer, mit anhaltender Kälte und Regen.
1430 und 1650 in Europa
Heute nimmt man an, dass zwischen 1430 und 1650 in Europa an die 60'000 Frauen als Hexen hingerichtet wurden, nicht nur, aber doch recht oft wegen Wettermachens.
⇧ 2012
↑ Grosse Natur- und Wetterkatastropnen seit 1950
|
|
|
-
Blick
2014-10-16 de Zahl der Naturkatastrophen sinkt 2013 auf Zehn-Jahres-Tief
-
Watts Up With That? (Antony Watts)
2014-10-18 en World Disasters Report for 2013 - lowest number of catastrophies and deaths in 10 years
-
Quelle / Source:
International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC)
en World Disasters Report 2014
-
Die kalte Sonne (Fritz Vahrenholt & Sebastian Lüning)
2014-08-10 de Überraschung bei der Münchener Rückversicherung: Weniger Schäden durch Naturkatastrophen
-
Spielel Online
2012-10-18 de Profitable Katastrophen-Prognosen: Forscher rügen Klimawarnungen von VersicherungenKommentare:
Die kalte Sonne (Fritz Vahrenholt & Sebastian Lüning)
2012-11-11 de Spiegel Online zweifelt an Katastrophenszenarien der Münchener RückversicherungNoTricksZone (Pierre L. Gosselin)
2012-10-18 de Spiegel Slams Munich RE: Distortions Of Weather Extremes Are "Suspicious" And "Irresponsible Hype"
-
Die kalte Sonne (Fritz Vahrenholt & Sebastian Lüning)
2012-06-30 de Die Versicherungswirtschaft und die Klimakatastrophe: Eine unheimliche Liaison
|
en We must prepare for extreme weather events, not vainly try to stop them |
|
|
KATRINA und der tropische Sturm SANDY erinnern uns daran, wie wichtig es ist, uns auf natürliche Wetterereignisse vorzubereiten. |
KATRINA and the tropical Storm SANDY remind us of the importance of getting ready for natural weather events |
|
Quellen/Sources: Extremwetter / Hurrikane in der Vergangenheit |
|
↑ Ist das noch normal? Die extrem schwierige Analyse von Extremwetter
-
Die kalte Sonne (Fritz Vahrenholt & Sebastian Lüning)
2012-04-24 de Ist das noch normal? Die extrem schwierige Analyse von ExtremwetterEs ist noch gar nicht lange her, da musste der menschengemachte Klimawandel für jede noch so kleine und große Wetterkapriole gerade stehen.
Zog ein Sturm übers Land - war es die Klimakatastrophe.
Fiel ein Sommer mal etwas heißer aus und die Erdbeeren verdorrten - war es die Klimakatastrophe.
Trat ein Fluss über die Ufer - war es natürlich die Klimakatastrophe.
Noch im 4. Klimazustandsbericht des Weltklimarats von 2007 wimmelte es nur so von Extremwetter-Horrorszenarien.
Bereits heute wäre der natürliche Schwankungsbereich überschritten, hieß es.
Wie sich später herausstellte wurde im Übereifer dabei wohl in einigen Fällen bewusst "graue" Literatur gegenüber der begutachteten, offiziellen Literatur bevorzugt.
⇧ 2011
↑ Anthropogener Meeres-Spiegel-Anstieg: Vom Konstrukt zur Panik!
-
4. Internationale Klima- und Energiekonferenz in München
Klaus-Eckart Puls, Dipl.-Meteorologe, Bad Bederkesa
2011-11-25/26 de Anthropogener Meeres-Spiegel-Anstieg: Vom Konstrukt zur Panik!
Anthropogener Meeres-Spiegel-Anstieg: Vom Konstrukt zur Panik!
⇧ 2010
↑
Extremes Wetter, extreme Behauptungen
en Extreme Weather Extreme Claims
-
3. Internationale Klima- und Energiekonferenz in Berlin
Klaus-Eckart Puls, Dipl.-Meteorologe, Bad Bederkesa
2010-12-03/04 de Die Normalität des veränderlichen Wetters
Die Normalität des veränderlichen Wetters
| Klaus-Eckart Puls |
Dipl.-Meteorologe, FU Berlin
▶Klaus-Eckart Puls: Who is who (Skeptiker) ▶Klaus-Eckart Puls: Video (Präsentationen) |
-
EIKE Europäisches Institut für Klima und Energie
2010-10-08 de Extremes Wetter, extreme BehauptungenDie fortgesetzten Behauptungen einer katastrophalen, anthropogen verursachten Erwärmung haben in letzter Zeit wieder Auftrieb erhalten, boten doch die Hitzewelle in Russland und die Überschwemmungen in Pakistan willkommene Gelegenheiten dafür.
Auch von diesen Ereignissen wird behauptet, dass sie dem anthropogenen CO2 zugeordnet werden können.
Falls die bzgl. der vermeintlichen globalen Erwärmung ausgegebenen Unsummen dazu benutzt worden wären, die schlimmsten Auswirkungen von Naturkatastrophen zu lindern oder zu versuchen, diese zu verhindern, wären die verzweifelten Nöte der Bewohner von Pakistan wohl schneller gelindert worden.
-
Klimaskeptiker Info
2010-09-30 de Extremes Wetter - Extreme Behauptungen
-
SPPI Science & Public Policy Institute
2010-09-02 en Extreme Weather Extreme Claims2010-09-02 de
 Full report
Full report
The on-going claims of catastrophic anthropogenic global warming have been ramped up again lately because of the opportunities presented by the heat wave in Russia and the floods in Pakistan, which are also being claimed as attributable to anthropogenic CO2.
If the amount spent on global warming were to be diverted to mitigating and preventing the worst effects of natural disasters, then the desperate plight of the people of Pakistan would be relieved more quickly.
↑ USA und die Welt
Munich Re:
de Panik-Küche en Panic laboratory fr Marmite alarmiste
-
USA Today
2012-10-10 en Munich Re StudyThe number of natural disasters per year has been rising dramatically on all continents since 1980, but the trend is steepest for North America where countries have been battered by hurricanes, tornadoes, floods, searing heat and drought, a new report says.
The study being released today by Munich Re, the world's largest reinsurance firm, sees climate change driving the increase and predicts those influences will continue in years ahead, though a number of experts question that conclusion.
Kommentare / Comments:
-
Watts Up With That? (Antony Watts)
2012-10-10 en Climate Craziness of the Week - USA Today duped into thinking severe weather began in 1980Time for a graphjam, starting with ...
Berliner Tagesspiegel:
de Panik-Küche en Panic laboratory fr Marmite alarmiste
-
Berliner Tagesspiegel
2012-08-15 de
Kommentare / Comments:
-
Die kalte Sonne (Fritz Vahrenholt & Sebastian Lüning)
2012-08-15 de Extremer Extremwetter-Artikel im Berliner Tagesspiegel: Zeit für einen Faktencheck
↑ Europa
Extremwetter in Mitteleuropa war gleichmäßig über die vergangenen 1000 Jahre verteilt
en Combined dendro-documentary evidence of Central European hydroclimatic
springtime extremes over the last millennium
-
Die kalte Sonne (Fritz Vahrenholt & Sebastian Lüning)
2013-01-19 de Extremwetter in Mitteleuropa war gleichmäßig über die vergangenen 1000 Jahre verteiltExtremwerte in der Häufigkeit und Schwere der Tannen-Baumringbreite sind im regionalen bis kontinentalen Maßstab gleichmäßig über das vergangene Jahrtausend verteilt.
Haupteinflussgröße war vermutlich die Niederschlagsmenge im Zeitraum April bis Juni. [...]
Die ziemlich gleichförmige Verteilung der hydroklimatischen Extreme über die Mittelalterliche Wärmeperiode, Kleine Eiszeit und die Moderne Wärmeperiode hinweg stellt die gängige Ansicht in Frage, dass Häufigkeit und Schwere von solchen Ereignissen eng an den klimatischen Zustand gekoppelt wären.
Die vorliegende gemeinschaftliche Baumringstudie ermöglicht eine Einordnung der extremklimatischen Ereignisse der industriellen Phase in den Kontext der natürlichen [vorindustriellen] Variabilität.
Die Studie stellt weiterhin eine wichtige Kallibrierungsmöglichkeit für Klimamodellsimulationen über lange Zeiträume dar.
-
ScienceDirect
Ulf Büntgen, Rudolf Brázdil, Karl-Uwe Heussner, Jutta Hofmann, Raymond Kontic, Tomás Kyncl, Christian Pfister, Katerina Chromá, Willy Tegel
2011-12-27/28 en Combined dendro-documentary evidence of Central European hydroclimatic springtime extremes over the last millenniumDocumentary evidence independently confirms many of the dendro signals over the past millennium, and further provides insight on causes and consequences of ambient weather conditions related to the reconstructed extremes.
A fairly uniform distribution of hydroclimatic extremes throughout the Medieval Climate Anomaly, Little Ice Age and Recent Global Warming may question the common believe that frequency and severity of such events closely relates to climate mean stages.
This joint dendro-documentary approach not only allows extreme climate conditions of the industrial era to be placed against the backdrop of natural variations, but also probably helps to constrain climate model simulations over exceptional long timescales.
Stürme in Europa:
-
Die kalte Sonne (Fritz Vahrenholt & Sebastian Lüning)
2012-08-05 de Eine unbequeme Wahrheit: Während der Kleinen Eiszeit waren die Stürme in Europa stärker als heute
-
EIKE Europäisches Institut für Klima und Energie
2012-08-08 de Eine unbequeme Wahrheit: Während der Kleinen Eiszeit waren die Stürme in Europa stärker als heute
ZDF:
de Panik-Küche en Panic laboratory fr Marmite alarmiste
-
Extremwetter-Talkrunde im Geomar-Schuppen
2012-07-25 de
Kommentare / Comments:
-
Die kalte Sonne (Fritz Vahrenholt & Sebastian Lüning)
2012-08-16 de Gruselige Extremwetter-Talkrunde im Geomar-Schuppen: ZDF pflegt das Klimahorror GenreNachdem sich die Temperatur seit 14 Jahren nicht mehr an die IPCC-Vorgaben hält, haben sich die Anhänger der Klimakatastrophe ein neues Betätigungsfeld gesucht, nämlich das Extremwetter.
Genüsslich werden im Film die Highlights der Extremwetterszene aus dem letzten Jahrzehnt präsentiert:
- 2002: Jahrhundertflut in Deutschland und Osteuropa
- 2003: Extremsommer mit Dürre in Südeuropa, starkes Gletscherschmelzen in den Alpen
- 2005: Extremwinter in Europa, Alpenhochwasser
- 2006: Sturm Kyrill
- 2006: Überflutungen nach extremem Schneefall und anschließender Schmelze,
- 2007: extreme Dürre südlich der Alpen
Der Film schließt bedenklich.
"Eines wissen wir aber sicher: Unsere Art zu leben wird das Risiko erhöhen".
Also doch Strafe des Himmels für unser sündiges Verhalten. Aber das hatten wir ja auch schon vor dem Film vermutet.
↑ Niederlande
-
Spiegel Online
2012-07-01 de Weniger Stürme an der NordseeDie prognostizierte Klimaerwärmung brachte die Furcht vor mehr Sturmfluten mit sich.
Vor allem die Niederlande wären bedroht, sie liegen weitenteils niedriger als der Meeresspiegel - immer höhere Deiche sollen das Land schützen.Die Sorge war jedoch bislang unbegründet, wie eine neue Studie im Fachblatt "Climate Change" zeigt:
Die Niederlande erleben der Statistik zufolge immer weniger Sturmfluten.
-
Die kalte Sonne (Fritz Vahrenholt & Sebastian Lüning)
2012-02-06 de Die kräftigsten Stürme gab es in Holland während der Kleinen Eiszeit
-
NoTricksZone (P Gosselin )
2012-07-02 en Journal Of Climate Change: Last 15 Years, Netherlands Has Seen The Fewest Number Of Storms Since Records Began"The Netherlands is currently experiencing the minimum aggregate storm damage of the past 100 years, though only slightly lower than a quiet period of 50 years ago."
Since systematic records have been kept starting 101 years ago, never have there been fewer storms than in the last 15 years, reports Stephen Cusack of the private research institute 'Risk Management Solutions' in London.
Not only storms as a whole, but also storms with heavy damages have greatly reduced."
↑ Frankreich
-
Die kalte Sonne (Fritz Vahrenholt & Sebastian Lüning)
2012-07-20 de Wann gab es die schlimmsten Stürme an der französischen Mittelmeerküste? Immer wenn die Sonne schwächelte und die Temperaturen fielen!
⇧
4 Sonnenscheindauer
en Sunshine duration
fr Durée d'ensoleillement
Mit folgenden Links wird von anderen Webseiten auf diese Seite verwiesen:
| de | en | fr |
|---|---|---|
|
Wetterphänomene Sonnenscheindauer |
Weather phenomena Sunshine duration |
Phénomènes météorologiques Durée d'ensoleillement |
- Verzeichnis │ Allgemein │ Text
⇧ de Verzeichnis en Contents fr Sommaire
- 2020
- de Kommt ein Dürresommer? Eine experimentelle Prognose auf Basis der schwankenden Sonnenaktivität
- 2011
- de METOZURICH: Klimawandel bringt Sonne an den Tag
- 2019
- de Deutschland 2018 mit Sonnenscheinrekord: Hat das CO2 die Wolken vertrieben?
- 2018
- de Klimawandel in Österreich: Immer sonnenreicher
- de Juli 2018 in Deutschland - kein neuer Rekordmonat
⇧ de Allgemein en General fr Générale
-
Wikipedia
de
Sonnenschein
en Sunshine duration
fr Durée d'ensoleillement
![]()
![]() Abbildung 2: 11-jähriger Sonnenfleckenzyklus und
Wettertrend im Juni/Juli im Deutschlandmittel
mit Trendprognose für die nächsten Jahre
Abbildung 2: 11-jähriger Sonnenfleckenzyklus und
Wettertrend im Juni/Juli im Deutschlandmittel
mit Trendprognose für die nächsten Jahre

▶Niederschläge: Kommt ein Dürresommer?
▶Sonnenscheindauer: Kommt ein Dürresommer?
▶Temperaturen: Kommt ein Dürresommer?
▶Auftreten von Dürre: Kommt ein Dürresommer?
⇧ de Text en Text fr Texte
⇧ 2020
↑ Kommt ein Dürresommer? Eine experimentelle Prognose auf Basis der schwankenden Sonnenaktivität
-
Die kalte Sonne (Fritz Vahrenholt & Sebastian Lüning)
Dr. Ludger Laurenz
2020-04-19 de Kommt ein Dürresommer? Eine experimentelle Prognose auf Basis der schwankenden SonnenaktivitätDie schwankende Sonnenaktivität beeinflusst unser Wetter nach neueren Untersuchungen wesentlich stärker als gedacht.
Die Aktivität der Sonne schwankt in einem elfjährigen Zyklus, die Energie der Sonnenstrahlung ändert sich dabei aber nur um etwa 0,1 Prozent.
Dennoch beeinflusst die Variation der Sonnenstrahlung unser Wetter erheblich und für jeden spürbar.
Mögliche Verstärkermechanismen befinden sich noch in der Erforschung.
Laut folgender These wird der solare Einfluss auf unser Wetter erkennbar:
Der solare Einfluss auf unser Wetter wird sichtbar, wenn der Beginn des Sonnenzyklus auf das Jahr des Sonnenflecken-Maximums gelegt wird.
In jenem Jahr erzeugt die Sonne einen Startimpuls.
Ausgelöst durch diesen Impuls werden in jedem Zyklus für etwa 10 Jahre wiederkehrende Wettermuster gebildet.
Das betrifft alle Schichten der Atmosphäre.
Aus den wiederkehrenden Wettermustern lassen sich Trendprognosen erstellen.
Dazu hat der Autor in den letzten Monaten mehrere Beiträge verfasst (hier & hier).
-
Die Kalte Sonne / Dr. Ludger Laurenz
2010-03-06 de Handschrift der Sonne in Daten zahlreicher Wetterstationen fordert Meteorologen und Klimaforscher herausZusammenfassende Hypothesen
Im 11-jährigen Sonnenzyklus (Schwabezyklus) erzeugt die Sonne im Jahr des Sonnenfleckenmaximums einen Startimpuls.
Ausgelöst durch diesen Startimpuls werden in jedem Sonnenfleckenzyklus für etwa 10 Jahre ab dem Sonnenfleckenmaximum wiederkehrende Wettermuster gebildet.
Der Vergleich zwischen Sonnensignalen einzelner Stationen mit dem Sonnensignal im Mittelwert größerer Regionen hat gezeigt, dass der solare Einfluss an einzelnen Wetterstationen deutlicher ausgeprägt ist als in Mittelwerten über größere Regionen wie Bundesländer oder Staaten.
Das solare Wettermuster des Schwabezyklus ist beim Niederschlag ausgeprägter als bei der Sonnenscheindauer oder Temperatur.
Eigentlich dürfte es die gezeigten solaren Wettermuster nicht geben.
Sowohl der IPCC als auch führenden Klimaforschungs- und Klimafolgenforschungseinrichtungen in Deutschland betonen bis heute, dass von der Sonne kein bedeutender Einfluss auf den Wettertrend ausgehen kann.
Dafür sei die Variabilität der Sonnenaktivität innerhalb des Schwabezyklus viel zu gering.
Mit diesem Beitrag werden insbesondere die Klimawissenschaftler angesprochen,
die den aktuellen Klimawandel fast allein auf die Zunahme der CO₂-Konzentration zurückführen
und zur Stellungnahme hinsichtlich des nachgewiesenen solaren Einflusses auf den Wettertrend aufgefordert.
Mit dem aufgezeigten solaren Einfluss wird die Argumentation gestützt, dass die Sonne der Haupttreiber für Klimaveränderungen und die aktuelle Warmzeit ist.
Die im ersten KALTESONNE-Beitrag dargestellte positive Korrelation zwischen der Anzahl der Sonnenflecken im Jahr des Fleckenmaximums und der Temperaturanomalie im äquatorialen Pazifik unterstützt die Annahme, dass die globale Erwärmung der letzten Jahrzehnte solar beeinflusst ist (s. bit.ly/2VIKA7R, Abbildung 7).
Mit Hilfe der These vom Impuls der Sonne im Jahr des Fleckenmaximums sind erstmalig Prognosen des monatlichen Niederschlagstrends bis zu 10 Jahre im Voraus möglich.
Die bisher gefundenen Muster sind aber nur in 10 bis 20 Prozent des Jahres so eindeutig, dass eine Trendprognose Sinn ergibt.
Auch in der restlichen Zeit des Jahres ist ein solarer Einfluss auf die Wettermuster zu vermuten.
Allerdings muss nach dem oder den Schlüsseln gesucht werden, die den solaren Einfluss aufzeigen.
Ein Schlüssel dürfte bei den Phasenverschiebungen und unterschiedlichen Verzögerungen in der Wirkungskette Sonne, Stratosphäre und Troposphäre liegen.
Sollte ein solcher Verzögerungsschlüssel gefunden werden, wären noch wesentlich bessere Wettertrend-Prognosen als in diesem Beitrag skizziert möglich sein.
Klimaforschung sollte die Sonne als zentrale Einflussgröße einbeziehen.
Es ist Aufgabe von Sonnenphysikern und Atmosphärenforschern, die Signale der Sonne zu identifizieren, die eine den Wettertrend beeinflussende Wirkung haben.
Alle EDV-gestützten Klimaprojektionen und Zukunftsszenarien, die bisher die Sonne nicht als wesentlichen Wetter- und Klimagestalter einbezogen haben, dürften wertlos sein.
Erst mit Einbeziehung der Sonne als wichtigen Wetter- und Klimagestalter in die Computerprogramme ist mit belastbaren Zukunftsprojektionen zu rechnen.
-
Die Kalte Sonne / Dr. Ludger Laurenz
2020-01-31 de Handschrift des 11-jährigen Sonnenfleckenzyklus in Atmosphäre und OzeanenINHALT:
Kapitel 1: These vom Impuls der Sonne im Jahr des Sonnenfleckenmaximums
Kapitel 2: Vom Sonnenfleckenzyklus im australischen Buschfeuer zur globalen Erwärmung
Kapitel 3: Handschrift der Sonnenfleckenzyklus in der Atmosphäre (17 km, 10 km)
Kapitel 4: Handschrift der Sonnenfleckenzyklus in den Daten einzelner Wetterstationen
Dr. Ludger Laurenz gelang in Zusammenarbeit mit zwei weiteren Wissenschaftlern der Nachweis, dass die Niederschlagsverteilung in weiten Teilen von Europa vom Sonnenfleckenzyklus beeinflusst wird.
Die Ergebnisse sind 2019 im Journal Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics veröffentlicht worden
▶ en Influence of solar activity on European rainfall
Laurenz, L., H.-J. Lüdecke, S. Lüning (2019)
J. Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics,
185: 29-42, doi: 10.1016/j.jastp.2019.01.012
Der Einfluss des Startimpulses der Sonne lässt sich im Sommer in den Monaten Juni und Juli nachweisen, wenn die Sonne bei uns am höchsten steht.
Der Deutsche Wetterdienst (DWD) stellt die Wetterdaten von Deutschland, den und vieler Stationen ab 1881 zur Verfügung.
Seitdem hat es 12 vollständige Sonnenzyklen (von Maximum zu Maximum) gegeben, von 1883 bis 2013, und den aktuellen Zyklus, der 2014 mit einem weiteren Maximum begonnen hat.
Wird der Beginn eines jeden Zyklus auf das Impulsjahr gelegt, entsteht der Kurvenschwarm in Abbildung 1.
Das Impulsjahr entspricht meist dem nach SILSO definierten Jahr mit dem Sonnenfleckenmaximum.
SILSO Sunspot Index and Long-term Solar Observations
en Sunspot number series: latest updateSolar Cycle 25
An international panel of experts coordinated by the NOAA and NASA,to which the WDC-SILSO contributed, released a preliminary forecast for Solar Cycle 25 on April 5, 2019.
Based on a compilation of more than 60 forecasts published by various teams using a wide range of methods, the panel reached a consensus indicating that cycle 25 will most likely peak between 2023 and 2026 at a maximum sunspot number between 95 and 130.
This prediction is now given in the scale of sunspot number Version 2.
Therefore, solar cycle 25 will be similar to cycle 24, which peaked at 116 in April 2014.
The next minimum between the current cycle 24 and cycle 25 is predicted to occur between July 2019 and September 2020.
Given the previous minimum in December 2008, this thus corresponds to a duration for cycle 24 between 10.6 and 11.75 years.
Je nach Monat oder Jahreszeit, in denen solare Wettermuster auftreten, können sich die Impulsjahre geringfügig unterscheiden.
Das dürfte nicht an unterschiedlichen Zeitpunkten des Sonnenimpulses liegen, sondern an unterschiedlichen Verzögerungen, bis das Sonnensignal im Wettertrend erscheint.
Die These vom Impuls im Jahr des Sonnenfleckenmaximums ist so jung, dass Fragen zur Definition des Impulsjahres und der Verzögerungszeiten noch näher analysiert werden müssen.
...
Abbildung 1: Trend der Niederschlagssumme Juni/Juli im Deutschlandmittel

 Abbildung 1: 11-jähriger Sonnenfleckenzyklus und
Trend der Niederschlagssumme Juni/Juli im Deutschlandmittel
Abbildung 1: 11-jähriger Sonnenfleckenzyklus und
Trend der Niederschlagssumme Juni/Juli im Deutschlandmittel
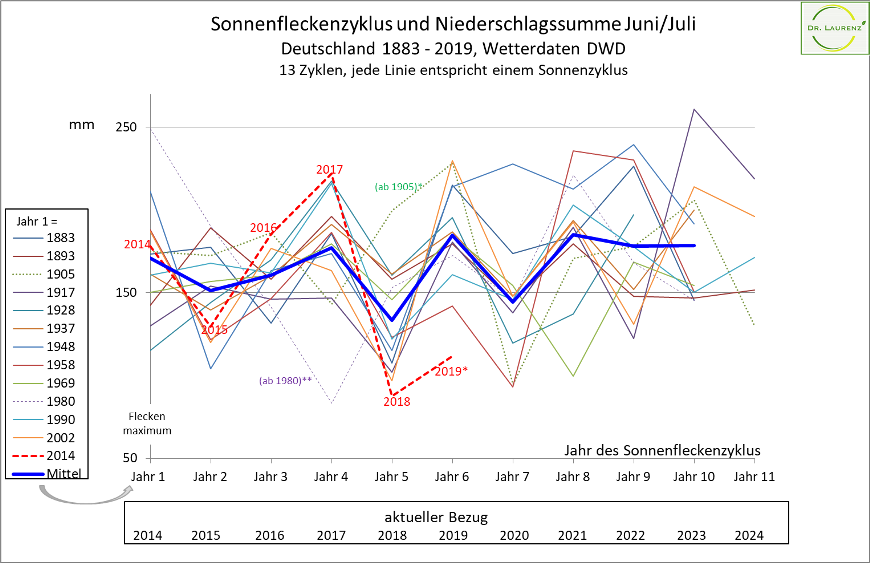
Jede Linie entspricht dem Verlauf der Niederschlagssumme in einem Sonnenzyklus.
Beim erstmaligen Betrachten irritiert der Kurvenverlauf.
Ein ähnliches Muster findet sich weltweit in allen solaren Wettermustern, wenn der Beginn des Sonnenzyklus auf das Jahr des Fleckenmaximums gelegt wird.
Eine Erklärung dafür wird am Ende dieses Beitrages gegeben.
Zeitweise verlaufen alle 13 Kurven gleichsinnig parallel.
Das ist ein Hinweis darauf, dass von der Sonne im Jahr des Fleckenmaximums ein Impuls ausgeht, der für diesen Trend verantwortlich ist.
Mit dieser Parallelität kommt das Signal zum Ausdruck, das die Sonne im Verlauf des Sonnenfleckenzyklus an die Sommerniederschlagsaktivität in Deutschland sendet.
...
Abbildung 2: Wettertrend im Juni/Juli im Deutschlandmittel

 Abbildung 2: 11-jähriger Sonnenfleckenzyklus und
Wettertrend im Juni/Juli im Deutschlandmittel
mit Trendprognose für die nächsten Jahre
Abbildung 2: 11-jähriger Sonnenfleckenzyklus und
Wettertrend im Juni/Juli im Deutschlandmittel
mit Trendprognose für die nächsten Jahre

▶Niederschläge: Kommt ein Dürresommer?
▶Sonnenscheindauer: Kommt ein Dürresommer?
▶Temperaturen: Kommt ein Dürresommer?
▶Auftreten von Dürre: Kommt ein Dürresommer?In Abbildung 2 ist das Sonnensignal für die Klimagrößen Niederschlagssumme, Sonnenscheindauer und Temperatur für Juni/Juli im Mittel von Deutschland dargestellt.
Für den Niederschlagstrend und die Sonnenscheindauer werden Relativwerte verwendet.
Dadurch sind diese Größen leichter vergleichbar.
Die Sonnenscheindauer ist erwartungsgemäß negativ korreliert zur Niederschlagssumme.
Die Temperatur verläuft weitgehend parallel zur Sonnenscheindauer.
Das Zyklusjahr 5 ist das trockenste, sonnenscheinreichste und wärmste Jahr aller Zyklusjahre.
Das Hitze- und Dürrejahr 2018 ist ein Jahr 5.
Die Sonnenaktivität war offensichtlich verantwortlich für den Wettercharakter im Sommer 2018.
Der Kurvenverlauf in Abbildung 2 lässt sich für Trendprognosen nutzen.
Dazu sind die Jahreszahlen des aktuellen Sonnenzyklus, beginnend mit 2014, am unteren Rand eingefügt.
Für 2020 sind erneut niedrige, eventuell sogar sehr niedrige Niederschlagssummen wahrscheinlicher als durchschnittliche oder sogar überdurchschnittliche Regensummen.
In 11 von 12 Zyklen sinkt die Niederschlagssumme von Jahr 6 zu Jahr 7, s. Abbildung 1.
Der aktuelle Sonnenzyklus mit dem zu Beginn sehr schwachem Impuls verläuft nicht normal.
So ist der in anderen Zyklen regelmäßig auftretende Windrichtungswechsel in der QBO (s.u.) von Jahr 1 zum Jahr 2 ausgeblieben.
Wikipedia
de Quasi-zweijährige SchwingungDie quasi-zweijährige Schwingung (kurz: QBO vom englischen "quasi-biennial oscillation"), auch quasi-biennale Oszillation, ist eine quasi-periodische atmosphärische Welle des zonalen Windes in der äquatorialen Stratosphäre der Erde.
Wenn sich 2020 entsprechend den Kurvenverläufen in Abbildung 1 zu einem historischen Dürrejahr entwickelt,
könnte das allein durch den aktuellen Verlauf der Sonnenaktivität verursacht worden sein.
Für Deutschland lässt sich in Zukunft ein Trend für die Niederschlagssumme Juni und Juli für ca. 10 Jahre im Voraus aufstellen, sobald der Zeitpunkt und die Qualität des Sonnenfleckenmaximums bzw. des Sonnenimpulses bekannt sind.
In wieweit das auch in Zyklen mit zu Beginn sehr niedriger Fleckenzahl und schwachem Impuls möglich sein wird, müssen weitere Untersuchungen zeigen.
...
Abbildung 3: Wettertrend im Juni/Juli in verschiedenen Regionen Deutschlands und den Niederlanden

 Abbildung 3: 11-jähriger Sonnenfleckenzyklus und
Wettertrend im Juni/Juli in verschiedenen Regionen Deutschlands
und den Niederlanden
Abbildung 3: 11-jähriger Sonnenfleckenzyklus und
Wettertrend im Juni/Juli in verschiedenen Regionen Deutschlands
und den Niederlanden

In allen Bundesländern ähnliches Sonnensignal
Zur Berechnung des Sonnensignals in unterschiedlichen Regionen Deutschlands sind die Datensätze aus 12 Bundesländern verwendet, die Niederschlagssummen in Relativwerte umgewandelt worden.
Die Werte eigenständiger Städte sind in umgebenden Bundesländern integriert.
Zur besseren Übersichtlichkeit sind die Bundesländer mit ähnlichem Kurvenverlauf in Gruppen zusammengefasst, s. Abbildung 3.
Zu den Ergebnissen der Bundesländer ist der Niederschlagstrend der Niederlande hinzugefügt, um zu zeigen, dass sich das in Nordwest-Deutschland besonders starke Sonnensignal auf dem Gebiet der Niederlande fortpflanzt.
Der Kurvenverlauf von Schleswig-Holstein und Baden-Württemberg wechselt mehr oder weniger gleichförmig von Jahr zu Jahr zwischen niedriger und hoher Niederschlagssumme, auch in den Zyklusjahren 9 bis 11.
Die Kurven der drei anderen Regionen bleiben ab dem Zyklusjahr 8 auf hohem Niveau.
Die Ausschläge zwischen den Extremen sind im Nord-West-Deutschland mit maximal 40 Prozent (Jahr 5 zu Jahr 6) am größten.
In den benachbarten Niederlanden steigt der Betrag sogar auf beachtliche 45 Prozent.
Ähnlich hoch sind die Ausschläge in Belgien und Luxemburg.
Auch mit Hilfe dieser Abbildung können Juni/Juli-Niederschlagsprognosen für die verschiedenen Regionen erstellt werden.
Das aktuelle Jahr 2020 entspricht dem Zyklusjahr 7, einem Jahr mit deutlichem Trend zu unterdurchschnittlicher Sommer-Niederschlagssumme.
2021, dem Zyklusjahr 8, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit für erstmalig wieder überdurchschnittlich viel Regen im Hochsommer.
...
Abbildung 4: Niederschlagssumme verschiedener Zeiträume

 Abbildung 4: 11-jähriger Sonnenfleckenzyklus und
Niederschlagssumme verschiedener Zeiträume
Abbildung 4: 11-jähriger Sonnenfleckenzyklus und
Niederschlagssumme verschiedener Zeiträume
 -
-
...
Mit Abbildung 4 wird die Struktur des Sonnensignals sowohl hinsichtlich des Auftretens in einzelnen Zyklusjahren als auch im Verlauf des Jahres sichtbar.
Das Sonnensignal ist im Juni/Juli wesentlich stärker ausgeprägt als im Zeitraum Mai bis August und dem Gesamtjahr.
Das Signal ist auf die Monate Juni und Juli begrenzt.
Bei der hier nicht dargestellten Betrachtung der Einzelmonate ist das Sonnensignal im Juni stärker ausgeprägt als im Juli.
Schon im vorgelagerten Mai als auch im nachgelagerten August ist es kaum noch erkennbar.
Die jährlichen Ausschläge steigern sich vom Jahr des Sonnenfleckenmaximums bis zur Phase des Fleckenminimums mit den Zyklusjahren 5, 6 und 7.
Ab dem Zyklusjahr 8 verschwindet das Sonnensignal, die Niederschlagssummen bleiben bis zum nächsten Sonnenfleckenmaximum meist auf überdurchschnittlichem Niveau.
Prognosen haben in den Zyklusjahren 3 bis 8 und Monaten Juni/Juli eine hohe Eintrittswahrscheinlichkeit.
Das für Deutschland typische Sonnensignal in der Juni/Juli-Niederschlagssumme erstreckt sich in Europa auf die eher westlich gelegenen Länder von Dänemark über Großbritannien/Irland, Benelux-Länder, Alpenrepubliken, Frankreich und die Iberische Halbinsel.
In den unmittelbar östlich Nachbarschaft ist das Sonnensignal nur etwa halb so stark.
Das Signal ist kaum vorhanden in einem großen Bogen um Deutschland herum von Island über Norwegen, Finnland, Weißrussland, Bulgarien, Rumänien sowie dem zentralen und östlichen Mittelmeerraum.
Übertragungsweg für das Sonnensignal des Schwabezyklus auf unser Wetter
Die hohe Qualität des Sonnensignals in den Juni/Juli-Niederschlagssummen in Abbildung 1 setzt voraus, dass der Impuls der Sonne im Jahr des Fleckenmaximums durch ein festes Zusammenspiel von Planetenstellung, Sonnenaktivität, Vorgängen in der Mesosphäre (50 bis 80 km Höhe), Stratosphäre (12 bis 50 km Höhe) und Troposphäre (bis 12 km Höhe) übertragen wird.
Zu diesem Übertragungsweg gibt es weltweit viele neue Publikationen.
Auch deutsche Forschungseinrichtungen wie das Max-Planck-Institut für Meteorologie in Hamburg [1] oder GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel [2] sind an der Forschung beteiligt.
[1] Geophysical Research Letters
2019-11-20 en Realistic Quasi-Biennial Oscillation Variability in Historical and Decadal Hindcast Simulations Using CMIP6 Forcing[2] Atmospheric Chemistry and Physics
2019-11-20 en Quantifying uncertainties of climate signals related to the 11-year solar cycle.
Part I: Annual mean response in heating rates,temperature and ozoneAus dem Studium der Literatur kann abgeleitet werden, dass die Übertragung des Sonnensignals wahrscheinlich über fünf Ebenen erfolgt:
-
Ebene 1 (vorgeschaltet)
Laufbahn der Planeten im Sonnensystem, die je nach ihrer Stellung das Schwerefeld der Sonne verändern
und damit die Sonnenfleckenaktivität im 11-Jahresrythmus und die Variabilität der UV-Strahlung steuert.
-
Ebene 2
Sonne mit Sonnenflecken, "Sonnenwind" und UV-Strahlung, die das Ozon in der Mesosphäre (50 bis 80 km Höhe) und Stratosphäre (12 bis 50 km Höhe) chemisch-physikalisch beeinflusst.
Die UV-Strahlung variiert während des Sonnenzyklus um ca. 10 Prozent.
-
Ebene 3
Mesophäre und Stratosphäre mit der Ozonchemie und -physik:
je stärker die UV-Strahlung, umso mehr Ozon, umso höher die Temperatur.
Die Ozondynamik wird von der UV-Strahlung gesteuert.
Dadurch verändern sich während des Sonnenzyklus die Temperaturgradienten zwischen Äquator und Polen sowie zwischen verschiedenen Höhen der Atmosphäre.
-
Ebene 4
Quasi-Biennale Oszillation (QBO), die von den Temperaturgradienten in 12 bis 80/nbsp;km Höhe beeinflusst wird.
In der QBO, eine Windzone in 20 bis 40 km Höhe über dem Äquator, wechselt die Windrichtung von Jahr zu Jahr mehr oder weniger regelmäßig von West nach Ost und umgekehrt.
Der Sonnenimpuls wird auf die QBO übertragen, indem die Windrichtung in der QBO im Jahr des Fleckenmaximums in jedem Zyklus von Mai bis Dezember auf Ost dreht.
Der jährliche Windrichtungswechsel (in 20 bis 25 km Höhe) bleibt in den Folgejahren nach eigenen Berechnungen für mehrere Jahre exakt im 12‑Monatsrythmus erhalten, bevor sich der Rhythmus im Verlauf eines jeden Zyklus auf mehr als 12 Monate verlängert.
-
Ebene 5
Zirkulationssystem der Troposphäre mit den wetterbildenden Hoch- und Tiefdruckgebieten, das von der QBO beeinflusst wird.
Der fast jährliche Windrichtungswechsel in der QBO dürfte für das Zick-Zack-Muster in den Niederschlagskurven in den obigen Abbildungen verantwortlich sein.
Fazit
Es gibt unzweifelhaft einen starken Einfluss der Variabilität der Sonne im Rahmen des 11-jährigen Sonnenfleckenzyklus auf unser Wetter,
der wesentlich größer ist als bisher vermutet.
Der Einfluss konzentriert sich auf die Sommermonate Juni und Juli, den Zeitraum höchster Sonneneinstrahlung.
Er zeigt sich in den Niederschlagssumme stärker als in der Sonnenscheindauer oder Temperatur.
Die Niederschlagssumme Juni/Juli reagiert in jedem einzelnen Jahr des Sonnenzyklus unterschiedlich auf die Variabilität der Sonnenstrahlung.
Während der Phase des Sonnenfleckenminimums, in der wir uns zurzeit befinden, betragen die solar verursachten jährlichen Schwankungen der Niederschlagsumme im Juni/Juli 30 bis über 40 Prozent.
Diese Schwankungen haben sich mit hoher Zuverlässigkeit in fast allen 13 Zyklen seit 1883 wiederholt.
Auf Basis dieser Zuverlässigkeit lassen sich für Deutschland Prognosen erstellen.
Prognose für Juni/Juli 2020: Die Niederschlagssumme erreicht nur ca. 80 Prozent des langjährigen Mittels, mit dem Trend zu noch niedrigerem Wert.
Prognose für Juni/Juli 2021: Die Niederschlagssumme erreicht ca. 110 Prozent des langjährigen Mittels.
Diese experimentellen Prognosen sind selbstverständlich ohne Gewähr.
Ziel der Übung ist es, mittelfristige Klimavorhersagen zu entwickeln bzw. zu überprüfen, ob dies möglich ist.
-
|
|
Kommt ein Dürresommer? Sonnenzyklen: Webseiten / Solar cycles / Cycles solaires Wetterphänomene: Niederschläge Wetterphänomene: Sonnenscheindauer |
⇧ 2011
↑ METEOZURICH: Klimawandel bringt Sonne an den Tag
-
METEOZURICH
2011-10-09 de Klimawandel bringt Sonne an den TagDas Kima ist im Wandel - die Temperaturen steigen und auch die Niederschläge verändern sich.
Doch was können wir von der Sonnenscheindauer in Europa, in der Schweiz und auf dem Zürichberg erwarten?
Klimamodelle befassen sich zwar mit der Einstrahlung, doch Prognosen der künftigen Sonnenscheindauer für eine bestimmte Region gibt es kaum, zu gross sind die Unsicherheiten.
⇧ 2019
↑ Deutschland 2018 mit Sonnenscheinrekord: Hat das CO2 die Wolken vertrieben?
-
Die kalte Sonne (Fritz Vahrenholt & Sebastian Lüning)
2019-01-19 de Deutschland 2018 mit Sonnenscheinrekord: Hat das CO2 die Wolken vertrieben?Der Sommer 2018 in Deutschland war heiß, der eine oder andere erinnert sich vielleicht noch.
Die heißen Monate ließen den Jahresdurchschnitt auf 10,5°C hochschnellen, das wärmste Jahre seit Ende der Kleinen Eiszeit, was der historischen Messreihe entspricht.
Ein Blick auf die Temperaturkurve des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zeigt jedoch auch, dass der neue Rekord nicht allzuweit von 2014 entfernt ist, das 10,3°C erreicht hatte.
Damals wurde Deutschland Fußball-Weltmeister, und alle fanden den Sommer klasse.
Bei der WM 2018 schied Deutschland erstmals in der Geschichte des Turniers bereits nach der Gruppenphase aus, ein Katastrophensommer.
Ohne Fußballfreude wurde die Hitze schnell zur Qual.
Nun berichtete der DWD
in seinem Jahresrückblick für 2018 aber auch eine sehr interessante andere Entwicklung.
Auch für die Sonnenscheindauer wurde nämlich ein neuer Rekord aufgestellt.
DWD:
Im Jahr 2018 wurden insgesamt 2015 Stunden Sonnenschein gemessen.Dieser neue Rekord liegt geringfügig über dem im Jahr 2003 registrierten Wert von 2014 Stunden.
Mehr Sonne bedeutet weniger Wolken.
Das Ergebnis ist logisch:
Ein sonnigeres Jahr sollte auch wärmer sein.Die Frage: Wie hat es das CO2 geschafft, die Wolken aus Deutschland zu vertreiben?
Der Zusammenhang ist nicht ganz so klar, denn selbst der IPCC räumt in seinen Berichten ein, die Wolken noch sehr schlecht zu verstehen.
An dieser Stelle laden wir alle Blogleser ein, ein wenig mit den ausgezeichnten Online-Klima-Kurven des DWD zu experimentieren.
Das ist kinderleicht.
Ganz oben wählen Sie einfach den Datentyp aus:
Niederschläge,
Temperaturen,
Sonnenscheindauer.
Dann geben Sie noch an, für welche Zeiteinheit Sie die Kurve anschauen wollen, dann noch die Region - fertig.
Die Frage, der wir nachgehen wollen ist, in welchen Monaten 2018 der große Wärmeschub passiert ist.
Rekordtemperaturwerte wurden im April und Mai erreicht.
Die Monate Januar, Juni, Juli, August, September, Oktober und Dezember waren warm, aber keine Rekorde.
Eher unterkühlt waren Februar und März.
Normalwerte wurden im November registriert.
In den zu warmen Monaten gab es überdurchschnittlich viel Sonne, mit Ausnahme des Januar.
Um diese Entwicklungen zu verstehen, müssen wir zwingend zunächst die Wolken studieren.
Was vertreibt die Wolken?
Welche Rollen spielen Ozeanzyklen?
Welche Rolle spielen externe Klimafaktoren wie die Sonnenaktivität, auch unter Berücksichtigug mehrjähriger Verzögerungseffekte?
Ein spannendes Feld. Mit jedem zusätzlichen Jahr an Daten, rückt auch die Lösung dieser Fragen immer näher. Man darf gespannt sein.
Lesetipp:
-
Klimawandel in Deutschland
de Die Fakten
-
Klimawandel in Deutschland
|
|
Deutschland 2018 mit Sonnenscheinrekord: Hat das CO2 die Wolken vertrieben? |
⇧ 2018
↑ Klimawandel in Österreich: Immer sonnenreicher
-
Die kalte Sonne (Fritz Vahrenholt & Sebastian Lüning)
2018-09-20 de Klimawandel in Österreich: Immer sonnenreicherWolken haben einen großen Einfluss auf den Strahlungshaushalt der Erde und somit auch auf die Lufttemperatur.
Sobald sich im Sommer tagsüber eine Wolkendecke bildet und die Sonnenstrahlung abschirmt, wird es schnell spürbar kälter.
Der Bewölkungsgrad wird in der Meteorologie über die Sonnenscheindauer erfasst.
Je größer die Bewölkung, desto kürzer die Sonnenscheindauer.
Die ZAMG zeigt auf seiner Webseite den Verlauf der Sonnenscheindauer in tiefen und hochalpinen Lagen Österreichs seit 1880.
Im Tiefland ist während der vergangenen 135 Jahre ein wellenförmiger Verlauf der Sonnenscheindauer zu verzeichnen.
Im späten 19. und frühen 21. Jahrhundert schien die Sonne überdurschnittlich lang.
Deutlich kürzere Sonnenscheindauern gab es im frühen und späten 20. Jahrhundert, unterbrochen durch längeren Sonnenschein in den 1940er Jahren.
In den hochalpinen Lagen wurden ähnliche Schwankungen im Verlauf der Sonnenscheindauer beobachtet, jedoch ist hier in den letzten 135 Jahren ein klarer Langzeittrend zu vermehrtem Sonnenschein erkennbar (Abb. 1)

 Abb. 1: Entwicklung der mittleren jährlichen Sonnenscheindauer im
Tiefland 1881-2016 (violett)
Abb. 1: Entwicklung der mittleren jährlichen Sonnenscheindauer im
Tiefland 1881-2016 (violett)
und hochalpinen Lagen 1884-2016 (orange) Österreichs.
Dargestellt sind jährliche Abweichungen vom Mittel der Jahre 1961-1990 (dünne Linien) und deren geglättete Trends (dicke Linien, 21-jähriger Gauß'scher Tiefpassfilter)

Es erscheint plausibel, dass die langfristige Zunahme der Sonnenscheindauer (bzw. der Rückgang der Bewölkung) einen Beitrag zur beobachteten Klimaerwärmung in Österreich während der letzten 100 Jahre gespielt haben muss.
Dies bestätigt auch die ZAMG auf ihrer Webseite:
Der genaue Antrieb in der Veränderung der Sonnenscheindauer und damit Bewölkung ist unklar.
Es fällt jedoch auf, dass der Verlauf der Bewölkung besonders im Tiefland
eng an die Atlantische Multidekaden Oszillation (AMO) gekoppelt ist,
wobei eine negative AMO die Bewölkung erhöht und eine positive AMO die Bewölkung verringert (Abb. 2).

 Abb.2: Verlauf der Atlantischen Multidekaden Oszillation (AMO)
während der vergangenen 155 Jahre.
Abb.2: Verlauf der Atlantischen Multidekaden Oszillation (AMO)
während der vergangenen 155 Jahre.
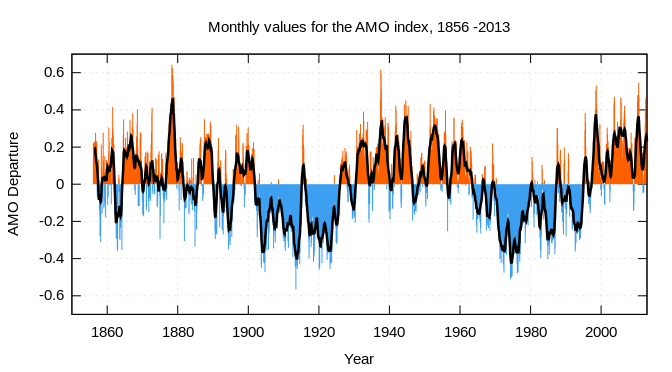
↑ Juli 2018 in Deutschland - kein neuer Rekordmonat
-
EIKE Europäisches Institut für Klima und Energie
Stefan Kämpfe
2018-08-01 de Juli 2018 in Deutschland - kein neuer RekordmonatAuch wenn dieser Juli 2018 vielen rekordverdächtig vorkam - er schaffte es nicht, den bisherigen Rekordhalter von 2006 auch nur annähernd zu gefährden.
Der Titel des "Vizemeisters" bleibt weiterhin dem 1994er Juli erhalten; Platz 3 belegt der Juli 1983.
Dieser Juli war speziell im letzten Monatsdrittel von Hitzewellen geprägt, weil es Ableger des Azorenhochs immer wieder schafften, sich nach Mittel- und Nordeuropa auszubreiten;
zeitweise entwickelten sich daraus kräftige Skandinavien-Hochs.
Dieser Umstand erklärt auch, warum es in diesem Monat, trotz meist positiver NAO- Werte, kaum feucht-kühles "Westwetter" gab.

 Enge "Verzahnung" von Sonnenscheindauer und Temperatur.
Enge "Verzahnung" von Sonnenscheindauer und Temperatur.
Sonnige Juli- Monate sind stets warm;
die Sonnenscheindauer vermag mehr als 70% der Temperaturvariabilität seit 1951 zu erklären;
in keinem anderen Monat besteht ein derart enger Zusammenhang.
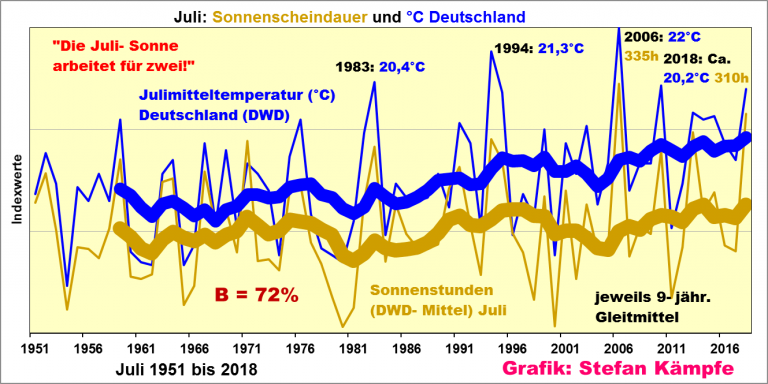
Zusammenfassung
Der 2018er Juli war dank einer hohen Sonnenscheindauer und vieler Hochdruckwetterlagen sehr warm, ohne es unter die drei wärmsten Juli-Monate in Deutschland seit Aufzeichnungsbeginn zu schaffen.
Auch langfristig lässt sich nahezu die gesamte Juli- Erwärmung in Deutschland mit geänderten Großwetterlagenhäufigkeiten und einer längeren Sonnenscheindauer erklären; hinzu kommen wachsende Wärmeinseleffekte, auf welche hier nicht näher eingegangen wird.
⇧
5 Niederschläge
en Precipitation
fr Précipitation
Mit folgenden Links wird von anderen Webseiten auf diese Seite verwiesen:
| de | en | fr |
|---|---|---|
|
Wetterphänomene Niederschläge |
Weather phenomena Precipitation |
Phénomènes météorologiques Précipitation |
Links zur Klimaschau
|
|
▶Dürre ▶Niederschläge ▶Waldbrände |
- Verzeichnis │ Allgemein │ Text
⇧ de Verzeichnis en Contents fr Sommaire
|
|
⇧ de Allgemein en General fr Générale
de
Messungen aus Ostafrika
en
Measurements in East-Africa
fr
Mesures en Afrique de l'Est
▶Lake Victoria Water Level and Sunspot Number
![]()
![]() Vergleich der Februarniederschläge in Deutschland mit der
Sonnenaktivität
Vergleich der Februarniederschläge in Deutschland mit der
Sonnenaktivität
Blaue Kurve: Regenmengen des Monats Februar in Deutschland
seit 1900.
Rot: Verlauf der Sonnenaktivität

▶Denkanstöße: Wie macht die Sonne das?
![]()
![]() Abbildung 2: 11-jähriger Sonnenfleckenzyklus und
Wettertrend im Juni/Juli im Deutschlandmittel
mit Trendprognose für die nächsten Jahre
Abbildung 2: 11-jähriger Sonnenfleckenzyklus und
Wettertrend im Juni/Juli im Deutschlandmittel
mit Trendprognose für die nächsten Jahre

▶Niederschläge: Kommt ein Dürresommer?
▶Sonnenscheindauer: Kommt ein Dürresommer?
▶Temperaturen: Kommt ein Dürresommer?
▶Auftreten von Dürre: Kommt ein Dürresommer?
⇧ de Text en Text fr Texte
↑
A Solare Aktivität und Niederschläge
en Solar activity and precipitations
fr Solar activity and precipitations
de Verzeichnis en Contents fr Sommaire
- 2020
- de Kommt ein Dürresommer? Eine experimentelle Prognose auf Basis der schwankenden Sonnenaktivität
- 2019
- de Denkanstöße: Wie macht die Sonne das?
- de Wie Veränderungen auf der Sonne unseren Regen beeinflussen
- 2017
- en Closely Coupled: Solar Activity and Sea Level
- 2010
- en Lake Victoria Water Level and Sunspot Number
de Text en Text fr Texte
⇧ 2020
↑ Kommt ein Dürresommer? Eine experimentelle Prognose auf Basis der schwankenden Sonnenaktivität
-
Die kalte Sonne (Fritz Vahrenholt & Sebastian Lüning)
Dr. Ludger Laurenz
2020-04-19 de Kommt ein Dürresommer? Eine experimentelle Prognose auf Basis der schwankenden SonnenaktivitätDie schwankende Sonnenaktivität beeinflusst unser Wetter nach neueren Untersuchungen wesentlich stärker als gedacht.
Die Aktivität der Sonne schwankt in einem elfjährigen Zyklus, die Energie der Sonnenstrahlung ändert sich dabei aber nur um etwa 0,1 Prozent.
Dennoch beeinflusst die Variation der Sonnenstrahlung unser Wetter erheblich und für jeden spürbar.
Mögliche Verstärkermechanismen befinden sich noch in der Erforschung.
Laut folgender These wird der solare Einfluss auf unser Wetter erkennbar:
Der solare Einfluss auf unser Wetter wird sichtbar, wenn der Beginn des Sonnenzyklus auf das Jahr des Sonnenflecken-Maximums gelegt wird.
In jenem Jahr erzeugt die Sonne einen Startimpuls.
Ausgelöst durch diesen Impuls werden in jedem Zyklus für etwa 10 Jahre wiederkehrende Wettermuster gebildet.
Das betrifft alle Schichten der Atmosphäre.
Aus den wiederkehrenden Wettermustern lassen sich Trendprognosen erstellen.
Dazu hat der Autor in den letzten Monaten mehrere Beiträge verfasst (hier & hier).
-
Die Kalte Sonne / Dr. Ludger Laurenz
2010-03-06 de Handschrift der Sonne in Daten zahlreicher Wetterstationen fordert Meteorologen und Klimaforscher herausZusammenfassende Hypothesen
Im 11-jährigen Sonnenzyklus (Schwabezyklus) erzeugt die Sonne im Jahr des Sonnenfleckenmaximums einen Startimpuls.
Ausgelöst durch diesen Startimpuls werden in jedem Sonnenfleckenzyklus für etwa 10 Jahre ab dem Sonnenfleckenmaximum wiederkehrende Wettermuster gebildet.
Der Vergleich zwischen Sonnensignalen einzelner Stationen mit dem Sonnensignal im Mittelwert größerer Regionen hat gezeigt, dass der solare Einfluss an einzelnen Wetterstationen deutlicher ausgeprägt ist als in Mittelwerten über größere Regionen wie Bundesländer oder Staaten.
Das solare Wettermuster des Schwabezyklus ist beim Niederschlag ausgeprägter als bei der Sonnenscheindauer oder Temperatur.
Eigentlich dürfte es die gezeigten solaren Wettermuster nicht geben.
Sowohl der IPCC als auch führenden Klimaforschungs- und Klimafolgenforschungseinrichtungen in Deutschland betonen bis heute, dass von der Sonne kein bedeutender Einfluss auf den Wettertrend ausgehen kann.
Dafür sei die Variabilität der Sonnenaktivität innerhalb des Schwabezyklus viel zu gering.
Mit diesem Beitrag werden insbesondere die Klimawissenschaftler angesprochen,
die den aktuellen Klimawandel fast allein auf die Zunahme der CO₂-Konzentration zurückführen
und zur Stellungnahme hinsichtlich des nachgewiesenen solaren Einflusses auf den Wettertrend aufgefordert.
Mit dem aufgezeigten solaren Einfluss wird die Argumentation gestützt, dass die Sonne der Haupttreiber für Klimaveränderungen und die aktuelle Warmzeit ist.
Die im ersten KALTESONNE-Beitrag dargestellte positive Korrelation zwischen der Anzahl der Sonnenflecken im Jahr des Fleckenmaximums und der Temperaturanomalie im äquatorialen Pazifik unterstützt die Annahme, dass die globale Erwärmung der letzten Jahrzehnte solar beeinflusst ist (s. bit.ly/2VIKA7R, Abbildung 7).
Mit Hilfe der These vom Impuls der Sonne im Jahr des Fleckenmaximums sind erstmalig Prognosen des monatlichen Niederschlagstrends bis zu 10 Jahre im Voraus möglich.
Die bisher gefundenen Muster sind aber nur in 10 bis 20 Prozent des Jahres so eindeutig, dass eine Trendprognose Sinn ergibt.
Auch in der restlichen Zeit des Jahres ist ein solarer Einfluss auf die Wettermuster zu vermuten.
Allerdings muss nach dem oder den Schlüsseln gesucht werden, die den solaren Einfluss aufzeigen.
Ein Schlüssel dürfte bei den Phasenverschiebungen und unterschiedlichen Verzögerungen in der Wirkungskette Sonne, Stratosphäre und Troposphäre liegen.
Sollte ein solcher Verzögerungsschlüssel gefunden werden, wären noch wesentlich bessere Wettertrend-Prognosen als in diesem Beitrag skizziert möglich sein.
Klimaforschung sollte die Sonne als zentrale Einflussgröße einbeziehen.
Es ist Aufgabe von Sonnenphysikern und Atmosphärenforschern, die Signale der Sonne zu identifizieren, die eine den Wettertrend beeinflussende Wirkung haben.
Alle EDV-gestützten Klimaprojektionen und Zukunftsszenarien, die bisher die Sonne nicht als wesentlichen Wetter- und Klimagestalter einbezogen haben, dürften wertlos sein.
Erst mit Einbeziehung der Sonne als wichtigen Wetter- und Klimagestalter in die Computerprogramme ist mit belastbaren Zukunftsprojektionen zu rechnen.
-
Die Kalte Sonne / Dr. Ludger Laurenz
2020-01-31 de Handschrift des 11-jährigen Sonnenfleckenzyklus in Atmosphäre und OzeanenINHALT:
Kapitel 1: These vom Impuls der Sonne im Jahr des Sonnenfleckenmaximums
Kapitel 2: Vom Sonnenfleckenzyklus im australischen Buschfeuer zur globalen Erwärmung
Kapitel 3: Handschrift der Sonnenfleckenzyklus in der Atmosphäre (17 km, 10 km)
Kapitel 4: Handschrift der Sonnenfleckenzyklus in den Daten einzelner Wetterstationen
Dr. Ludger Laurenz gelang in Zusammenarbeit mit zwei weiteren Wissenschaftlern der Nachweis, dass die Niederschlagsverteilung in weiten Teilen von Europa vom Sonnenfleckenzyklus beeinflusst wird.
Die Ergebnisse sind 2019 im Journal Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics veröffentlicht worden
▶ en Influence of solar activity on European rainfall
Laurenz, L., H.-J. Lüdecke, S. Lüning (2019)
J. Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics,
185: 29-42, doi: 10.1016/j.jastp.2019.01.012
Der Einfluss des Startimpulses der Sonne lässt sich im Sommer in den Monaten Juni und Juli nachweisen, wenn die Sonne bei uns am höchsten steht.
Der Deutsche Wetterdienst (DWD) stellt die Wetterdaten von Deutschland, den und vieler Stationen ab 1881 zur Verfügung.
Seitdem hat es 12 vollständige Sonnenzyklen (von Maximum zu Maximum) gegeben, von 1883 bis 2013, und den aktuellen Zyklus, der 2014 mit einem weiteren Maximum begonnen hat.
Wird der Beginn eines jeden Zyklus auf das Impulsjahr gelegt, entsteht der Kurvenschwarm in Abbildung 1.
Das Impulsjahr entspricht meist dem nach SILSO definierten Jahr mit dem Sonnenfleckenmaximum.
SILSO Sunspot Index and Long-term Solar Observations
en Sunspot number series: latest updateSolar Cycle 25
An international panel of experts coordinated by the NOAA and NASA,to which the WDC-SILSO contributed, released a preliminary forecast for Solar Cycle 25 on April 5, 2019.
Based on a compilation of more than 60 forecasts published by various teams using a wide range of methods, the panel reached a consensus indicating that cycle 25 will most likely peak between 2023 and 2026 at a maximum sunspot number between 95 and 130.
This prediction is now given in the scale of sunspot number Version 2.
Therefore, solar cycle 25 will be similar to cycle 24, which peaked at 116 in April 2014.
The next minimum between the current cycle 24 and cycle 25 is predicted to occur between July 2019 and September 2020.
Given the previous minimum in December 2008, this thus corresponds to a duration for cycle 24 between 10.6 and 11.75 years.
Je nach Monat oder Jahreszeit, in denen solare Wettermuster auftreten, können sich die Impulsjahre geringfügig unterscheiden.
Das dürfte nicht an unterschiedlichen Zeitpunkten des Sonnenimpulses liegen, sondern an unterschiedlichen Verzögerungen, bis das Sonnensignal im Wettertrend erscheint.
Die These vom Impuls im Jahr des Sonnenfleckenmaximums ist so jung, dass Fragen zur Definition des Impulsjahres und der Verzögerungszeiten noch näher analysiert werden müssen.
...
Abbildung 1: Trend der Niederschlagssumme Juni/Juli im Deutschlandmittel

 Abbildung 1: 11-jähriger Sonnenfleckenzyklus und
Trend der Niederschlagssumme Juni/Juli im Deutschlandmittel
Abbildung 1: 11-jähriger Sonnenfleckenzyklus und
Trend der Niederschlagssumme Juni/Juli im Deutschlandmittel
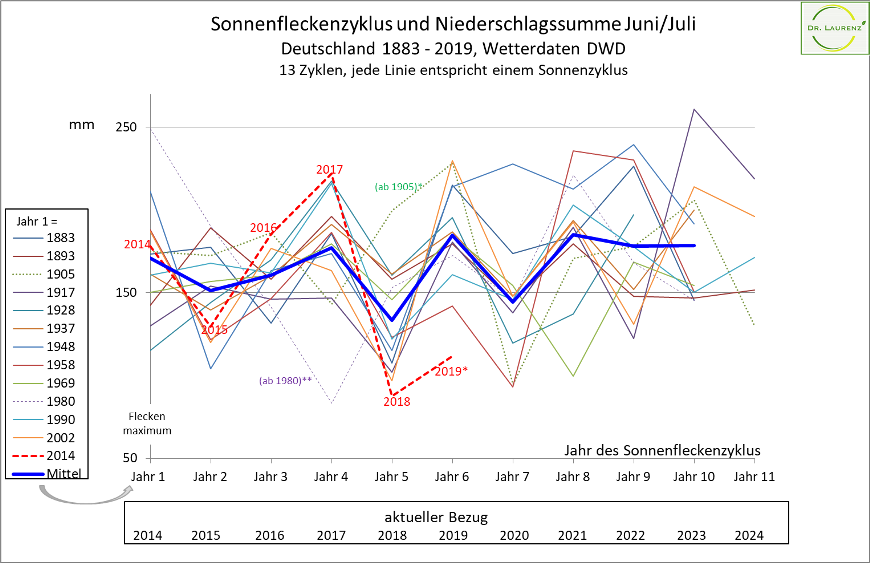
Jede Linie entspricht dem Verlauf der Niederschlagssumme in einem Sonnenzyklus.
Beim erstmaligen Betrachten irritiert der Kurvenverlauf.
Ein ähnliches Muster findet sich weltweit in allen solaren Wettermustern, wenn der Beginn des Sonnenzyklus auf das Jahr des Fleckenmaximums gelegt wird.
Eine Erklärung dafür wird am Ende dieses Beitrages gegeben.
Zeitweise verlaufen alle 13 Kurven gleichsinnig parallel.
Das ist ein Hinweis darauf, dass von der Sonne im Jahr des Fleckenmaximums ein Impuls ausgeht, der für diesen Trend verantwortlich ist.
Mit dieser Parallelität kommt das Signal zum Ausdruck, das die Sonne im Verlauf des Sonnenfleckenzyklus an die Sommerniederschlagsaktivität in Deutschland sendet.
...
Abbildung 2: Wettertrend im Juni/Juli im Deutschlandmittel

 Abbildung 2: 11-jähriger Sonnenfleckenzyklus und
Wettertrend im Juni/Juli im Deutschlandmittel
mit Trendprognose für die nächsten Jahre
Abbildung 2: 11-jähriger Sonnenfleckenzyklus und
Wettertrend im Juni/Juli im Deutschlandmittel
mit Trendprognose für die nächsten Jahre

▶Niederschläge: Kommt ein Dürresommer?
▶Sonnenscheindauer: Kommt ein Dürresommer?
▶Temperaturen: Kommt ein Dürresommer?
▶Auftreten von Dürre: Kommt ein Dürresommer?In Abbildung 2 ist das Sonnensignal für die Klimagrößen Niederschlagssumme, Sonnenscheindauer und Temperatur für Juni/Juli im Mittel von Deutschland dargestellt.
Für den Niederschlagstrend und die Sonnenscheindauer werden Relativwerte verwendet.
Dadurch sind diese Größen leichter vergleichbar.
Die Sonnenscheindauer ist erwartungsgemäß negativ korreliert zur Niederschlagssumme.
Die Temperatur verläuft weitgehend parallel zur Sonnenscheindauer.
Das Zyklusjahr 5 ist das trockenste, sonnenscheinreichste und wärmste Jahr aller Zyklusjahre.
Das Hitze- und Dürrejahr 2018 ist ein Jahr 5.
Die Sonnenaktivität war offensichtlich verantwortlich für den Wettercharakter im Sommer 2018.
Der Kurvenverlauf in Abbildung 2 lässt sich für Trendprognosen nutzen.
Dazu sind die Jahreszahlen des aktuellen Sonnenzyklus, beginnend mit 2014, am unteren Rand eingefügt.
Für 2020 sind erneut niedrige, eventuell sogar sehr niedrige Niederschlagssummen wahrscheinlicher als durchschnittliche oder sogar überdurchschnittliche Regensummen.
In 11 von 12 Zyklen sinkt die Niederschlagssumme von Jahr 6 zu Jahr 7, s. Abbildung 1.
Der aktuelle Sonnenzyklus mit dem zu Beginn sehr schwachem Impuls verläuft nicht normal.
So ist der in anderen Zyklen regelmäßig auftretende Windrichtungswechsel in der QBO (s.u.) von Jahr 1 zum Jahr 2 ausgeblieben.
Wikipedia
de Quasi-zweijährige SchwingungDie quasi-zweijährige Schwingung (kurz: QBO vom englischen "quasi-biennial oscillation"), auch quasi-biennale Oszillation, ist eine quasi-periodische atmosphärische Welle des zonalen Windes in der äquatorialen Stratosphäre der Erde.
Wenn sich 2020 entsprechend den Kurvenverläufen in Abbildung 1 zu einem historischen Dürrejahr entwickelt,
könnte das allein durch den aktuellen Verlauf der Sonnenaktivität verursacht worden sein.
Für Deutschland lässt sich in Zukunft ein Trend für die Niederschlagssumme Juni und Juli für ca. 10 Jahre im Voraus aufstellen, sobald der Zeitpunkt und die Qualität des Sonnenfleckenmaximums bzw. des Sonnenimpulses bekannt sind.
In wieweit das auch in Zyklen mit zu Beginn sehr niedriger Fleckenzahl und schwachem Impuls möglich sein wird, müssen weitere Untersuchungen zeigen.
...
Abbildung 3: Wettertrend im Juni/Juli in verschiedenen Regionen Deutschlands und den Niederlanden

 Abbildung 3: 11-jähriger Sonnenfleckenzyklus und
Wettertrend im Juni/Juli in verschiedenen Regionen Deutschlands
und den Niederlanden
Abbildung 3: 11-jähriger Sonnenfleckenzyklus und
Wettertrend im Juni/Juli in verschiedenen Regionen Deutschlands
und den Niederlanden

In allen Bundesländern ähnliches Sonnensignal
Zur Berechnung des Sonnensignals in unterschiedlichen Regionen Deutschlands sind die Datensätze aus 12 Bundesländern verwendet, die Niederschlagssummen in Relativwerte umgewandelt worden.
Die Werte eigenständiger Städte sind in umgebenden Bundesländern integriert.
Zur besseren Übersichtlichkeit sind die Bundesländer mit ähnlichem Kurvenverlauf in Gruppen zusammengefasst, s. Abbildung 3.
Zu den Ergebnissen der Bundesländer ist der Niederschlagstrend der Niederlande hinzugefügt, um zu zeigen, dass sich das in Nordwest-Deutschland besonders starke Sonnensignal auf dem Gebiet der Niederlande fortpflanzt.
Der Kurvenverlauf von Schleswig-Holstein und Baden-Württemberg wechselt mehr oder weniger gleichförmig von Jahr zu Jahr zwischen niedriger und hoher Niederschlagssumme, auch in den Zyklusjahren 9 bis 11.
Die Kurven der drei anderen Regionen bleiben ab dem Zyklusjahr 8 auf hohem Niveau.
Die Ausschläge zwischen den Extremen sind im Nord-West-Deutschland mit maximal 40 Prozent (Jahr 5 zu Jahr 6) am größten.
In den benachbarten Niederlanden steigt der Betrag sogar auf beachtliche 45 Prozent.
Ähnlich hoch sind die Ausschläge in Belgien und Luxemburg.
Auch mit Hilfe dieser Abbildung können Juni/Juli-Niederschlagsprognosen für die verschiedenen Regionen erstellt werden.
Das aktuelle Jahr 2020 entspricht dem Zyklusjahr 7, einem Jahr mit deutlichem Trend zu unterdurchschnittlicher Sommer-Niederschlagssumme.
2021, dem Zyklusjahr 8, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit für erstmalig wieder überdurchschnittlich viel Regen im Hochsommer.
...
Abbildung 4: Niederschlagssumme verschiedener Zeiträume

 Abbildung 4: 11-jähriger Sonnenfleckenzyklus und
Niederschlagssumme verschiedener Zeiträume
Abbildung 4: 11-jähriger Sonnenfleckenzyklus und
Niederschlagssumme verschiedener Zeiträume
 -
-
...
Mit Abbildung 4 wird die Struktur des Sonnensignals sowohl hinsichtlich des Auftretens in einzelnen Zyklusjahren als auch im Verlauf des Jahres sichtbar.
Das Sonnensignal ist im Juni/Juli wesentlich stärker ausgeprägt als im Zeitraum Mai bis August und dem Gesamtjahr.
Das Signal ist auf die Monate Juni und Juli begrenzt.
Bei der hier nicht dargestellten Betrachtung der Einzelmonate ist das Sonnensignal im Juni stärker ausgeprägt als im Juli.
Schon im vorgelagerten Mai als auch im nachgelagerten August ist es kaum noch erkennbar.
Die jährlichen Ausschläge steigern sich vom Jahr des Sonnenfleckenmaximums bis zur Phase des Fleckenminimums mit den Zyklusjahren 5, 6 und 7.
Ab dem Zyklusjahr 8 verschwindet das Sonnensignal, die Niederschlagssummen bleiben bis zum nächsten Sonnenfleckenmaximum meist auf überdurchschnittlichem Niveau.
Prognosen haben in den Zyklusjahren 3 bis 8 und Monaten Juni/Juli eine hohe Eintrittswahrscheinlichkeit.
Das für Deutschland typische Sonnensignal in der Juni/Juli-Niederschlagssumme erstreckt sich in Europa auf die eher westlich gelegenen Länder von Dänemark über Großbritannien/Irland, Benelux-Länder, Alpenrepubliken, Frankreich und die Iberische Halbinsel.
In den unmittelbar östlich Nachbarschaft ist das Sonnensignal nur etwa halb so stark.
Das Signal ist kaum vorhanden in einem großen Bogen um Deutschland herum von Island über Norwegen, Finnland, Weißrussland, Bulgarien, Rumänien sowie dem zentralen und östlichen Mittelmeerraum.
Übertragungsweg für das Sonnensignal des Schwabezyklus auf unser Wetter
Die hohe Qualität des Sonnensignals in den Juni/Juli-Niederschlagssummen in Abbildung 1 setzt voraus, dass der Impuls der Sonne im Jahr des Fleckenmaximums durch ein festes Zusammenspiel von Planetenstellung, Sonnenaktivität, Vorgängen in der Mesosphäre (50 bis 80 km Höhe), Stratosphäre (12 bis 50 km Höhe) und Troposphäre (bis 12 km Höhe) übertragen wird.
Zu diesem Übertragungsweg gibt es weltweit viele neue Publikationen.
Auch deutsche Forschungseinrichtungen wie das Max-Planck-Institut für Meteorologie in Hamburg [1] oder GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel [2] sind an der Forschung beteiligt.
[1] Geophysical Research Letters
2019-11-20 en Realistic Quasi-Biennial Oscillation Variability in Historical and Decadal Hindcast Simulations Using CMIP6 Forcing[2] Atmospheric Chemistry and Physics
2019-11-20 en Quantifying uncertainties of climate signals related to the 11-year solar cycle.
Part I: Annual mean response in heating rates,temperature and ozoneAus dem Studium der Literatur kann abgeleitet werden, dass die Übertragung des Sonnensignals wahrscheinlich über fünf Ebenen erfolgt:
-
Ebene 1 (vorgeschaltet)
Laufbahn der Planeten im Sonnensystem, die je nach ihrer Stellung das Schwerefeld der Sonne verändern
und damit die Sonnenfleckenaktivität im 11-Jahresrythmus und die Variabilität der UV-Strahlung steuert.
-
Ebene 2
Sonne mit Sonnenflecken, "Sonnenwind" und UV-Strahlung, die das Ozon in der Mesosphäre (50 bis 80 km Höhe) und Stratosphäre (12 bis 50 km Höhe) chemisch-physikalisch beeinflusst.
Die UV-Strahlung variiert während des Sonnenzyklus um ca. 10 Prozent.
-
Ebene 3
Mesophäre und Stratosphäre mit der Ozonchemie und -physik:
je stärker die UV-Strahlung, umso mehr Ozon, umso höher die Temperatur.
Die Ozondynamik wird von der UV-Strahlung gesteuert.
Dadurch verändern sich während des Sonnenzyklus die Temperaturgradienten zwischen Äquator und Polen sowie zwischen verschiedenen Höhen der Atmosphäre.
-
Ebene 4
Quasi-Biennale Oszillation (QBO), die von den Temperaturgradienten in 12 bis 80/nbsp;km Höhe beeinflusst wird.
In der QBO, eine Windzone in 20 bis 40 km Höhe über dem Äquator, wechselt die Windrichtung von Jahr zu Jahr mehr oder weniger regelmäßig von West nach Ost und umgekehrt.
Der Sonnenimpuls wird auf die QBO übertragen, indem die Windrichtung in der QBO im Jahr des Fleckenmaximums in jedem Zyklus von Mai bis Dezember auf Ost dreht.
Der jährliche Windrichtungswechsel (in 20 bis 25 km Höhe) bleibt in den Folgejahren nach eigenen Berechnungen für mehrere Jahre exakt im 12‑Monatsrythmus erhalten, bevor sich der Rhythmus im Verlauf eines jeden Zyklus auf mehr als 12 Monate verlängert.
-
Ebene 5
Zirkulationssystem der Troposphäre mit den wetterbildenden Hoch- und Tiefdruckgebieten, das von der QBO beeinflusst wird.
Der fast jährliche Windrichtungswechsel in der QBO dürfte für das Zick-Zack-Muster in den Niederschlagskurven in den obigen Abbildungen verantwortlich sein.
Fazit
Es gibt unzweifelhaft einen starken Einfluss der Variabilität der Sonne im Rahmen des 11-jährigen Sonnenfleckenzyklus auf unser Wetter,
der wesentlich größer ist als bisher vermutet.
Der Einfluss konzentriert sich auf die Sommermonate Juni und Juli, den Zeitraum höchster Sonneneinstrahlung.
Er zeigt sich in den Niederschlagssumme stärker als in der Sonnenscheindauer oder Temperatur.
Die Niederschlagssumme Juni/Juli reagiert in jedem einzelnen Jahr des Sonnenzyklus unterschiedlich auf die Variabilität der Sonnenstrahlung.
Während der Phase des Sonnenfleckenminimums, in der wir uns zurzeit befinden, betragen die solar verursachten jährlichen Schwankungen der Niederschlagsumme im Juni/Juli 30 bis über 40 Prozent.
Diese Schwankungen haben sich mit hoher Zuverlässigkeit in fast allen 13 Zyklen seit 1883 wiederholt.
Auf Basis dieser Zuverlässigkeit lassen sich für Deutschland Prognosen erstellen.
Prognose für Juni/Juli 2020: Die Niederschlagssumme erreicht nur ca. 80 Prozent des langjährigen Mittels, mit dem Trend zu noch niedrigerem Wert.
Prognose für Juni/Juli 2021: Die Niederschlagssumme erreicht ca. 110 Prozent des langjährigen Mittels.
Diese experimentellen Prognosen sind selbstverständlich ohne Gewähr.
Ziel der Übung ist es, mittelfristige Klimavorhersagen zu entwickeln bzw. zu überprüfen, ob dies möglich ist.
-
|
|
Kommt ein Dürresommer? Sonnenzyklen: Webseiten / Solar cycles / Cycles solaires Wetterphänomene: Niederschläge Wetterphänomene: Sonnenscheindauer |
⇧ 2019
↑ Denkanstöße: Wie macht die Sonne das?
-
Die kalte Sonne (Fritz Vahrenholt & Sebastian Lüning)
2019-09-04 de Denkanstöße: Wie macht die Sonne das?Schauen Sie sich bitte die Graphik unten etwas genauer an.
Die blaue Kurve zeigt die Regenmengen des Monats Februar in Deutschland seit 1900.
In rot ist der Verlauf der Sonnenaktivität dargestellt.
Können Sie einen Zusammenhang erkennen?

 Vergleich der Februarniederschläge in Deutschland mit der
Sonnenaktivität
Vergleich der Februarniederschläge in Deutschland mit der
Sonnenaktivität
Blaue Kurve: Regenmengen des Monats Februar in Deutschland seit 1900.
Rot: Verlauf der Sonnenaktivität

▶Wetter: Wie Veränderungen auf der Sonne unseren Regen beeinflussen
▶Laurenz: Wie Veränderungen auf der Sonne unseren Regen beeinflussen
↑ Wie Veränderungen auf der Sonne unseren Regen beeinflussen
Mit folgendem Link wird von anderen Webseiten auf diese Seite verwiesen.
▶Wetter: Wie Veränderungen auf der Sonne unseren Regen beeinflussen
▶Laurenz: Wie Veränderungen auf der Sonne unseren Regen beeinflussen
-
Die Kalte Sonne / Dr. Ludger Laurenz
2019-02-13 de Wie Veränderungen auf der Sonne unseren Regen beeinflussenPressemitteilung des Instituts für Hydrographie, Geoökologie und Klimawissenschaften (IFHGK) vom 10. Februar 2019:
Wie Veränderungen auf der Sonne unseren Regen beeinflussen
Ein ausgewogenes Maß an Niederschlägen bildet die Grundlage vielfältiger wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Aktivitäten in Europa.
Insbesondere Landwirtschaft, Trinkwasserversorgung und Binnenschifffahrt sind hiervon direkt betroffen.
Allerdings schwanken die Regenmengen stark von Jahr zu Jahr.
Während es in einem Jahr wie aus Kübeln gießt, bleibt im anderen Jahr der Regen oft wochenlang aus.
Die Bevölkerung ist an diese Variabilität gewohnt und weiß in der Regel damit umzugehen.
Aber was steckt hinter den starken Veränderungen?
Gibt es hier irgendeine Systematik oder handelt es sich um pures atmosphärisches Rauschen?
Die Zufallsentdeckung eines Agrarwissenschaftlers aus Münster deutet nun an, dass der Regen in Deutschland und anderen Teilen Europas in gewissen Monaten einem bislang verborgen gebliebenen Muster folgt.
Im Rahmen der Agrarberatung durchforstete Ludger Laurenz die jahrzehntelangen Niederschlagsaufzeichnungen der Wetterstation Münster, wobei ihm besonders im Februar ein ständiges Auf und Ab im 11-Jahresrythmus auffiel.
Nach eingehender Prüfung war klar, dass der Rhythmus eng mit der Aktivität der Sonne korrelierte, dem gut dokumentierten 11-jährigen Sonnenfleckenzyklus.
Laurenz tat sich daraufhin mit zwei Kollegen zusammen, um zu überprüfen, inwieweit das beobachtete Muster aus Münster in anderen Teilen Deutschlands und Europas reproduzierbar ist und ob das Phänomen auch in anderen Monaten existiert.
Horst-Joachim Lüdecke von der Hochschule HTW des Saarlandes besorgte sich daraufhin die gesammelten Niederschlagsdaten Europas seit Beginn des 20. Jahrhunderts.
Der emeritierte Physiker entwickelte einen Rechner-Algorithmus, mithilfe dessen die Ähnlichkeit der Veränderungen im Regen und der Sonnenaktivität bestimmt wurde.
Alle 39 europäischen Länder und alle 12 Monate eines Jahres wurden über insgesamt 115 Jahre anhand mathematischer Korrelationen quantifiziert.
Um mögliche Verzögerungseffekte mit einzuschließen, wurden die Datenreihen von Regen und Sonnenflecken dabei auch systematisch auf Verschiebungen hin überprüft.
Dazu wurden die Zeitreihen wie Kämme zeitlich gegeneinander schrittweise verschoben und die jeweilige Veränderung des Korrelationsmaßes notiert.
Die auf diese Weise erhaltenen mehrdimensionalen Daten wurden vom Geowissenschaftler Sebastian Lüning auf systematische Trends hin ausgewertet und kartographisch visualisiert.
Lüning ist mit dem schweizerischen Institut für Hydrographie, Geoökologie und Klimawissenschaften (IFHGK) assoziiert und hat sich auf die Erforschung solarer Klimaeffekte spezialisiert.
Die auskartierten Ergebnisse zeigen, dass die ursprünglich in Münster entdeckte Verknüpfung von Februar-Niederschlägen und der Sonnenaktivität für weite Teile Mitteleuropas und Nordeuropas Gültigkeit und dort sehr hohe statistische Signifikanz besitzt.
In Richtung Südeuropa schwächt sich die Korrelation hingegen deutlich ab.
Die statistische Untersuchung konnte zudem systematische Phasenverschiebungen über den Kontinent hinweg nachweisen.
In Deutschland und Nachbarländern waren die Februar-Niederschläge jeweils besonders gering, wenn die Sonne vier Jahre zuvor sehr stark war.
Die Verzögerung scheint über die langsame Tiefenzirkulation des Atlantiks zustande zu kommen, wie frühere Arbeiten andeuten.
Auf Basis des statistisch-empirisch ermittelten Zusammenhangs lässt sich nun auch der besonders niederschlagsarme Februar 2018 in Deutschland erklären, der einer besonders hohen Intensitätsspitze der Sonnenaktivität Anfang 2014 folgte.
Ähnliche Zusammenhänge zwischen Regen und Sonnenaktivität ließen sich in abgeschwächter Weise auch in einigen anderen Monaten feststellen, insbesondere im April, Juni und Juli, was einen Großteil der Vegetationsperiode in Mitteleuropa ausmacht.
Es entstand ein komplexes Bild des Zusammenspiels von Sonne und Regen in Europa, welches deutliche Trends über 1000 km hinweg erkennen ließ und von Monat zu Monat teils stark variierte.
Die Studie erhärtet damit das Konzept einer solaren Beteiligung an der europäischen hydroklimatischen Entwicklung, was sich bereits aus einer ganzen Reihe von lokalen Fallstudien anderer Autoren angedeutet hatte.
Der genaue Mechanismus, mit dem das Sonnensignal Einfluss auf die Niederschläge nimmt, ist jedoch noch weitgehend unklar und erfordert weitere Forschungsbemühungen.
Der nun erstmals flächenmäßig über Europa auskartierte solare Niederschlagseffekt eröffnet neue Möglichkeiten für eine verbesserte Mittelfrist-Vorhersage von Niederschlägen.
Insbesondere die Landwirtschaft, aber auch die Abwehr von Extremwetterschäden im Zusammenhang mit Starkregen und Dürren könnten davon profitieren.
Nächster Schritt bei der Verfeinerung der Vorhersagemethodik ist eine genauere Quantifizierung von Effekten durch atlantische Ozeanzyklen, die für das Regengeschehen speziell in Westeuropa ebenfalls eine wichtige Rolle spielen.
Originalpublikation:
▶
en
Influence of solar activity on European rainfall
Laurenz, L., H.-J. Lüdecke, S. Lüning (2019)
J. Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics,
185: 29-42, doi: 10.1016/j.jastp.2019.01.012
⇧ 2017
↑ en Closely Coupled: Solar Activity and Sea Level
-
Watts Up With That? (Antony Watts)
David Archibald
2017-07-03 en Closely Coupled: Solar Activity and Sea Level
⇧ 2010
↑ en Lake Victoria Water Level and Sunspot Number
-
Climate Change Science
2010-12-09 en Lake Victoria Water Level and Sunspot Number (Wayback‑Archiv)
-
Journal of South African Institution of Civil Engineering
2007-06 en Linkages between solar activity, climate predictability and water
resource development
Linkages between solar activity, climate predictability and water
resource development
- Pensée unique fr Corrélation entre les quantités de pluies en Afrique du Sud et les éruptions solaires
⇧
B Mengen
en Quantities
fr Quantités
↑ Niederschläge 1900-2000
- hamburger-bildungsserver.de de Änderung der globalen Niederschläge über Land 1900-2000 im Vergleich zur Periode 1981-2000
⇧
C Extreme
en Extreme
fr Extrêmes
↑
Extremniederschläge, Starkregen
en Heavy precipitation
2016
↑ Universität Leipzig: Klimawandel hat sich bisher noch nicht auf den Durchschnittswert der globalen Niederschlagsmenge ausgewirkt>
-
Die kalte Sonne (Fritz Vahrenholt & Sebastian Lüning)
2016-07-01 de Universität Leipzig: Klimawandel hat sich bisher noch nicht auf den Durchschnittswert der globalen Niederschlagsmenge ausgewirkt
↑
Dresdner Max-Planck-Institut: Kopplung von
Extremniederschlägen an Klimaerwärmung offenbar schwächer
als befürchtet
en
On the detection of precipitation dependence on temperature
-
Die kalte Sonne (Fritz Vahrenholt & Sebastian Lüning)
2016-06-10 de Dresdner Max-Planck-Institut: Kopplung von Extremniederschlägen an Klimaerwärmung offenbar schwächer als befürchtet
-
Geophysical Research Letters
2016-05-16 en On the detection of precipitation dependence on temperature
2012
↑
Überraschung: Globale Niederschläge sind in den letzten 70 Jahren
weniger extrem geworden
en
Changes in the variability of global land precipitation
-
Die kalte Sonne (Fritz Vahrenholt & Sebastian Lüning)
2012-12-08 de Überraschung: Globale Niederschläge sind in den letzten 70 Jahren weniger extrem geworden
-
GRL Geophysical Research Letters
2012-09-28 en Changes in the variability of global land precipitation
2011
↑ Eine entfesselte Flut ... schlechter Wissenschaft
-
Klimaskeptiker Info
2011-02-20 de Eine entfesselte Flut ... schlechter Wissenschaft Über die Behauptung, ein CO2-Anstieg führe zu einer Zunahme von Extremwetterereignissen wie Starkregen
-
Watts UP With That? (Antony Watts)
2011-02-20 en Nature Unleashes a Flood ... of Bad Science.
↑
D de
Modelle
en Modelle
fr Modelles
↑
d Klimamodelle rekonstruieren Niederschlagsentwicklungen nur mit gröbsten
Fehlern
en
Ooops! Another big failure of the climate models - rainfall did not
increase
-
Die kalte Sonne (Fritz Vahrenholt & Sebastian Lüning)
2017-12-24 de Studie: Zwei Drittel aller Klimamodelle unterschätzen NiederschlagsmengenRegen ist lebensnotwendig für Menschen, Tiere und Pflanzen.
Umso wichtiger ist die korrekte Prognose der Niederschlagsentwicklung.
Gerne werden hierzu theroretische Klimamodelle herangezogen.
Bartlein et al. zeigten im September 2017 am Beispiel der Niederschläge Eurasiens vor einigen Jahrtausneden, dass selbst grundlegende Prozesse offenbar noch vollkommen unverstanden sind:
Underlying causes of Eurasian midcontinental aridity in simulations of mid-Holocene climate
Eine NASA-Studie untersuchte die Prognoseleistung von 23 Modellen für den Zeitraum 1995-2005 und fand, dass mehr als zwei Drittel aller Modelle die real gemessenen Regenmengen unterschätzt hatten. Kein richtig gutes Ergebnis, das Vertrauen in die Vorhersagekraft der Klimamodelle stärken würde.
Study: Climate models have been estimating rainfall incorrectly this whole time
Siehe Bericht auf The Daily Caller aus dem Juni 2017:
Study: Climate Models Have Been Estimating Rainfall Incorrectly This Whole Time
-
EIKE Europäisches Institut für Klima und Energie
2016-04-20 de Klimamodelle rekonstruieren Niederschlagsentwicklungen nur mit gröbsten FehlernWas seit längerem kein Geheimnis ist, wird immer öffentlicher.
Die Klimamodelle können Niederschlag nur ungenau simulieren.
Eigentlich kein Wunder, nachdem dies bereits für die Temperatursimulationen festgestellt wurde, welche bisher (noch) als relativ sicher galten.
Wenn sich das erhärtet - was nicht unwahrscheinlich ist - fällt bald das ganze Simulationsgebäude des Klimawandels und auch das dogmatische Klimamärchen, dass es in der Vergangenheit keine größeren Schwankungen gegeben hätte in sich zusammen.
-
Watts UP With That? (Antony Watts)
2016-04-06 en Ooops! Another big failure of the climate models - rainfall did not increase
↑
E de
Länder
en Countries
fr Pays
- a de Deutschland
- b de Frankreich
- c de England & Wales
- d de Italien
- e de Marokko
- f de USA
↑ a Deutschland
de Verzeichnis en Contents fr Sommaire
- 2018
- de Beeinflussungen durch Starkregen nehmen in Deutschland nicht zu. Mit schlecht angewandter Statistik lässt sich aber das Gegenteil "zeigen" (Teile 1 & 2)
- 2017
- de Starkregen in Deutschland ohne Langzeittrend: 15 Jahre sind kein Klima
- 2016
- de Deutscher Klimaatlas bringt es ans Licht: Berliner Zeitung liegt bei alarmistischer Regenstory voll daneben
- de
Deutscher Wetterdienst:
Es gibt in Deutschland keinen Trend zu heftigeren Regenfällen - de Hintergründe der Unwetter in Süddeutschland. Vergleich von Braunsbach und Niederalfingen
- 2015
- de Klimabericht des Umweltbundesamtes (UBA) zu Deutschland: Kein statistisch gesicherter Anstieg extremer Niederschläge oder von Trockenperioden
de Text en Text fr Texte
⇧ 2018
↑ Beeinflussungen durch Starkregen nehmen in Deutschland nicht zu. Mit schlecht angewandter Statistik lässt sich aber das Gegenteil "zeigen" (Teile 1 & 2)
-
EIKE Europäisches Institut für Klima und Energie
Helmut Kuntz
2018-04-18 de Beeinflussungen durch Starkregen nehmen in Deutschland nicht zu. Mit schlecht angewandter Statistik lässt sich aber das Gegenteil "zeigen" (Teil 1)Der Deutsche Wetterdienst und unsere Medien sind beim Verkünden von Klimawandel-Apokalypsen immer vereint.
Zwar behauptete unsere Sprechpuppe Bundeskanzler, "seine" Untertanen müssen öffentlichen Vertretungen und Medien blind glauben, alle anderen erzählen Lügen: [4]
"Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier beobachtet eine "epidemische Verbreitung" von organisierten Lügen durch soziale Netzwerke ...
Überprüfbare Fakten müssten sich heute zunehmend gegen falsche und gefühlte Wahrheiten behaupten ---
"Meinungsfreiheit ist eine Farce", zitiert er Hannah Arendt, wenn schlichte Tatsachen nicht mehr anerkannt würden.
Oder: "Wie sollen wir die realen Probleme, zum Beispiel den Klimawandel, angehen", fragt der Bundespräsident, "wenn andere die wissenschaftlichen Fakten bestreiten?" ...
Doch warum Herr Steinmeier so ungern vor der eigenen Türe kehrt und seine Untertanen auf Netzwerke - wie zum Beispiel EIKE - angewiesen sind, um Wahrheiten zu erfahren, sei anbei anhand einer kürzlich erfolgten Meldung zu Wetterextremen gezeigt.
Im ersten Teil wird anhand des KLIWA Umwelt Monitoringberichtes 2016 gezeigt, dass die darin getätigten Aussagen zum Starkniederschlag falsch sind und diese sowohl im Sommer (wie darin berichtet), aber auch im Winterhalbjahr abnehmen.
-
EIKE Europäisches Institut für Klima und Energie
Helmut Kuntz
2018-04-18 de Beeinflussungen durch Starkregen nehmen in Deutschland nicht zu. Mit schlecht angewandter Statistik lässt sich aber das Gegenteil "zeigen" (Teil 2)In diesem zweiten Teil wird anhand von Betrachtungen zu historischen Daten und Verläufen gezeigt, dass diese Abnahme bereits seit vielen Jahrhunderten stattfindet.
Es wird aber auch gezeigt, wie Professoren aus "Gefälligkeit" das Gegenteil berichten.
⇧ 2017
↑ Starkregen in Deutschland ohne Langzeittrend: 15 Jahre sind kein Klima
-
Die kalte Sonne (Fritz Vahrenholt & Sebastian Lüning)
2017-02-01 de Starkregen in Deutschland ohne Langzeittrend: 15 Jahre sind kein KlimaUnerwartete Einlassungen eines DWD-Mannes in der Mittelbayerischen Zeitung am 1. Dezember 2016:
Fussball: Spielabsagen: Der Klimawandel schlägt zu
Meteorologe: "Erderwärmung führt zu heftigeren Gewittern."
Die größten Gefahren für Fußballer seien aber Hitze und Blitze.Was ist an der Behauptung von Andreas Friedrich dran?
Zunächst einmal fällt auf, dass Friedrich eine Zeitspanne von lediglich 15 Jahren aufführt die nicht einmal das Klimawandelkriterium von mindestens 30 Jahren erfüllt.
Aufgrund der enormen natürlichen Variabilität kann man an einer Datenreihe von lediglich anderthalb Jahrzehnten gar keine Aussagen zum Klimawandel tätigen.
Ob Andreas Friedrich dies bewusst war als er sich äußerte?
Auf der Suche nach robusteren und längeren Daten werden wir beim DWD selber fündig.
In einem Bericht von 2014 stellte der DWD fest, dass es in Deutschland keinen belastbaren Trend zu verstärkten Niederschlägen gibt (Abb. 1).
Auch das Umweltbundesamt kann bisher keinen robusten Trend bei den
Starkregen-Ereignissen erkennen.
Siehe unseren Blogbeitrag
Es ist unklar, weshalb sich der Meteorologe Friedrich gegen DWD und UBA stellt und das glatte Gegenteil behauptet.

 Quelle:
DWD.
Quelle:
DWD.

Zur Klärung der Diskrepanz haben wir Kontakt zu Herrn Friedrich aufgenommen.
Er antwortete dankenswerterweise umgehend:
Wir haben nachgehakt:
Herr Friedrich antwortete am 31.1.2017:
Da schauen wir doch gerne einmal rein.
Zunächst stöbern wir in diesem Dokument vom 8. März 2016:
Am Ende der Seite 1 der entscheidende Satz:
Da [die radarbasierte Niederschlagsklimatologie] mit aktuell 15 Jahren aber nur einen eher kurzen Zeitraum repräsentiere, sei es aus klimatologischer Sicht noch nicht möglich zu bewerten, ob sich zum Beispiel die Häufigkeit extremer Niederschläge in diesem Zeitraum verändert habe.
Nun ist klar:
DWD-Mann Andres Friedrich war hier auf eigene Rechnung unterwegs, abseits der offiziellen DWD-Aussagen.
Der von ihm behauptete Klimatrend zu mehr Starkregen in Deutschland in den letzten 15 Jahren existiert nicht und wird in den von ihm angeführten Quellen mit keiner Silbe erwähnt.
Was steck hinter der Aktion?
⇧ 2016
↑ Deutscher Klimaatlas bringt es ans Licht: Berliner Zeitung liegt bei alarmistischer Regenstory voll daneben
-
Die kalte Sonne (Fritz Vahrenholt & Sebastian Lüning)
2016-07-24 de Deutscher Klimaatlas bringt es ans Licht: Berliner Zeitung liegt bei alarmistischer Regenstory voll daneben
↑
Deutscher Wetterdienst:
Es gibt in Deutschland keinen Trend zu heftigeren Regenfällen
-
Die kalte Sonne (Fritz Vahrenholt & Sebastian Lüning)
2016-06-08 de Deutscher Wetterdienst:
Es gibt in Deutschland keinen Trend zu heftigeren Regenfällen
↑ Hintergründe der Unwetter in Süddeutschland. Vergleich von Braunsbach und Niederalfingen
-
EIKE Europäisches Institut für Klima und Energie
Josef Kowatsch
2016-06-06 de Hintergründe der Unwetter in Süddeutschland. Vergleich von Braunsbach und NiederalfingenFür das ZDF stand der Schuldige insbesondere bei dem Ort Braunsbach für die Unwetterkatastrophe am 29. Mai in Baden-Württemberg bald fest:
Es war der Klimawandel.
Angeblich als Folge davon verhaken sich die Tiefdruckgebiete an Ort und Stelle und die wärmere Luft enthalte viel mehr Wasserdampf, der dann örtlich runterkäme.
⇧ 2015
↑ Klimabericht des Umweltbundesamtes (UBA) zu Deutschland: Kein statistisch gesicherter Anstieg extremer Niederschläge oder von Trockenperioden
-
Die kalte Sonne (Fritz Vahrenholt & Sebastian Lüning)
2015-06-30 de Klimabericht des Umweltbundesamtes (UBA) zu Deutschland: Kein statistisch gesicherter Anstieg extremer Niederschläge oder von Trockenperioden
↑ b Frankreich
-
Die kalte Sonne (Fritz Vahrenholt & Sebastian Lüning)
2013-03-08 de Extremregen war in den Französischen Alpen während der Kleinen Eiszeit häufiger als heute
↑ c England & Wales
-
Simpson & Jones
2013 en Analysis of UK precipitation extremes derived from Met Office gridded data
↑ d Italien
-
Die kalte Sonne (Fritz Vahrenholt & Sebastian Lüning)
2013-06-25 de Kein Anstieg der extremen Niederschläge in Norditalien während der vergangenen 90 Jahre
↑ e Marokko
-
Die kalte Sonne (Fritz Vahrenholt & Sebastian Lüning)
2013-06-26 de Extreme Regenfälle in Marokko während der letzten 50 Jahre nicht häufiger geworden
↑ f USA
-
Real Science
2015-07-09 en Cherry Picking For Fun And Profit
⇧
6 Auswirkungen auf Hochwasser/Überschwemmungen
en Impacts on floods
fr Impact sur les inondations
Mit folgenden Links wird von anderen Webseiten auf diese Seite verwiesen:
| de | en | fr |
|---|---|---|
|
Wetterphänomene Auswirkungen auf Hochwasser/Überschwemmungen |
Weather phenomena Impacts on floods |
Phénomènes météorologiques Impact sur les inondations |
Links zur Klimaschau
|
|
▶Hochwasser |
- Verzeichnis │ Allgemein │ Übersicht │ Flüsse │ Talsperren │ Regenmengen │ Text
⇧ de Verzeichnis en Contents fr Sommaire
- 2022
- de
 Die Nacht, als die Flut kam - Protokoll einer Klimakatastrophe
Die Nacht, als die Flut kam - Protokoll einer Klimakatastrophe
ARTE (2022-07-02) - 2021
- de
Extremwetterkongress: Experten warnen vor Kosten
des Klimawandels
NDR (2021-09-24)
Allein die Kosten der Flut im Ahrtal würden mit rund 30 Milliarden Euro angegeben.
Jeder in den Klimaschutz gesteckte Euro spare 15 Euro Klimaschäden ein, sagte Kemfert.
- de
Klimareport: Hamburg hat Klimaziel von 1,5 Grad schon gerissen
NDR (2021-09-23)
Jetzt kann man es mit Zahlen belegen
Der Klimawandel ist auch in Hamburg deutlich erkennbar.
In den letzten 140 Jahren ist die Temperatur im Jahresmittel insgesamt schon um 1,7 Grad gestiegen.
Damit hat die Hansestadt laut dem Report das Pariser Klimaziel von 1,5 Grad, gerechnet von der Industrialisierung bis heute, bereits überschritten.
Rechne: 1,7 Grad duch 140 Jahre = 0,012 Grad pro Jahr = 0,12 Grad in 10 Jahren
Zunahme: seit 1880 bis 2100 um 2,67 °C
Bemerkung: Ohne Berücksichtigun des Wärmeinsel-Effektes dieses Standortes.
Deutschlandweit sieht es ähnlich aus:
Hier liegt der Wert bei 1,6 Grad,
Rechne: 1,6 Grad duch 140 Jahre = 0,0114 Grad pro Jahr = 0,114 Grad in 10 Jahren
Zunahme: seit 1880 bis 2100 um 2,51 °C
Bemerkung: Ohne Berücksichtigung der Wärmeinsel-Effekten der vielen neuen Standorte.
weltweit nur bei 1,1 Grad.
Rechne: 1,1 Grad duch 140 Jahre = 0,008 Grad pro Jahr = 0,08 Grad in 10 Jahren
Zunahme: seit 1880 bis 2100 um 1,73 °C
Bemerkung: Auch in dieser Berechnung wurden keine Wärmeinsel-Effekte berücksichtigt.
- de
 Klimaerwärmung gestoppt? Eisschmelze am Nordpol ist ausgebremst!
Klimaerwärmung gestoppt? Eisschmelze am Nordpol ist ausgebremst!
Wetternet (2021-09-22) - de
 Flutkatastrophe Deutschland:
"Flut-Bericht der Politik stimmt nicht!"
Bild (2021-09-20)
Flutkatastrophe Deutschland:
"Flut-Bericht der Politik stimmt nicht!"
Bild (2021-09-20)CSU-Innenexperte Michael Kuffer (49) zu BILD:
"Die Familien von 183 Todesopfern und 800 Verletzten müssen das als puren Hohn empfinden!"
Katharina (37, Büroangestellte) und Thomas Dederich (39) aus Walporzheim:
Die Alarmierung am 14. Juli hat absolut nicht funktioniert.
Dieses Versagen war das schlimmste.
90 Prozent der Hilfe kam dann von Freiwilligen.
Es gibt hier Menschen, die zu Hause nicht essen oder duschen können.
Es ist immer noch eine Katastrophe und wir finden, so sollte man das auch behandeln."
- de
BaFin befürchtet für Versicherer Kosten von bis
zu 8,2 Milliarden Euro
FAZ (2021-09-15) - de
Bis zu 30 Milliarden Euro:
Bundesrat billigt Hilfen für Hochwasserregionen
FAZ (2021-09-10) - en
 California: How the Flood Risk Management System Works
California: How the Flood Risk Management System Works
Sacramento District (2021-09-02) - de
Hochwasser als Ankündigung und Charakteristikum der Kleinen Eiszeit?
Axel Robert Göhring / EIKE (2021-08-30) - de
Eine theologische Tagung beschäftigt sich mit dem Klimawandel
 Worauf noch hoffen in dieser Zeit?
Worauf noch hoffen in dieser Zeit?
Domradio (2021-08-28) - de
 Leben nach der Flut - Wo kann man wieder bauen? |
Zur Sache Rheinland-Pfalz
Leben nach der Flut - Wo kann man wieder bauen? |
Zur Sache Rheinland-Pfalz
SWR (2021-08-27) - de
Klimawandel, Flut an Ahr und Erft -
und die Frage nach dem Verschulden
Und solche Unwetter wie Mitte Juli hätten dann eine kürzere Wiederkehrzeit:
 nicht mehr 400 Jahre im statistischen Mittel, sondern eher 300.
nicht mehr 400 Jahre im statistischen Mittel, sondern eher 300.
Deutschlandfunk (2021-08-24) - de
Anzeige gegen Wupperverband: Hätte früher Platz
in Talsperren geschaffen werden können?
Wären die Überschwemmungen in der Hansestadt, als Wupper, Hönnige und Gaulbach zahlreiche Wohnungen, Firmengebäude und Keller unter Wasser setzten, vermeidbar gewesen?
Hätte der Wupperverband früher reagieren und mehr Platz in den Talsperren schaffen können?
Oberbergischer Anzeiger (2021-08-24) - de
 Tichys Ausblick -
"Flutkatastrophe und Klimawandel -
Große Sprüche, keine Taten"
Tichys Ausblick -
"Flutkatastrophe und Klimawandel -
Große Sprüche, keine Taten"
TV Berlin (2021-08-19) -
de
 Wie die Politik Ahrweiler instrumentalisiert
EIKE (2021-08-16)
Wie die Politik Ahrweiler instrumentalisiert
EIKE (2021-08-16) Nachdem die heißen Sommer mit Dürre ausfielen, nutzten
Medien und Politiker sogleich das Hochwasser als Beweis für den
menschgemachten Klimawandel.
Nachdem die heißen Sommer mit Dürre ausfielen, nutzten
Medien und Politiker sogleich das Hochwasser als Beweis für den
menschgemachten Klimawandel.
- de
 Warnung vor Gefahren?
Aber wie? DWD APP, NINA + Insiderinfos Ahrtal
Warnung vor Gefahren?
Aber wie? DWD APP, NINA + Insiderinfos Ahrtal
TV Berlin (2021-08-13) - de
Extremhochwasser und Hunderte Tote an der deutschen Ahr
- seit 1348 aufgezeichnet
Textatelier (2021-08-09) - de
 "Hier wurde gar keiner gewarnt": Rekonstruktion der
Flut im Ahrtal
"Hier wurde gar keiner gewarnt": Rekonstruktion der
Flut im Ahrtal
Eine Rekonstruktion der Flutnacht und die Suche nach einem Verantwortlichen.
Der Spiegel (2021-08-10) - de
 Vor und nach der Flut 2021:
Die Ahr-Rotweinstraße von Altenahr nach Dernau
Vor und nach der Flut 2021:
Die Ahr-Rotweinstraße von Altenahr nach Dernau
Bastifbr (2021-08-08) - de
 "Hier ist Ingenieurskunst gefragt"
"Hier ist Ingenieurskunst gefragt"
Gleichzeitig bin ich erstaunt, dass entsprechende Hochwasser-Schutzmaßnahmen nicht getroffen wurden,
obwohl sie schon seit 100 Jahren im Gespräch sind,
denn seit Jahrhunderten ist es im Abstand von etwa 100 Jahren immer wieder zu katastrophalen Fluten gekommen.
Dazu zählen Maßnahmen wie Hochwasser-Rückhaltebecken, die insgesamt 11,3 Millionen Kubikmeter Wasser hätten zurückhalten können.
Tagesschau.de (2021-08-08) - de
Wenn eine volle Talsperre wichtiger ist als Flutschutz
Die Flut im Tal der Wupper wurde durch das Versagen des Talsperren-Managements zur Katastrophe.
Aus dem Flutereignis von 2002 in Sachsen hatte in Westdeutschland niemand lernen wollen.
Ob sich das nun ändert, dafür gibt es ein klares Kriterium.
Klimareporter (2021-08-08) -
de
 Flutkatastrophe: Totalversagen der Klimawandel-Propheten
Fred F. Mueller/Eike (2021-08-07)
Flutkatastrophe: Totalversagen der Klimawandel-Propheten
Fred F. Mueller/Eike (2021-08-07) Angesichts von vermutlich mehr als 200 Toten und tausender
vernichteter Existenzen ist jetzt nicht der Moment für
freundliche Worte.
Angesichts von vermutlich mehr als 200 Toten und tausender
vernichteter Existenzen ist jetzt nicht der Moment für
freundliche Worte.
- de
Hochwasser im Juli: Bewährungsprobe für den Schweizer
Hochwasserschutz
Die anhaltenden und starken Niederschläge im Juli haben in weiten Teilen der Schweiz zu Hochwasser geführt.
Das Bundesamt für Umwelt (BAFU) verzeichnete an seinen hydrologischen Messstationen neue Rekordwerte für den Neuenburger- und Bielersee.
Die von Bund, Kantonen und Gemeinden ergriffenen Massnahmen zum Hochwasserschutz haben sich bewährt:
Es gab keine Opfer zu beklagen und trotz Überschwemmungen halten sich die Hochwasserschäden nach ersten Einschätzungen in Grenzen.
Schweizerische Eidgenossenschaft (2021-08-06) - de
Drei Wochen nach der Hochwasser-Katastrophe
"Total im Stich gelassen": Ahrweilers Flutopfer kochen vor Wut über mangelnde Hilfe
Focus Online (2021-08-06) - de
Ermittlungen gegen Landrat von Ahrweiler
Tagesschau.de (2021-08-06) -
de

 Die verheerende Flut in Ahrweiler -
eine Video-Rekonstruktion des Hochwassers
Die verheerende Flut in Ahrweiler -
eine Video-Rekonstruktion des Hochwassers
 Wir zeigen Wetterdaten, Satellitenbilder und Zeugenvideos, um besser
zu verstehen, wie es zur tödlichen Flut kommen konnte.
Wir zeigen Wetterdaten, Satellitenbilder und Zeugenvideos, um besser
zu verstehen, wie es zur tödlichen Flut kommen konnte.
In der Vorhersage prognostiziert der Deutsche Wetterdienst Überflutungen in Rheinland-Pfalz.
Sprecher: «Lokal sind nach aktuellem Stand sogar Mengen bis 200 Liter pro Quadratmeter nicht ausgeschlossen.
Das bedeutet natürlich auch in dieser Region: Überflutungen.»
Für die Berechnung der Überflutungsgefahr wurden historische Hochwasser im Ahrtal aus den Jahren 1804 und 1911 nicht berücksichtigt.
NZZ (2021-08-06)
 Pegel Altenahr 1804 und 1911 nicht berücksichtigt
Pegel Altenahr 1804 und 1911 nicht berücksichtigt

grau: Maximaler Abflusss,
orange: Abfluss Mittelwert,
blau: Minimale Abfluss
- de
 Die Müllflut - Schuttentsorger im Ahrtal
Die Müllflut - Schuttentsorger im Ahrtal
SWR (2021-08-06) - de
 Hochwasser im Ahrtal: Déjà-vu der Katastrophe
Hochwasser im Ahrtal: Déjà-vu der Katastrophe
 Die früheste Erwähnung eines Ahr-Hochwassers datiert bereits
auf das Jahr 1348.
Die früheste Erwähnung eines Ahr-Hochwassers datiert bereits
auf das Jahr 1348.
FAZ (2021-08-05) - de
 Organisationschaos im Krisengebiet? | Report Mainz
Organisationschaos im Krisengebiet? | Report Mainz
ARD (2021-08-04) - de
 REPORT MAINZ vom 3. August 2021
REPORT MAINZ vom 3. August 2021
ARD (2021-08-03) - de
 Wer zahlt? Und wer ist schuld? - Die Aufarbeitung der Flut
Wer zahlt? Und wer ist schuld? - Die Aufarbeitung der Flut
Spiegel TV (2021-08-03) - de
Hitzewellen und Unwetter:
"Das ist Wetter, das aus Klimaveränderungen resultiert"
 Wochenlange Hitze oder wochenlang Tiefdruckgebiete und Regen -
solche Wetterszenarien werden wir in den kommenden Jahren deutlich
häufiger erleben, sagte die ARD-Wetterexpertin Claudia Kleinert.
Wochenlange Hitze oder wochenlang Tiefdruckgebiete und Regen -
solche Wetterszenarien werden wir in den kommenden Jahren deutlich
häufiger erleben, sagte die ARD-Wetterexpertin Claudia Kleinert.
Deutschlandfunk (2021-08-03) - de
Einschläge des Klimawandels oder eher eklatantes Staats-
und Behördenversagen?
Helmut Kuntz / EIKE (2021-07-30)
Wenn Leitkommentare die Unkenntnis, aber auch die Ideologiefestigkeit der Kommentierenden offenlegen
Oft nimmt die Berichterstattung der Lokalzeitung geradezu groteske Züge an und die Leitkommentare der Redaktion überschlagen sich geradezu mit der Bestätigung und Bekräftigung der "offiziell vorgegebenen" - GRÜNEN - Meinung.
Als Folge bekommt die Redaktion vom Autor ab und zu eine Stellungnahme, um zu zeigen, dass es noch Leser gibt, welche nicht wie die Redaktion, der dpa, unserer Obrigkeit und Annalena bis zur heiligen Greta alles blind glauben.
Diesmal bezieht sich die Stellungnahme auf zwei Leitkommentare in der Zeitung:
FN vom 16. Juli 2021, Kommentar
"Wenn Wetter lebensgefährlich wird"
und NN vom 17. Juli 2021
"Klima-Katastrophen zwingen uns zum Handeln",
darin Kommentar zu Wetter-Extremen:
"Es muss viel mehr passieren für den Klimaschutz"
Während (nicht nur) die NN-Redaktion die Ursachen der jüngsten Fluten vorwiegend dem angeblich alleine vom Menschen verursachten , sich stetig wandelndem Klima zuordnet, waren beide Fluten im klimahistorischen Kontext zwar seltene, aber trotzdem "erwartbare" Ereignisse.
Dazu kommt, dass beide Fluten mit ihren Schadenshöhen wieder eklatante Versäumnisse - eher Versagen - der Behörden im präventiven Hochwasserschutz offen legten.
- de
Winzer im Ahrtal schwer getroffen
Tagesschau (2021-07-30) - de
Kosten könnten zehn Milliarden Euro betragen
Tagesschau (2021-07-30) - de
Warum kam die Warnung so spät?
Tagesschau (2021-07-29) - de
Nach der Flutkatastrophe:
Schweigemoment und Seuchengefahr
Tagesschau (2021-07-29) - de
Nach dem Hochwasser: Schwere Vorwürfe gegen den Wupperverband
Kalte Sonne (2021-07-29) - de
Warnungen vor Extremwetter - Klimawandel - Grüne Scheinheiligkeit
Das Hochwasser in Europa Mitte Juli aus amerikanischer Sicht.
Eike (2021-07-29) - de
 Kältewelle im August!
Temperatursturz mitten in den Hundstagen.
Keine Sommerhitze in Sicht!
Kältewelle im August!
Temperatursturz mitten in den Hundstagen.
Keine Sommerhitze in Sicht!
Dominik Jung (2021-07-28) - de
Der falsche Fokus auf den Klimawandel
Thomas Mayer (Welt) 2021-07-28) - de
Hochwasser: Die CO₂-Panikmache und die Wahrheit
Ruhrkultour (2021-07-27)
 Herr Latif, als einer der prominentesten unter ihnen, hat im
FAZ-Interview unter Bezug auf die Katastrophe in Ahrweiler ausgesagt:
Herr Latif, als einer der prominentesten unter ihnen, hat im
FAZ-Interview unter Bezug auf die Katastrophe in Ahrweiler ausgesagt:
"Es gab bisher materielle Schäden.
Jetzt sterben viele Menschen.
Das war vorher nur in Entwicklungsländern so.
Wenn wir noch die anderen Extreme betrachten, wie zum Beispiel die Hitzewellen mit Rekordtemperaturen, verlassen wir als Menschheit gerade den Wohlfühlbereich.
So langsam wird es gefährlich und ich habe manchmal das Gefühl, die Politik begreift es nicht."
- de
Zwischen Hoffnung, Wut und Trauer: Das Leben nach der Flut
Spiegel TV (2021-07-27) - de
 Nach der Flut: Sie haben alles verloren
Nach der Flut: Sie haben alles verloren
WDR Doku (2021-07-27) - de
 Das Totalversagen der Behörden!
Wetterkarten beweisen:
Extrem-Unwetter war seit Tagen bekannt!
Das Totalversagen der Behörden!
Wetterkarten beweisen:
Extrem-Unwetter war seit Tagen bekannt!
Dominik Jung (2021-07-27) -
de
 Bad Neuenahr-Ahrweiler:
Landesamt sah den Pegelstand von sieben Metern um 20 Uhr voraus
- Evakuierungsaufruf erfolgte um 23.09 Uhr
Rhein Zeitung (2021-07-27)
Bad Neuenahr-Ahrweiler:
Landesamt sah den Pegelstand von sieben Metern um 20 Uhr voraus
- Evakuierungsaufruf erfolgte um 23.09 Uhr
Rhein Zeitung (2021-07-27)Gegen 20.45 Uhr wurde demnach der Pegel in Altenahr beim Stand von 5,75 Metern von den Fluten weggerissen.
Auf wie viele Meter die Ahr in dieser verheerenden Katstrophennacht tatsächlich anschwoll, muss das Landesamt noch exakt auswerten.
Um 17.17 Uhr rief das Landesamt für Umwelt schließlich die höchste Warnstufe "lila" aus.
Tatsächlich hatte der Deutsche Wetterdienst (DWD) seine Prognosen für den Pegel Altenahr am frühen Abend kurzeitig gesenkt, dies aber rasch wieder revidiert, wie Recherchen unserer Zeitung ergaben.
Doch bei den Verantwortlichen vor Ort kam diese Korrektur offenbar nicht zeitnah an.
Nach 19.09 Uhr herrschte jedenfalls kollektives Aufatmen im Krisenstab.
Etwa zu der Zeit stieß dann auch Innenminister Roger Lewentz (SPD) zur technischen Einsatzleitung hinzu.
Einen Anlass, die Bevölkerung aus dem Gebiet zu evakuieren, sah man jedenfalls nicht.
"Auch Minister Lewentz hatte keine andere Einschätzung", betonte Pföhler am Sonntag.
Die Folgen waren fatal, denn der Pegel in Altenahr sank nicht.
Ganz im Gegenteil:
Er überschritt sogar die zuvor prognostizierten fünf Meter und schnellte in nicht mal zwei Stunden auf 5,75 Meter hoch.
- de
Hochwasser Juli 2021: Intensive Niederschläge führten
verbreitet zu Überschwemmungen
Schweizerische Eidgenossenschaft (2021-07-26) - de
Umweltbischof Lohmann fordert Hochwasser- und Umweltschutz:
 Regenfluten sind Zeichen für Klimawandel
Regenfluten sind Zeichen für Klimawandel
"Wir haben eine klimatische Notlage geschaffen,
welche die Natur und das Leben, auch unser eigenes, stark bedroht."
Die Entwicklungen, wie wir sie sehen, sind Zeichen eines Wandels des Klimas und der Umwelt.
Domradio (2021-07-24) - de
 Hochwasser-Katastrophe: Aktuelle Lage im Südwesten
| SWR Extra 24.07.2021
Hochwasser-Katastrophe: Aktuelle Lage im Südwesten
| SWR Extra 24.07.2021
SWR (2021-07-24) - de
DER ANDERE BLICK - Die billigste Ausrede nach dem Hochwasser:
Der Klimawandel ist an allem schuld
Eric Gujer, Chefredaktor NZZ (2021-07-23)
Nach einer Flutkatastrophe ist die Versuchung gross, dafür die Erderwärmung verantwortlich zu machen.
Eindimensionale Erklärungen sind jedoch gefährlich.
So spricht einiges dafür, dass der Hochwasserschutz vernachlässigt wurde.
- de
Volle Talsperren vor Unwetter: Ministerium will Konsequenzen ziehen
Weil sie zum Teil schon vorher fast komplett voll waren, konnten die Talsperren in NRW die Regenmassen beim Unwetter nicht auffangen.
Das Umweltministerium kündigt Konsequenzen an.
WDR (2021-07-23) - de
Nach dem Hochwasser: Schwere Vorwürfe gegen den Wupperverband
Die Flut entlang der Wupper hätte weniger dramatisch sein können, wenn die Talsperre besser reguliert gewesen wäre.
Das sagen Anwohner, die nun gegen den Wupperverband klagen.
WDR (2021-07-23) - de
Ist der Klimawandel schuld an der Flutkatastrophe?
Simon Haas NZZ (2021-07-22)
Starkregen hat es schon immer gegeben, das zeigen historische Wetterdaten.
Durch die globale Erwärmung könnten solche Ereignisse zwar häufiger auftreten.
Die jüngste Hochwasserkatastrophe auf den Klimawandel zu schieben, greift aber zu kurz.
- de
Welche Bedingungen spielen für Starkregen eine Rolle?
Kachelmann Wetterkanal (2021-07-22) -
de
 Klimawandel: Ausrede für politisches Totalversagen in
der Flutkatastrophe! Neue heftige Gewitter!
Klimawandel: Ausrede für politisches Totalversagen in
der Flutkatastrophe! Neue heftige Gewitter!
Dominik Jung (2021-07-22) - de
"Klimawandel" als Ausrede für tödliches Versagen
von Regierung und Behörden?
 Volle Wasserbecken in Erwartung der Dürre?
Volle Wasserbecken in Erwartung der Dürre?
Axel Robert Göhring (2021-07-21) - de
 Deutschland wurde präzise gewarnt -
Deutschland wurde präzise gewarnt -
 die Bürger aber nicht
die Bürger aber nicht
Vier Tage vor den Fluten warnte das Europäische Hochwasser-Warnsystem (Efas) die Regierungen der Bundesrepublik und Belgiens vor Hochwasser an Rhein und Meuse.
24 Stunden vorher wurde den deutschen Stellen nahezu präzise vorhergesagt, welche Distrikte von Hochwasser betroffen sein würden, darunter Gebiete an der Ahr, wo später mehr als 93 Menschen starben.
Der Tagesspiegel (2021-07-21) - de
Hydro-klimatologische Einordnung der Stark- und
Dauerniederschläge in Teilen Deutschlands
im Zusammenhang mit dem Tiefdruckgebiet "Bernd"
Deutscher Wetterdienst (2021-07-21) - de
Monumentales Staatsversagen:
Die Flutkatastrophe hätte verhindert werden können
War es nicht erstaunlich,
wie schnell die Klima-Krieger versucht haben, das Hochwasser, das entlang von Ahr und Erft gewütet hat, für ihren Klimawandel-Kampf zu instrumentalisieren
und noch bevor die derzeit mehr als 150 Opfer beerdigt sind, politisches Kapital daraus zu schlagen?
ScienceFiles (2021-07-21)Und nun wirft ein Beitrag, der heute in der Sunday Times erschienen ist,
ein ganz neues Licht auf die Katastrophe, die u.a. die Eifel heimgesucht hat.
Die Katastrophe war vermeidbar.
Die Regierungen von Bund und Ländern und die Verantwortlichen vor Ort, sie haben Warnungen ignoriert,
die schon NEUN Tage vor der Katastrophe ausgesprochen wurden.
- de
Der wirkliche Grund für die Flutkatastrophe in Deutschland:
Ein "monumentales Scheitern des Warnsystems"
Eike (2021-07-20)
en The real reason for Germany's flood disaster: A 'monumental failure of the warning system'
GWPF (2021-07-18) - de
 Die Flut: Exklusive Reportage aus einem Krisengebiet
Die Flut: Exklusive Reportage aus einem Krisengebiet
Innerhalb weniger Stunden bricht über viele Städte und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz eine Sintflut herein.
Die Bewohner stehen vor den Trümmern ihrer Existenz.
Der Spiegel (2021-07-20) -
de
 Das Totalversagen der Behörden! Wetterkarten beweisen:
Extrem-Unwetter war seit Tagen bekannt!
Das Totalversagen der Behörden! Wetterkarten beweisen:
Extrem-Unwetter war seit Tagen bekannt!
Dominik Jung (2021-07-20) - de

 Hochwasser in Deutschland: Der Klimawandel als Ausrede
für das Versagen beim Katastrophenschutz
Hochwasser in Deutschland: Der Klimawandel als Ausrede
für das Versagen beim Katastrophenschutz
Statt auf die Erderwärmung zu verweisen, hätte man gescheiter Hochwasserschutz betrieben. Nebelspalter / Alex Reichmuth (2021-07-20) - de
 Bund plant Hunderte Millionen an Soforthilfe
Tagesschau (2021-07-20)
Bund plant Hunderte Millionen an Soforthilfe
Tagesschau (2021-07-20)In Anbetracht der riesigen Zerstörung fällt die Soforthilfe zunächst recht bescheiden aus.
Während Unternehmen 5000 Euro bekommen, sind die Summen für Privatleute deutlich geringer.
Für die erste Person im Haushalt gibt es 1500 Euro, für jede weitere Person nochmal je 500 Euro.
Die Maximalsumme pro Haushalt liegt bei 3500 Euro.
Diese Regelungen sind in Rheinland-Pfalz und in Nordrhein-Westfalen ähnlich ausgestaltet.
- de
Klimaforscher Mojib Latif: "Jetzt sterben viele Menschen"

Starkregen und Überschwemmungen sind keine neuen Phänomene. Also alles nur ganz normal?
Nicht ganz, erklärt der Meteorologe und Klimaforscher Mojib Latif.
Herr Latif, lässt sich die Frage, ob der extreme Stark- und Dauerregen, den wir derzeit in mehreren Teilen Deutschlands erleben, klima- oder wetterbedingt ist, eindeutig beantworten?
Nein, aber der Klimawandel ist sicherlich ein Faktor von mehreren.
die höheren Temperaturen
Mojib Latif / FAZ (2021-07-20)
starke Erwärmung des Mittelmeers
in der Arktis eine ganz besonders starke Erwärmung
- de
Schuld an der Katastrophe war nicht der Klimawandel -
sondern Starkregen!
Kalte Sonne (2021-07-19) - de
 Füllstände
Füllstände (2021-07-19)
Füllstände
Füllstände (2021-07-19)Es werden alle Talsperren und Hochwasserrückhaltebecken mit mehr als 1,00 Million m3 Stauraum aufgelistet.
- de
Flutkatastrophe 2021: Die wahren Gründe für die Flut
Nachtrag:
Aufgrund der Kritik hat der Wupperverband jetzt gesagt, warum er die Talsperren voll befüllt hat und der Hochwasserschutz daher nicht funktionieren konnte:
"Wir hatten Angst vor Dürren durch Klimawandel, und daher haben wir alle Talsperren gefüllt."
Musste Wuppertal in den Fluten versinken, weil man sich im Klimawahn befindet?
Oder ist dies eine Ausrede, damit Tourismus und Ökostrom funktionieren?
Die Schweiz hat übrigens eine Richtlinie für Talsperren: Talsperren dürfen höchstens zu 80% befüllt sein.
Lokalnachrichten aus Remscheid
Ein Lokalsender aus dem Überschwemmungsgebiet Remscheid führte kurz vor dem Hochwasser ein Interview mit einem GRÜNEN Politiker (Sportdezernent Thomas Neuhaus) und einem Mitarbeiter von "Arbeit Remscheid" am Rande der Wupper-Talsperre.
 Die Woche KW26/2021 - Lokalnachrichten aus Remscheid
Die Woche KW26/2021 - Lokalnachrichten aus Remscheid
Akademie Raddy (2021-07-19)Dort freut man sich, dass der Wasserstand der Wuppertalsperre extrem hoch ist, was toll für das Tourismusprojekt ist.
Dummerweise scheinen die beiden Jungs nicht zu begreifen, dass eine volle Talsperre keinen Schutz gegen Hochwasser mehr bietet.
- de
Der Druck wächst beim Thema Klimaschutz
Tagesschau (2021-07-19)
CSU-Chef Söder fordert einen "Klima-Ruck",
Grünen-Kanzlerkandidatin Baerbock einen schnelleren Kohleausstieg
und Umweltministerin Schulze mehr erneuerbare Energien.
Angesichts des Hochwassers ist klar: Klimaschutz muss Priorität haben.
- de
TALSPERRE GEÖFFNET ODER NICHT?
Flutwelle in Stolberg: Ein Konditor hat alles verloren und klagt an
In Stolberg hat die Flutwelle die Innenstadt verheert.
Ein Konditor, dessen Café zerstört ist, sagt:
Die Betreiber der örtlichen Talsperre haben den größten Schaden zu verantworten, weil sie eine Staumauer zur Unzeit geöffnet hätten.
Die weisen den Vorwurf von sich. Zweifel bleiben.
Tichys Einblick (2021-07-19) - de
Keine Krise ungenutzt lassen. Geschichten von der Flut.
Die Talsperren sind nicht abgelassen worden, damit sie als Rückhaltebecken dienen konnten - was eigentlich ihr Zweck ist.
ZETTELS KLEINES ZIMMER (2021-07-19) - de
Das Versagen beim Hochwasserschutz
Nach dem Elbe-Hochwasser 2002 reagierte die rot-grüne Bundesregierung mit einem wirksamen Gesetz zum Hochwasserschutz.
Nicht nur die damalige Opposition aus Union und FDP lehnte die Vorschläge ab, sondern auch die Mehrheit der Bundesländer.
Dieses politische Versagen darf sich nicht wiederholen.
Klimareporter (2021-07-19) - de
 FALSCHE PROPHETEN Faktencheck: Was das Hochwasser wirklich
mit "Klima" zu tun hat
FALSCHE PROPHETEN Faktencheck: Was das Hochwasser wirklich
mit "Klima" zu tun hat
Sebastian Lüning EIKE (2021-07-18)In mittelalterlichen Zeiten hätte der Priester erklärt, es wäre eine Strafe Gottes gewesen, für das frevelhafte Verhalten der Sünder.
Die heutige Erklärung ist leider nicht weit davon entfernt.
- de
Hat die Warnung vor der Flut nicht funktioniert?
Ich halte es für überaus wichtig, nun herauszufinden, warum es hier keine ordentliche Warnung und auch vorher keine Vorbereitung gegeben hat.
Oder man da überhaupt gebaut hat.
Und ob beispielsweise Brücken die Überschwemmungen verursacht haben, wie damals in Dresden.
Hadmut Danisch (2021-07-18)Hat man die Warnungen ignoriert,
um den Grünen und Fridays for Future im Wahlkampf keinen Ansatzpunkt zu liefern
und kein Affentheater von Greta, Luisa & Co. zu provozieren?
- de
 Bürgermeister von Schuld gibt Merkel Kontra
Bürgermeister von Schuld gibt Merkel Kontra
Frau Merkel reiste wegen den Hochwasserschäden nach Schuld in der Eifel und gab da natürlich eine Pressekonferenz…
Crazy Krauthead (2021-07-18) - de
 Hochwasser-Katastrophe im Südwesten -
Aktuelle Lage | SWR Extra 18.07.2021
Hochwasser-Katastrophe im Südwesten -
Aktuelle Lage | SWR Extra 18.07.2021
SWR (2021-07-18) - de
"Die Überflutungen sind eine Hochwasser-Katastrophe
mit Ansage gewesen"
reitschuster.de (2021-07-17)Man hat hier alles verloren:
Häuser, Autos, Hab und Gut, Fotos, Spielzeug.
Alles!
Ich gebe der Politik die Schuld an der Misere.
Wir waren schutzlos und mutwillig der Katastrophe ausgeliefert.
Alle waren vorgewarnt, aber man hat abgewartet und geguckt, wie schlimm es wird.
- de
Jesuit Alt ruft zur Bekämpfung des Klimawandels auf:
"Das Schlimmste noch verhindern"
Die Kipppunkte kommen schneller als vorhergesagt,
aber dennoch müssen wir das Vertrauen haben, dass das, was wir tun, in Gemeinschaft
mit anderen und Gottes Hilfe das Schlimmste noch verhindern kann.
Domradio (2021-07-17) - de
Wuppertalsperre läuft über:
Maximale Stauhöhe um Mitternacht überschritten:
14. Juli 2021 23:00
NRW Paddler (2021-07-17)
Durch anhaltenden Starkregen erreichte der Stauinhalt der Wuppertalsperre am 14. Juli 2021 um 23:00 das Vollstauziel.
Weshalb der Hochwasserschutzraum binnen kurzer Zeit aufgebraucht war und das Wasser ungehindert über den Überlauf ins Tal stürzte, wo die ersten Wupperorte rasch vom Wasser erreicht wurden.
Zwischen 23:00 und 6:00 strömten jedoch noch über eine Million Kubikmeter Wasser in das Staubecken.
- de
Überlauf Rursee Talsperre in Heimbach in der Eifel
am 16.07.2021 inklusive Öffnung des Grundablass
Photo Lurch (2021-07-16)
Video über den Überlauf der Rursee Talsperre am 16.07.2021.
Auch eines von zwei Rohren des Grundablasses wurde geöffnet.
- de
Schweiz: Das Unwetter sorgt für das schlimmste
Schadensjahr seit 2005
20'000 beschädigte Fahrzeuge an einem Tag
Laut Hochrechnungen des Versicherers Mobiliar haben die Unwetter seit dem 20. Juni Schäden in der Höhe von 280 Millionen Franken verursacht.
Allein der Hagelzug vom 28. Juni habe zu 20'000 Fahrzeugschäden in der Höhe von 90 Millionen Franken geführt.
Zum Vergleich: Das August-Hochwasser von 2005 sorgte bei der Mobiliar für Schäden von insgesamt 450 Millionen Franken.
Tages-Anzeiger (2021-07-16) - de
 Deutschland sollte auch über Dämme und Frühwarnsysteme
und nicht nur über Windräder und Elektroautos reden
Deutschland sollte auch über Dämme und Frühwarnsysteme
und nicht nur über Windräder und Elektroautos reden
Sie sehen sich in ihrer Weltanschauung bestätigt
und ziehen in politischen Statements, in Medienkommentaren oder auf den sozialen Netzwerken blitzschnell die
mal hämisch, mal warnend gemeinte Schlussfolgerung:
Das sind die Folgen des Klimawandels.
NZZ (2021-07-16) - de
 Hochwasser: Die aktuelle Lage im Südwesten:
SWR Extra am 16.07.2021
Hochwasser: Die aktuelle Lage im Südwesten:
SWR Extra am 16.07.2021
SWR (2021-07-16) - de
1300 Menschen werden im Kreis Bad Neuenahr-Ahrweiler
vermisst - Hoffnung an der Steinbachtalsperre
Inhaltsverzeichnis
22.40 Uhr: Wasserstand an der Steinbachtalsperre sinkt.
20.02 Uhr: Lewentz: Neun weitere Tote durch Hochwasser-Katastrophe.
16.38 Uhr: Merkel sagt Menschen in Hochwassergebieten Unterstützung zu.
16.04 Uhr: Bahnverkehr in NRW und Rheinland-Pfalz weiterhin stark eingeschränkt.
14.46 Uhr: Zahl der Unwettertoten in NRW und Rheinland-Pfalz auf mindestens 42 gestiegen.
13.38 Uhr: Lage unübersichtlich - Zahl der Vermissten sinkt.
12.47 Uhr: Laschet zu Hochwasser: Klimaschutz muss jetzt forciert werden.
Stern (2021-07-15) - de
"Es ist wirklich verheerend"
Mit folgenden Videos:
 Besonders dramatisch ist die Unwetterlage in Rheinland-Pfalz
und NRW
Besonders dramatisch ist die Unwetterlage in Rheinland-Pfalz
und NRW
 Ansgar Zender, SWR, mit Details zu über 70 Vermissten nach
Überflutungen in Kordel in Rheinland-Pfalz
Ansgar Zender, SWR, mit Details zu über 70 Vermissten nach
Überflutungen in Kordel in Rheinland-Pfalz
 Jan Schulte, WDR, über die aktuelle Situation in Hagen
Jan Schulte, WDR, über die aktuelle Situation in Hagen
 Bahnverkehr massiv beeinträchtigt
Bahnverkehr massiv beeinträchtigt
Tagesschau (2021-07-15) - de
 Talsperre läuft unkontrolliert über
Hessenschau (2021-07-15)
Talsperre läuft unkontrolliert über
Hessenschau (2021-07-15)Hessenschau vom 15.07.2021
Diemelsee läuft über
- de
 Historisches Unwetter: Flutkatastrophe an der Ahr (15.07.2021)
Historisches Unwetter: Flutkatastrophe an der Ahr (15.07.2021)
Eine Katastrophe historischen Ausmaßes hat die Eifel getroffen.
In vielen Landkreisen wurde der Katastrophenalarm ausgerufen.
Besonders schlimm ist die Lage an der Ahr im nordwestlichen Rheinland-Pfalz.
Nach Angaben der Polizei sind im Ort Schuld am Oberlauf der Ahr mehrere Häuser eingestürzt und zahlreiche Personen werden vermisst.
WetterOnline (2021-07-15) - de
Warnung vor extremen Dauerregen für Wuppertal - Überflutungen möglich
Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt für Mittwochmorgen 7.14 Uhr bis voraussichtlich Donnerstag 6 Uhr vor ergiebigem Dauerregen (Warnstufe 4 von 4).
Die amtliche Warnung hat der Dienst am Mittwochmorgen (14. Juli 2021) ausgegeben.
Westdeutsche Zeitung (2021-07-14 07:39 h) - de
Die Wuppertalsperre ist mehr als randvoll...
Twitter (2021-07-14 21:30 h) - de
Stadt Wuppertal warnt vor Überschwemmungen in der Nacht
Zwar hat der Regen gegen 22 Uhr in Wuppertal nachgelassen, doch die Gefahr von Überflütungen ist weiterhin groß.
Die Stadt warnt vor weiteren Wupper-Übertritten im gesamten Gebiet der Talachse.
Grund dafür sind die massiven Zuläufe in die Wuppertalsperre, die zu einem Überlauf der Talsperre führen könnten.
Die Wassermengen, die dadurch zusätzlich zum kontrollierten Ablauf in die Wupper kommen können, sind nicht absehbar.
Der Überlauf könnte binnen der nächsten Stunde passieren, so die Stadt (Stand 14. Juli 2021 um 22.30 Uhr).
Der Scheitelpunkt des Hochwassers wird gegen 1 Uhr erwartet.
Der Wupperverband sei dabei, an der Wuppertalsperre "die Kontrolle zu verlieren", so Informationen der WZ.
Die Stadt sperrt derzeit alle Unterführungen auf der Talsohle.
Die Unterführungen dürfen bis auf Weiteres nicht mehr genutzt werden.
Die Stadt sagt: "Die Gefahr ist noch nicht vorbei!"
Alle sensiblen Einrichtungen, die das Hochwasser erreichen könnten, seien informiert - sie verlegen, wo nötig, ihre Bewohner vorsorglich nach oben.
Westdeutsche Zeitung (2021-07-14 22:55 h ) - de
 Starkregen und Sturzfluten
Starkregen und Sturzfluten
Starkregen und Sturzfluten in Simbach in Niederbayern
Sieben Menschen kamen vor fünf Jahren (2016) bei einem Jahrhundert-Hochwasser ums Leben.
Arte (2021-06-02) - de
 Fluss-Hochwässer haben in den letzten 50 Jahren
global abgenommen
Fluss-Hochwässer haben in den letzten 50 Jahren
global abgenommen
• Global Changes in 20-Year, 50-Year, and 100-Year River Floods
• Major floods increased in temperate climates but decreased elsewhere: Oxford study
• New Study: 100-Year Flood Events Are Globally Decreasing In Frequency And Probability Since 1970
Klimaschau K35 (2021-05-09) - de
 Die Flut kommt - todsicher
Die Flut kommt - todsicher
Wie die deutschen Küsten gegen die steigenden Fluten aufgerüstet werden
Hochwasserschutz in der Großstadt
Meeresspiegel - Wie wird er gemessen und was lässt ihn künftig wie stark steigen?
Sperrwerke und Mega-Dämme
[W] wie Wissen (2021-03-28) - de
 LINTHFLUT / Bunkerbau im WW2
LINTHFLUT / Bunkerbau im WW2
Im Zweiten Weltkrieg wurde die Linthebene nicht nur zu einem Vorzeigemodell der Anbauschlacht, sondern auch zu einem gewaltigen militärischen Abwehr-Mechanismus gegen die Nazis ausgebaut.
Tschanz (2021-02-19) - de
 Talsperren sind wieder gut gefüllt
WDR (2021-01-21)
Talsperren sind wieder gut gefüllt
WDR (2021-01-21)Viel Regen, viel Schnee
Das sorgt zwar nicht für gute Laune, tut aber der Natur und den Talsperren gut.Nach dem trockenen Sommer erholt sich die Natur langsam wieder und die Talsperren laufen wieder voll.
-
2019 - de
Dank Regen: Talsperren wieder mehr gefüllt
Antenne Unna (2019-01-03)
Das Regenwetter der letzten Wochen hat Wirkung gezeigt.
Die für das Trinkwasser im Kreis Unna wichtigen Talsperren sind wieder mit mehr Wasser gefüllt.
-
2018 - de
 Unwetter und Überschwemmungen: Der Wetter-Wahnsinn -
stürmisch und teuer
Unwetter und Überschwemmungen: Der Wetter-Wahnsinn -
stürmisch und teuer
In dieser Dokumentation aus dem Jahr 2018
geht es um die Änderungen beim Wetter und die katastrophalen Auswirkungen auf uns und unsere Umwelt.
BR (2019-10-27) - de
 San Joaquin River Flood Risk Management System
San Joaquin River Flood Risk Management System
The U.S. Army Corps of Engineers,San Joaquin Area Flood Control Agency and State of California's Central Valley Flood Protection Board work together to reduce flood risk for the City of Stockton and surrounding area.
Learn about the complex system that helps reduce risk for over 160,000 people and one of the most productive agricultural areas in the United States.
Sacramento District (2018-08-03) - de
 Öffnung der beiden Grundablass Rohre an der Rursee Talsperre
Öffnung der beiden Grundablass Rohre an der Rursee Talsperre
Öffnung der beiden Grundablass Rohre an der Rursee Talsperre am 28.07.2018, anläßlich des 80 jährigen Jubiläum der Talsperre.Im Video werden der Ablass von 15.000 Liter pro Sekunde gezeigt.
Im absoluten Notfall wäre sogar eine Entleerung von bis zu 60.000 Liter pro Sekunde möglich.
Photo Lurch (2018-07-30) - de
Sonne steuert Überschwemmungen in Zentralchina:
Forscher entdecken 500-Jahreszyklus in Höhlentropfsteinen
Aus China berichteten Liu et al. 2014 und Chen et al. 2015 über vorindustrielle Überflutungsphasen.
Zhu und Kollegen publizierten im Januar 2017 in PNAS eine Überflutungsstudie auf Basis von Höhlentropfsteinen aus Zentralchina.
Die Forscher fanden einen 500 Jahreszyklus, der eng an die El Nino/La Nina-Oszillation und solare Schwankungen gekoppelt ist.
Kalte Sonne (2018-01-01) -
2017 - de
Spanien: Überschwemmungen im Takte von Sonne und Ozeanzyklen
Auch in Spanien treten die Flüsse ab und an über die Ufer.
Neue Studien haben die Hochwasserereignisse feinsäuberlich rekonstruiert.
Wer bei der nächsten Überflutung reflexhaft den Klimawandel als Ursache bemüht, sollte sich zunächst mit der Klimageschichte beschäftigen und sich die Frage stellen:
Ist dieses aktuelle Hochwasserereignis wirklich so grundlegend verschieden von den früheren?
Kalte Sonne (2017-09-15) - de
Ein unerwartetes Ergebnis: Sonnenaktivität steuert Überflutungen in
den Alpen
Klimaextreme können nur in ihrem langfristigen Kontext korrekt bewertet werden.
Studie aus den französischen Alpen
Flutgeschichte der letzten 1000 Jahre:
Eine Häufung der Flutereignisse während der kalten Kleinen Eiszeit.
Flutereignisse von hoher Intensität wurden sowohl in der Kleinen Eiszeit als auch in der Mittelalterlichen Wärmeperiode gefunden.
Interessanterweise konnte für das 20. Jahrhundert trotz Erwärmung kein Trend in Häufigkeit und Intensität der Fluten ausgemacht werden.
Studie am schweizerischen Oeschinensee
Allgemein ereigneten sich die stärksten Flutereignisse während Kältephasen.
Kalte Sonne (2017-09-09) - de
Verschiebt der Klimawandel Europas Hochwässer dramatisch?
Die Hochwasserpegel wurden bisher nicht höher und die Starkniederschläge ebenfalls nicht schlimmer
Wie unlängst in einer kleinen Sichtung anhand 100-jähriger Niederschlagsreihen gezeigt wurde, sind die Starkniederschlags-Streuungen unglaublich hoch.
Es ist so "schlimm", dass ist nicht einmal nach 100 Jahren sichere Trends belegbar sind.
Vor allem jedoch:
Eine Korrelation mit der steigenden Temperatur oder dem CO₂-Eintrag zeigt sich definitiv nicht.
Eike (2017-08-22) -
2016 - de
Wikipedia: Unwetter in Europa im Frühjahr 2016
en Wikipedia: 2016 European floods
fr Wikipedia: Inondations européennes de 2016 - de
2016:
Starkregen, Sturzflut, Sintflut -
sieht so der Sommer der Zukunft aus?
Der Frühsommer 2016 brachte Regen nach Deutschland.
Zu viel Regen.
Braunsbach, Simbach, Wachtberg - etliche Orte wurden von den Wassermassen überrascht, es gab Verletzte und Tote.
Aber warum konnte man die Unwetter nicht früher vorhersagen?
Welche Kraft hat Wasser wirklich - und ist der Klimawandel wirklich schuld?
WDR (2016-11-08) - de
Rekordhochwasser in Frankreich:
Die Seine und weitere Flüsse steigen - zwei Tote
Südlich von Paris und auch im Loire-Tal hat das Wasser nach tagelangen Regenfällen Felder und Ortschaften überflutet.
Besonders betroffen ist Nemours, wo die Hälfte der Bewohner evakuiert wurden.
NZZ (2016-06-02) - en
Climate Blamed for Worst Paris Floods since 1910
Paris, France recently suffered severe flooding.
Naturally Climate Scientists have blamed the May 2016 Paris floods on Climate, though it was admitted the floods fell well short of the Great Flood of 1910.
Flooding began first on smaller rivers including the Yvette and Loing - south of Paris.
The Loing River, a tributary of the Seine, rose to levels not seen since 1982 but still short of the catastrophic January 1910 Paris floods when the Seine reached 8.0 meters (26.2 feet).
The Seine - which runs directly through the heart of Paris - peaked at 6.1 meters (20 feet ) above its normal height during the night of June 3rd - a 34-year high.
Watts Up With That? (2016-06-11) - de
Unwetter verursachen Schäden in Millionenhöhe
Mehrere Regionen der Schweiz haben durch das Unwetter Schäden in Millionenhöhe erlitten.
Besonders hart traf es den Kanton Aargau und die Nordwestschweiz.
Im Osten ging es auch am Donnerstag mit kräftigem Regen weiter.
Basler Zeitung (2016-06-10) - en
European Rainstorms, May 2016
Torrential rainfall ravaged parts of central and northeastern France and southern Germany last week forcing the evacuation of thousands - some in kayaks and canoes.
The River Seine burst its banks as waters reached their highest levels in over 30 years.
In Bavaria, floodwaters surged so fast they crushed houses and cars, forcing some residents to scramble to safety on their rooftops.
The floods closed the famed Louvre museum, left tens of thousands without power, and is reported to have killed at least 18 people in Germany, France, Romania, and Belgium.
Damages are estimated at over a billion Euros in France alone.
The extreme nature of this event left many asking whether climate change may have played a role.
World Weather Attribution (2016-06-09) - fr
Le coût des crues pourrait excéder le milliard d'euros
Le Monde (2016-06-06) - fr
Inondations : un mort en Seine-et-Marne, 12 départements toujours en
vigilance orange
Un peu plus de 19 000 foyers étaient privés d'électricité jeudi soir dans le Loiret et l'Ile-de-France en raison des inondations, contre 21 700 en fin de matinée, selon Enedis (anciennement ERDF), le gestionnaire du réseau français de distribution d'électricité.
En Allemagne, des pluies diluviennes ont fait au moins neuf morts depuis dimanche et trois personnes sont portées disparues en Bavière, selon un porte-parole de la police locale.
Epicentre des inondations mercredi, Simbach am Inn a commencé à voir le niveau de l'eau baisser dans les rues de la ville, qui montait parfois jusqu'aux toitures.
Le Monde (2016-06-02) - fr
Ile-de-France: La région sous l'eau du 7 au 18 mars pour
un exercice inédit
Du 7 au 18 mars l'Ile-de-France aura les pieds dans l'eau:
la préfecture de police organise en effet un exercice inédit de gestion de crise appelé Sequana, simulant une crue majeure, avec des exercices de terrain.
La référence en terme de crue centennale reste celle de en 1910.
20 Minutes (2016-03-01) - fr
 Simulation d'une crue centennale de la Seine en amont
de Paris (Val-de-Marne)
Simulation d'une crue centennale de la Seine en amont
de Paris (Val-de-Marne)
Cette animation illustre les conséquences d'une inondation sur le territoire des bords de Seine en amont de Paris.
Un tel scénario pourrait se produire lors d'une crue centennale, rendant insuffisantes les retenues des grands lacs de Seine.
Les systèmes de protection le longs des berges seraient submergés.
L'Institut Paris Region (2016-02-18) - de
 Dass draußen ganz normales Wetter herrscht, zeigten unsere Simulationen
nicht an, deshalb konnten wir uns darauf auch nicht vorbereiten
Dass draußen ganz normales Wetter herrscht, zeigten unsere Simulationen
nicht an, deshalb konnten wir uns darauf auch nicht vorbereiten
Wann Starkregenereignisse wirklich stattfanden, lässt sich viel aussagekräftiger anhand von Flusspegelgrafiken zeigen.
Diese belegen, dass solche Ereignisse bei Kälte (zumindest soll es früher kälter gewesen sein) - und nicht bei Wärme - zunehmen,
da sie in unseren Breiten vom Wetter und nicht vom Klima abhängen (das diesjährige Unwetter in Simbach geschah ja ebenfalls bei eher niedrigen Temperaturen).
In der sehnlichst ersehnten, angeblich "wetterschadenfreien" vorindustriellen Zeit kamen die Flüsse ziemlich oft in die die Stadtzentren der anliegenden Flußstädte und -Dörfer.
Helmut Kuntz, Eike (2016-02-18) -
2015 - en
The EU is to Blame for Britain's Flood Disaster
Breitbart (2015-12-28)
Northern Britain has spent Christmas being inundated with floods of "biblical proportions".
Yes, they are indeed a man-made creation - but the people mainly
responsible are the bureaucrats and green activists at the European Union
whose legislation has made it illegal for Britain to take the measures necessary to reduce the risk of flooding.
So what changed? EU Regulation, that's what.
Thanks to the European Water Framework Directive - which passed into UK law in 2000 and which is enforced by the Environment Agency - the emphasis has shifted from preventing flooding to encouraging it.
Instead, the emphasis shifted, in an astonishing reversal of policy, to a primary obligation to achieve 'good ecological status' for our national rivers.
This is defined as being as close as possible to 'undisturbed natural conditions'.
"Heavily modified waters", which include rivers dredged or embanked to prevent flooding, cannot, by definition, ever satisfy the terms of the directive.
So, in order to comply with the obligations imposed on us by the EU we had to stop dredging and embanking and allow rivers to 're-connect with their floodplains', as the currently fashionable jargon has it.
And to ensure this is done, the obligation to dredge has been shifted from the relevant statutory authority (now the Environment Agency) onto each individual landowner, at the same time making sure there are no funds for dredging.
And any sand and gravel that might be removed is now classed as 'hazardous waste' and cannot be deposited to raise the river banks, as it used to be, but has to be carted away.
On the other hand there is an apparently inexhaustible supply of grant money available for all manner of conservation and river 'restoration' schemes carried out by various bodies, all of which aim to put into effect the utopian requirements of the E W F Directive to make rivers as 'natural' as possible.
For example, 47 rivers trusts have sprung up over the last decade, charities heavily encouraged and grant-aided by the EU, Natural England, the Environment Agency, and also by specific grants from various well-meaning bodies such as the National Lottery, water companies and county councils.
The West Cumbria Rivers Trust, which is involved in the River Derwent catchment, and includes many rivers that have flooded, is a good example.
But they all have the same aim, entirely consonant with EU policy, to return rivers to their 'natural healthy' state, reversing any 'straightening and modifying' which was done in 'a misguided attempt to get water off the land quicker'.
They only think it 'misguided' because fast flowing water contained within its banks can scour out its bed and maybe wash out some rare crayfish or freshwater mussel, and that conflicts with their (and the EU's) ideal of a 'natural' river.
- en
Pentagon Says Europe Will Drown In The Next Four Years
We give the Pentagon hundreds of billions of dollars a year, but they didn't have enough money to find out that sea level isn't actually rising in much of Europe.
Real Science (2015-09-27) -
2014 - de
Hessischer Starkregen aus dem Juli 2014 eine Folge des Klimawandels?
Eher unwahrscheinlich. Statistiken zeigen eine Abnahme schwerer
sommerlicher Regengüsse während der letzten 100 Jahre
Endlich mal wieder schlechtes Wetter, darauf hatte man beim Potsdaminstitut für Klimafolgenforschung (PIK) schon gehofft:
Ein Gewitter in Hessen musste jetzt als Kronzeuge für den Klimawandel herhalten.
Die Welt bot dem PIK am 16. Juli 2014 die entsprechende Bühne:
Kalte Sonne (2014-08-21) -
2013 - de
Neue Studie des Geoforschungszentrums Potsdam: In den letzten 7000
Jahren gab es in Oberösterreich 18 hochwasserreiche Phasen
Es ist ein einfach durchschaubares Muster.
Immer wenn ein Sturm über die Lande fegt, Überschwemmungen eine Flusslandschaft unter Wasser setzen oder eine Dürre die Ernte zerstört, ist der Schuldige schnell gefunden:
Es muss wohl der Mensch gewesen sein, der mit seiner ausschweifenden Lebensweise zu viel CO₂ in die Luft pustet und das Klima in katastrophaler Weise durcheinander bringt.
Früher machte man für derlei meteorologische Extreme Hexen verantwortlich, die man schnellstmöglich auf den Marktplätzen verbrannte um schlimmeres Unwetter in Zukunft zu verhindern.
An wissenschaftlichen Argumenten war man früher ebenso wie heute eher weniger interessiert.
Kalte Sonne (2013-12-21) - de
Was waren die wahren Hintergründe der
mitteleuropäischen Flut 2013?
Jahrhundertfluten - Klimawandel schlägt voll zu
Meteorologe Prof. Mojib Latif (58) von der Uni Kiel: "Die Häufung der Wetter-Extreme ist ein eindeutiges Indiz für den Klimawandel."
Grund: der Treibhauseffekt!
Latif: "Weil wir ungehemmt CO₂ in die Luft pumpen, heizt sich die Atmosphäre auf."
Die Folge: Immer mehr Wasser verdunstet in den Meeren.
Die Luftfeuchtigkeit steigt, Wolken saugen sich mit Wasser voll und regnen sich über dem Festland ab.
Es kommt zu Starkniederschlägen, zu immer heftigeren Überflutungen […].
Fakten, Fakten, Fakten
Was war eigentlich passiert?
Auf Spiegel Online fasste Axel Bojanowski die wichtigsten Fakten zum deutsch-österreichisch-tschechischen Hochwasser 2013 gut zusammen:
Kalte Sonne (2013-07-03)
Weiterlesen - de
Flutkatastrophen am bayerischen Ammersee vor allem während solarer
Schwächephasen
Kalte Sonne (2013-06-23)
Die simplistische Verkürzung auf "mehr CO₂ gibt mehr Hochwasser" wird der Komplexität der Materie sicher nicht gerecht.
Immer wenn die Sonne schwach war, kam es zu vermehrten Fluten am Ammersee.
- de
Neue begutachtete Studie in Nature Climate Change: Klimawandel lässt
Hochwasser in Europa wohl in Zukunft seltener werden
Die Hochwasser-Häufigkeitsentwicklung am Ammersee für die vergangenen 450 Jahre.
Es ergab sich eine ausgezeichnete Korrelation mit der Sonnenaktivität.
Immer wenn die Sonne schwach war, kam es zu vermehrten Fluten am Ammersee.
Auch in einem neueren Paper vom Februar 2013 in den Quaternary Science Reviews wiesen die Forscher erneut auf diesen erstaunlichen Zusammenhang hin.
Kalte Sonne (2013-06-11) -
2012 - de
Mehr Überflutungen in Kälteperioden als in Wärmeperioden
Häufungen von Überflutungen
fanden die Forscher für die Zeit der Kälteperiode der Völkerwanderungszeit (450-480, 590-640 und 700-750 n. Chr.), im Mittelalter (1140-1170 n. Chr.), sowie während der Kleinen Eiszeit (1300-1330 und 1480-1520 n. Chr.).
Episoden mit geringer im Frühlings- bzw. Sommer-Überflutungsneigung
ereigneten sich hingegen während der Mittelalterlichen Wärmeperiode (1180-1300 n. Chr.) sowie während der kältesten Phase der Kleinen Eiszeit (1600-1700 n. Chr.).
Kalte Sonne (2012-10-23)
en
A 1600 yr seasonally resolved record of decadal-scale flood variability
Geology (2012-11) - de
Zehn Jahre nach dem Elbe-Hochwasser:
Aus der Flut gelernt?
Im August 2002 standen große Teile Sachsens, Sachsen-Anhalts und schließlich Niedersachsens unter Wasser,
in Prag und Bayern wurde gegen die Fluten gekämpft.
Die Flüsse sollten mehr Raum bekommen, schworen danach alle.
Viel ist daraus nicht geworden.
Tagesspiegel (2012-08-12) - de
Mehr Überschwemmungen? Vermutlich eher nicht
Die im 20. Jahrhundert erkennbare Zunahme der Pegeldurchflüsse sind in ähnlicher Form seit 1500 bereits mehrfach aufgetreten.
Phasen von Hochwasser-Häufungen wurden in den letzten 500 Jahren regelmäßig wieder durch Phasen deutlich reduzierten Hochwasserauftretens abgelöst.
Zu den Hochwasserereignissen sagt der Deutsche Wetterdienst:
"Bei extremen Wetterereignissen sind in Deutschland hingegen bisher keine signifikanten Trends zu beobachten gewesen.
Auch solche Ereignisse wie die Hochwassersituation 2002 gehören zum normalen Repertoire unseres Klimas."
Kalte Sonne (2012-03-13) -
2011 - en
 California: Central Valley Flood Risk
California: Central Valley Flood Risk
It will happen again: the ARkStorm Scenario
Sacramento District (2011-07-20) -
2010 - en
This is ARkStorm
The ARkStorm Scenario, led by the USGS and more than 100 scientists and experts from varied disciplines, details impacts of a scientifically plausible storm similar to the Great California Storm of 1861-62 in the modern day.
The scenario led to several important scientific advancements and will be used by emergency and resource managers to improve partnerships and emergency preparedness.
USGS Multi Hazardst (2010-12-13) -
2009 - en
Obama flunks Global Warming 101 on Fargo
President Obama used recent flooding in Fargo, North Dakota to push his misguided belief in global warming.
His comment, "If you look at the flooding that's going on right now in North Dakota and you say to yourself, 'If you see an increase of two degrees, what does that do, in terms of the situation there?'" is speculative and completely wrong.
SOTT / Dr. Tim Ball Canada Free Press (2009-04-20) -
2007 - de
Doku 2007:
Stürme, Fluten Hitzewellen:
Deutschland im Klimawandel
Eine Doku, die ich seinerzeit auf DVD gebannt habe.
Beim "Ausmisten" habe ich die heute gefunden und ich finde es Interessant und Erschreckend mit den jetzt vergangenen 12 Jahren diese zu sehen und mit den aktuellen Werten abzugleichen.
Es hat sich nicht viel geändert, bzw. es fängt nun an sich vielleicht was zu ändern.
meinereiner2011 (2021-09-30) - de
Fünf Jahre nach der Elbeflut
Wurden und werden öffentliche Finanzhilfen im Sinne eines nachhaltigen Hochwasserschutzes verwendet?
Wie aus dem Ruf nach mehr Raum für die Flüsse und Rückbau in den Flussräumen die Finanzierung von Deichbauten, Stauwehren und Straßen wurde.
WWF (2007-06) -
2003 - de
 Zur Temperatur- und Hochwasserentwicklung der letzten 1000 Jahre in
Deutschland
Zur Temperatur- und Hochwasserentwicklung der letzten 1000 Jahre in
Deutschland
Die Analyse historischer Aufzeichnungen ermöglicht Rekonstruktionen von Hochwasserereignissen und klimatischen Parametern ab etwa dem Jahr 1000 n.Chr.
Betrachtet man die Ergebnisse, so wird zunächst offensichtlich, dass es zu allen Zeiten klimatische Extremereignisse gab.
Immer wieder wurde die Bevölkerung von Hitzewellen und Dürren, Frostperioden und Starkniederschlägen überrascht.
In manchen Regionen übertrafen einzelne Hochwasserereignisse die "Jahrhunderthochwässer" des vergangenen Jahrzehnts deutlich.
DWD Klimastatusbericht 2003 -
2002 - de
 Hochwasser am Main
Klima Notizen.de (2002)
Hochwasser am Main
Klima Notizen.de (2002)
-
1910 - de
Überflutungen 1910 in Paris
-
2012-04-29 fr
 INONDATIONS DE 1910 à PARIS.wmv
INONDATIONS DE 1910 à PARIS.wmv
(Expositions de 2010 à paris et en banlieu pour commémorer les inondations)
-
-
1862 - en
 California Megaflood 1862
California Megaflood 1862
⇧ de Allgemein en General fr Générale
-
Hochwasser - Länderübergreifendes Portal
de Aktuelle Hochwasserlage
|
|
|
-
SRF / Einstein
2016-09-07 de Wie die Schweiz ihre Flüsse und Bäche bändigteMit viel Aufwand werden in der Schweiz Flüsse und Bäche in ihren natürlichen Zustand zurückversetzt.
Damit machen wir rückgängig, was unsere Vorfahren in Handarbeit erschaffen haben - mit Stolz, denn damals machten die Eingriffe Sinn, zu Beispiel wegen Seuchen.
Ein Rückblick.
-
Historisches Lexikon der Schweiz
2006-12-11 de GewässerkorrektionenDie Anwohner von Flüssen und Bächen haben sich seit frühester Zeit gegen Ausuferungen, ausgreifende Erosionen und Überschwemmungen geschützt.
Während es sich bei den wasserbaulichen Massnahmen im Mittelalter und in der frühen Neuzeit in der Regel um punktuelle Eingriffe handelte, wurden vom 18. Jahrhundert an auch umfangreiche, sich über grössere Gebiete erstreckende Korrektionen vorgenommen.
⇧ de Übersicht en Overview fr Vue d'ensemble
- Vollständige Liste siehe Verzeichnis
▶
![]() Flut: Artikel Deutschland
▶
Flut: Artikel Deutschland
▶
![]() Flut: Artikel Schweiz
Flut: Artikel Schweiz
▶
![]() Flut: Videos
▶
Flut: Videos
▶
![]() Flut: Grafiken/Bilder
Flut: Grafiken/Bilder
↑ Hochwassermarken
Mit folgendem Link wird von anderen Webseiten auf diese Seite verwiesen.
▶Hochwassermarken|
|
||
|
||
![]()
![]() Hochwassermarken in Eibelstadt am Main
Hochwassermarken in Eibelstadt am Main
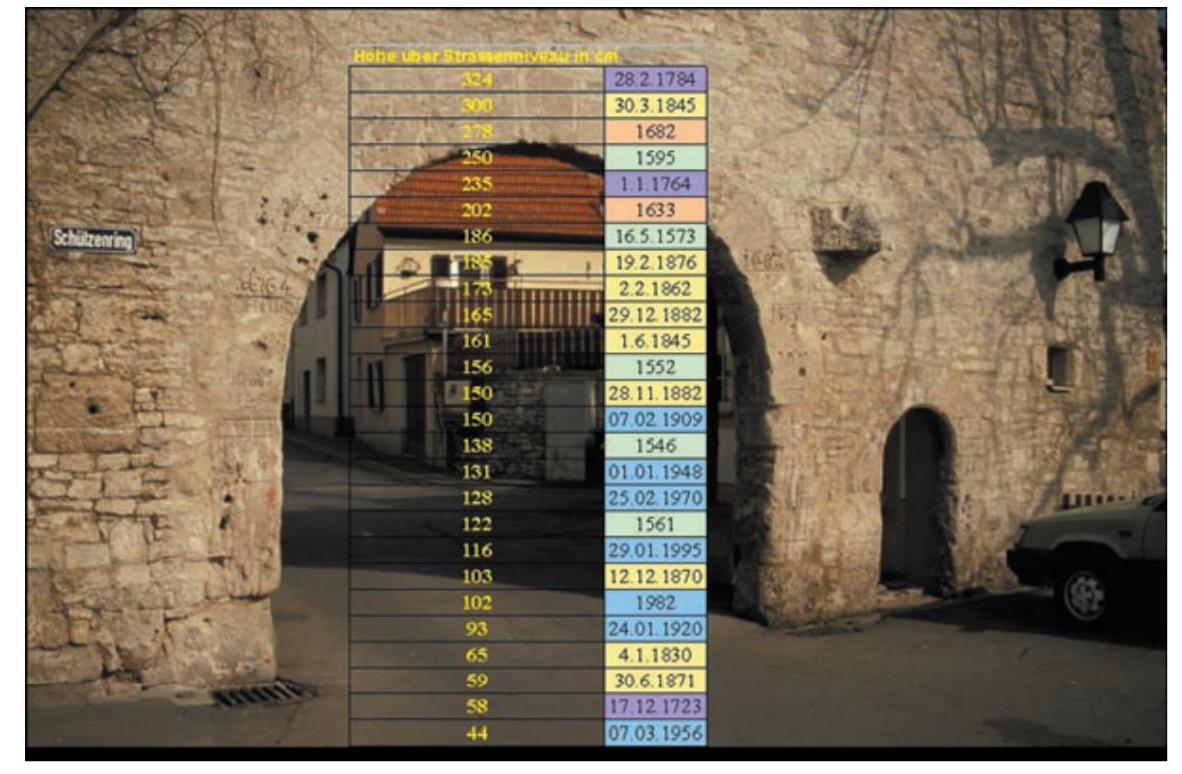
| 1342 |
Bis heute unübertroffen ist das Elbe-Hochwasser Ende Juli 1342. Diese Jahrtausendflut soll beispielsweise in Meißen in der Franziskanerkirche die Altäre überstiegen haben, wäre also um einiges höher gewesen als die jüngste Überschwemmung, die Meißens historische Altstadt schwer getroffen hat. Einzigartig war allerdings die regionale Ausdehnung der Unwetterkatastrophe von 1342, die etwa daran ablesbar ist, dass auch an Main, Donau und Rhein Brücken zerstört wurden. Viele Städte und Dörfer wurden von den anschwellenden Wassermassen, wie jüngst wieder erlebt, schlagartig getroffen. Auslöser war eine Großwetterlage, wie sie ähnlich in den Julimonaten 1897, 1927, 1997 und nunmehr im August 2002 aufgetreten ist. Die katastrophalen Auswirkungen des Hochwassers von 1342 lassen sich nicht nur an manchen impressionistischen Berichten spätmittelalterlicher Chronisten ablesen, die stets mit kritischer Vorsicht zu betrachten sind, sondern sie finden ihre Bestätigung in Untersuchungen der Landschaftsökologie. Die starken Niederschläge im Juli 1342 haben zu beträchtlichen Bodenerosionen geführt, die sich in den Schwemmfächern zahlreicher Flüsse und Bäche niedergeschlagen haben. Um das ganze Ausmaß der damaligen Katastrophe zu erfassen, muss man sich vergegenwärtigen, dass es das moderne Problem der Bodenversiegelung, das die Wirkung der Niederschläge noch steigert, vor dem 19. Jahrhundert praktisch nicht gegeben hat. Quelle: |
||
| 1362 |
Januar 1362, Nordfriesland. Während mehrerer Tage andauernden
Nordweststürmen und extrem hohen Wasserständen ereignete
sich "die Grote Mantränke" mit Tausenden von Toten, riesigen Landverlusten
und dem Untergang der Stadt Rungholt. Die Gründe dafür sind nun gut bekannt, u. a. der Meeresspiegelanstieg. Der Mythos will es besser wissen: Es war die Strafe Gottes für die durch Handel und Ausbeutung von Rohstoffen reichen, sittlich verkommenen Bewohner Rungholts. Quelle: |
||
| 1672 |
Ursache des ersten historisch belegten Murgangs des Varuna-Bachs in der
Schweiz 1672 soll angeblich eine Frau gewesen sein, die dann auch prompt
bei einem Hexenprozess für diese "Untat" verurteilt wurde.
Eine schweizerische Untersuchung beschrieben auf Basis von 122 Hochwassern aus den vergangenen fünf Jahrhunderten stellt deutlich gewisse zeitliche Konzentrationen und Schwerpunkte im Unwettergeschehen der Schweiz fest. Vergleicht man die Hochwasserhäufungen mit den jeweiligen Klimaphasen, so erkennt man allerdings keine klaren Zusammenhänge und auch keine Periodizität. Häufungen von Hochwassern können in allen Klimaphasen vorkommen, sowohl in kalt-kühlem, verschlechtertem Klima, als auch in Perioden kontinentalen Klimas und in Wärmephasen. Das Unwettergeschehen hält sich also an keine starren Regeln, ein empirisches Indiz, dass eine Klimaerwärmung nicht unbedingt auch eine Häufung schwerster Unwetter mit sich bringen muss, wie heute gerne extrapoliert wird. Quelle: |
||
|
1784 |
|
||
| 1862 | en California Megaflood 1861/62 | ||
| 1910 | de Überflutungen 1910 in Paris | ||
| 1927 | |||
| 2010 |
de
Die Überschwemmungen in Pakistan 2010: Klimaänderung oder natürliche Variabilität? en The 2010 Pakistan floods - nothing to do with "climate change |
||
| 2011 | de 2010/2011: Überschwemmungen in Australien und Brasilien | ||
| 2021 | de 2021: Überschwemmungen in Europa - grosse Schäden vor allem in Deutschland |
↑ Flut: Artikel Deutschland
Mit folgendem Link wird von anderen Webseiten auf diese Seite verwiesen.
▶- Vollständige Liste siehe Verzeichnis
↑ 2021-09-15
-
FAZ
2021-09-15 de BaFin befürchtet für Versicherer Kosten von bis zu 8,2 Milliarden EuroDie erwartete Schadenssumme steigt weiter und liegt nun deutlich über der jüngsten Branchenschätzung.
Doch die Finanzaufsicht hält die Assekuranz für stabil.
Die Flutkatastrophe im Rheinland und in der Eifel kostet die deutschen Versicherer nach einer Umfrage der Finanzaufsicht BaFin bis zu 8,2 Milliarden Euro.
Das sind 2,5 Milliarden mehr als die Bonner Behörde vor vier Wochen aus den Daten von 136 Sachversicherern errechnet hatte, und mehr als die rund 7 Milliarden Euro, die der Branchenverband GDV kürzlich nannte.
An die Existenz geht die Flut den Versicherern und Rückversicherern aber nicht, erklärte der oberste Versicherungsaufseher der Bafin, Frank Grund.
"Bei vielen Unternehmen geht die Bedeckungsquote zwar zurück, bei den meisten aber nur geringfügig", sagte er am Mittwoch.
Einen Großteil der Schäden können die Versicherer auf die Rückversicherer abwälzen.
6,3 Milliarden Euro der Schäden seien rückversichert,
3,3 Milliarden davon bei deutschen Rückversicherern, erklärte die BaFin.
Diese rechneten nach der BaFin-Umfrage schlimmstenfalls mit einer Brutto-Belastung von vier Milliarden Euro.
Aber auch davon könnten sie einen Großteil an Konkurrenten abwälzen.
Netto blieben sie maximal auf rund einer Milliarde Euro sitzen.
Die Münchener Rück und die Hannover Rück zählen zu den drei weltgrößten Unternehmen der Branche.
Rückversicherer übernehmen üblicherweise einen Teil von Großschäden, die einzelne Erstversicherer sonst zu überfordern drohten.
Der größte Teil der Nettobelastung der Erstversicherer nach den Überschwemmungen im Westen Deutschlands entfällt laut BaFin
mit rund 900 Millionen auf die Wohngebäudeversicherung,
jeweils rund 200 Millionen entfallen auf die Hausrat- und die Kfz-Kaskoversicherung.
Die Schäden wären noch höher,
wenn nicht nur 46 Prozent der deutschen Hausbesitzer gegen Hochwasser und Sturzfluten versichert wären.
↑ 2021-09-10
-
FAZ
2021-09-10 de Bis zu 30 Milliarden Euro: Bundesrat billigt Hilfen für HochwasserregionenDer Bundesrat hat den Weg frei gemacht für die Milliardenhilfen zum Wiederaufbau in den Hochwasserregionen im Westen Deutschlands.
Für den Fonds stehen bis zu 30 Milliarden Euro zur Verfügung.
↑ 2021-08-30
-
EIKE Europäisches Institut für Klima und Energie
Axel Robert Göhring
2021-08-30 de Hochwasser als Ankündigung und Charakteristikum der Kleinen Eiszeit?Die aktuellen heftigen Schneestürme in Nord und Süd und das häufiger auftretende Hochwasser könnten ein Zeichen des Klimawandels sein -
des natürlichen, und der bringt Kälte.
Das Mittelalter ging im 14. Jahrhundert zu Ende,
und mit ihm die Warmzeitära mit Bevölkerungsexplosion, Höhenburgenbau und ausgetrocknetem Rhein.
Als zentrales Ereignis wird die Pest von 1348 angesehen, die in einigen Städten und Gegenden bis zu drei Viertel der Bevölkerung auslöschte.
Im Laufe der Flut-Berichterstattung der vergangenen Wochen wurde das Magdalenenhochwasser häufiger erwähnt.
Und das war - 1342, sechs Jahre vor der Pest.
Ob ein direkter Zusammenhang besteht, können wir in einem Artikel nicht evaluieren, aber die zeitliche Nähe läßt den Verdacht aufkommen.
Die "Kleine Eiszeit" nach 1400, eigentlich "nur" eine Abkühlungsphase, ist immerhin von einigen Hochwasser-Ereignissen gekennzeichnet.
Ein Grund dafür könnte sein, daß warme Luft mehr Wasser aufnehmen kann und es sich daher seltener in Oberflächengewässern befindet.
Typisches Beispiel ist die "Thüringer Sintflut" von 1613, die mehrere Flüsse meterhoch ansteigen ließ und in Jena, Weimar, Erfurt, Stadtilm, Gotha und Apolda etliche Häuser zerstörte - und über 2.200 Menschen tötete, bei zehnfach geringerer Bevölkerung gegenüber heute.
Es gab seit 1997 mehrere Hochwasser-Ereignisse,
die zeitweilig die Medien beherrschten und Wahlen entschieden.
1997 - die Oderflut,
2002 - das Hochwasser in Bayern und Österreich,
2013 - die Flut im Osten,
2021 - die Flut im Rhein-Einzugsgebiet.
Es sieht nach Häufung aus, und das könnte ein Anzeichen für eine Abkühlung zumindest auf der Nordhalbkugel sein.
Zusammen mit den gewaltigen Schneefällen von Dezember bis Februar, und den derzeitigen Kälterekorden in Brasilien (Kaffee-Ernte fällt aus), kann sogar eine globale Abkühlung vermutet werden.
Ob die Vermutung stimmt, kann erst in 10, 20 Jahren geklärt werden;
Klima-Statistik ist von langen Datenreihen abhängig.
Eines ist aber jetzt schon sicher:
Waldbrände in Südamerika und Australien, und Hitzerekorde in Südeuropa und den Nordwest-USA sind kein Beweis für die Heißzeittheorie der Klima-Alarmisten, die exzellente Geschäfte machen.
↑ 2021-08-09
-
Textatelier / Werner Eisenkopf, Runkel/D
2021-08-09 de Extremhochwasser und Hunderte Tote an der deutschen Ahr - seit 1348 aufgezeichnetDieses extreme Ahr-Hochwasser vom 14./15. Juli 2021, wird bereits massiv instrumentalisiert, in Politik und Medien, um Stimmung in der "Klimadiskussion" anzuheizen und dies im derzeit laufenden deutschen Bundestags-Wahlkampf auszuschlachten.
Dieser Artikel im Textatelier, soll dagegen lediglich die tatsächliche Vergangenheit im Ahrtal aufzeigen, seit es dazu überhaupt noch existierende Überlieferungen/Urkunden gibt.
Diese ergeben dann nämlich ein ganz anderes Bild.
Sie widersprechen allen heutigen Behauptungen,
daß dieses Ahr-Extremhochwasser vom 14./15. Juli 2021,
eine "Folge menschgemachten Klimawandels" sei
und mit irgendwelcher "Klimaschutzpolitik" sogar künftig vermeidbar sei.
Dies ist vielerorts aber gar nicht gewünscht,
das simple verbreitete "Klimabild" soll ja keine Kratzer erhalten.
Wer sich dazu aber dennoch wirklich ein neutraleres Bild machen möchte und eigene Schlüsse ziehen, der kann dafür die folgenden Zeilen und gern auch das Quellenmaterial dazu, in aller Ruhe lesen.
Vorläufige Schlußfrage:
WAS meldeten und melden die Fernsehsender, viele Zeitungen und auch der neue Chef des deutschen Umweltbundesamts und auch etwa eine deutsche Pfarrerin in ihrem Sonntagsbrief?
Das extreme Ahrhochwasser 2021 sei "zweifellos" Folge des menschlich verschuldeten Klimawandels durch die Industrialisierung und damit seit ca. 1850 herum, somit die Übel-Ursache?
Mit sofortigem CO₂-Stoppen könne man dies künftig vermeiden?
Ein "Grünes Norm-Wetter" mit der propagierten "Stellschraube CO₂" zurückgedreht auf irgendeinen ominösen "Durschschnitt" wie er angeblich mal gewesen sein soll und dann gehalten?
In welchem Jahr/Jahrzehnt war das denn der Fall?
Sehr geehrte Damen und Herren Journalisten und Politiker dieser Melderichtung, Sie beleidigen damit aber nun wirklich die Intelligenz der Bürger als Leser und Fernsehzuschauer!
Epilog:
Am 14./15. Juli 2021, brach eine verheerende Naturkatastrophe über das beschauliche Ahrtal herein und tötete über 140 Menschen.
Es wird auch noch viele Jahre dauern, bis die schrecklichen materiellen und auch seelischen Schäden bei den Menschen einigermaßen repariert oder verarbeitet sein werden.
Dies darf jetzt hier genauso wenig vergessen werden, wie die Hilfe und Unterstützung, die dort im Ahrtal und auch in den anderen betroffenen Gebieten, unverändert benötigt werden.
Das sind die traurigen Fakten!
↑ 2021-08-08
-
Tagesschau.de
2021-08-08 de "Hier ist Ingenieurskunst gefragt"Nach der Starkregenkatastrophe wird das Ahrtal nicht so bleiben wie es war.
Was sich verändern muss, damit Menschen weiterhin am Fluss leben können, erklärt der Biologe Wolfgang Büchs im Interview mit tagesschau.de.
Büchs: Ich habe mich gewundert, dass ein solch katastrophales Ereignis dort heute noch so passieren kann.
Gleichzeitig bin ich erstaunt, dass entsprechende Hochwasser-Schutzmaßnahmen nicht getroffen wurden,
obwohl sie schon seit 100 Jahren im Gespräch sind, denn seit Jahrhunderten ist es im Abstand von etwa 100 Jahren immer wieder zu katastrophalen Fluten gekommen.
In den 1920er-Jahren wurden die schon sehr konkreten Pläne zugunsten des Baus des Nürburgrings zurückgestellt.
Dazu zählen Maßnahmen wie Hochwasser-Rückhaltebecken, die insgesamt 11,3 Millionen Kubikmeter Wasser hätten zurückhalten können.
↑ 2021-08-07
-
Ruhrkultour / Fred F. Mueller
2021-08-07 de Flutkatastrophe: Totalversagen der Klimawandel-ProphetenDie Flutkatastrophen infolge des Tiefs Bernd haben nicht nur in Deutschland, sondern auch in Nachbarländern ungeheure Schäden hinterlassen,
zahlreiche Menschenleben gefordert und viele Existenzen vernichtet.
Jetzt behaupten landauf, landab Fernsehen, Zeitungen und Politiker lautstark, diese Katastrophe sei eine Folge des "menschengemachten Klimawandels durch CO₂".
Deshalb solle Deutschland künftig mehr in "Klimaschutz" investieren.
Dabei haben gerade diese Verfechter eines drohenden Weltuntergangs mit dazu beigetragen, dass die Bevölkerung nicht rechtzeitig gewarnt wurde.
Angesichts von vermutlich mehr als 200 Toten und tausender vernichteter Existenzen ist jetzt nicht der Moment für freundliche Worte.
Jetzt muss Tacheles geredet werden, müssen Verantwortliche bis in höchste Ebenen genannt werden.
Dieser Fisch stinkt vom Kopf her, und davon sollte man sich nicht durch Bauernopfer bei Landräten ablenken lassen

 Am 14.7. um 17.00 Uhr herausgegebene Karte
mit Warnungen vor extremer Überflutungsgefahr
Am 14.7. um 17.00 Uhr herausgegebene Karte
mit Warnungen vor extremer Überflutungsgefahr


 Die durchschnittliche Regenmenge in Deutschland
Die durchschnittliche Regenmenge in Deutschland
hat seit Beginn der systematischen Erfassung um rund 8 % zugenommen.
Mittelwert: Rot, Trend: gepunktet

Doch obwohl der Blick auf die Grafik zeigt, dass dies durchaus nicht ungewöhnlich ist, haben sich zahlreiche Klimapropheten - darunter der DWD und das Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung mit seinen bunten Dürremonitor-Bildern (Bild 4) - darauf versteift, dass Deutschland wegen des Klimawandels künftig verstärkt mit Dürren zu rechnen habe.
Wie die Talsperren auf Linie gebracht wurden
Zu den üblen Folgen dieser falschen Prognosen gehört, dass deshalb eines der effizientesten Mittel zur Minderung von Flutrisiken falsch eingesetzt wurde:
Unsere Talsperren.
Diese sorgen nicht nur für die Vorratshaltung von Wasser für niederschlagsarme Zeiträume, sie können andererseits bei Unwettern auch große Regenmengen speichern und so die Flutgefahr mindern -
wenn sie denn richtig gemanagt werden,
Kleiner Beitrag zur Faktensammlung:
Hochwasserereignisse im Rheingebiet
Wikipedia Zeitreihe der Niederschlagssummen in Deutschland seit 1881

Weiterlesen:
In der Tagesschau am Abend des 14.7. kein Wort von extremer Flutgefahr
Ferner:
Ein Warnsystem wie in einem Drittweltland
Klimawarner auf höchster Drehzahl
Die direkte Verantwortung der Klimapropheten
Wie die Talsperren auf Linie gebracht wurden
↑ 2021-08-06
-
Focus Online / Frank Gerstenberg
2021-08-06 de Drei Wochen nach der Hochwasser-Katastrophe
"Total im Stich gelassen": Ahrweilers Flutopfer kochen vor Wut über mangelnde Hilfe21 Tage nach der Flutkatastrophe mit allein 139 Toten im Landkreis Ahrweiler
leben zahlreiche Menschen im Ahrtal zwischen Blankenheim und Remagen nach wie vor ohne Wasser, Strom, Duschen und Toiletten.
FOCUS Online sprach mit den Menschen in Bad Neuenahr, die von Stadt und Landrat, jedoch auch von Technischem Hilfswerk und Feuerwehr allein gelassen werden.
"Es ist eine Frechheit, was hier mit uns passiert", sagt Markus Reisenhofer (34).
Der Fernfahrer war beruflich in Bremen, als ihn um 3 Uhr in der Nacht vom 14. Juli auf den 15. Juli eine WhatsApp-Nachricht seines Vaters erreicht:
"Bad Neuenahr gibt es nicht mehr." Reisenhofer versteht nicht.
"Ich dachte erst, er macht einen Witz."
Drei Stunden später schickt ihm ein Kollege ein Foto seines Autos:
Der blaue Ford Focus schwimmt auf dem Betriebshof seiner Spedition.
Nur die Antenne ragt noch aus dem Wasser.
Zur gleichen Zeit kommt noch eine Nachricht des Vaters, der im selben Häuserblock wohnt:
"Du hast keine Wohnung mehr." Reisenhofer ist fassungslos:
"Man hat sich über Jahre eine Existenz aufgebaut und dann ist in wenigen Stunden alles zerstört", sagt der schlaksige schwarzhaarige Mann in der dunkelblauen Arbeitshose.
"Niemand war hier, niemand hat gefragt, wie es uns geht"
Auf den Tag genau drei Wochen nach der Flut führt Reisenhofer den Reporter durch seine Wohnung:
In der Küche steht ein Stromaggregat.
Im Wohnzimmer stapeln sich Müllsäcke und Decken.
An den Vorhängen ist zu erkennen, wie hoch das Wasser stand in der Erdgeschosswohnung, die immerhin noch ein halbes Stockwerk über der Straße liegt.
"Die Wohnung ist unbewohnbar", sagt er.
Er lebt inzwischen in einer Notunterkunft, wenn er nicht mit seinem LKW unterwegs ist.
Von der Stadt habe sich noch niemand blicken lassen.
Weder Bürgermeister Guido Orthen (CDU) noch andere Offizielle.
"Niemand war hier", sagt Reisenhofer.
"Niemand hat uns gefragt, wie es uns geht, wie wir die Flut erlebt haben."
Orthen sagte in einem Interview mit der FAZ, dass man bei der Versorgung mit Strom und Wasser schon "sehr weit" sei.
Die Menschen an der Kreuzstraße können darüber nur lachen:
"Wir machen uns das Wasser auf Gaskochern warm und schütten es uns dann über den Kopf.
Das ist unsere Dusche", sagt Marion Scholz (71).
Zum Waschen nehme sie Mineralwasser.
Ihr Nachbar Klaus Wächter (77) hat keine Wohnungstür mehr.
Auch keine WC-Tür.
Wenn er auf die Toilette geht, sage er laut im Haus Bescheid, damit keiner ungelegen zu Besuch kommt.
Landesamt für Umwelt bestätigt, dass Landkreis frühzeitig gewarnt wurde
Bürgermeister Guido Orthen sagte im Interview mit der FAZ, dass er "für eine Schulddiskussion nicht zur Verfügung" stehe.
"Zynisch" sei das, "ein Skandal", sagt Inge Willmann (56), die im gleichen Haus wie Scholz und Wächter wohnt.
"Was da auf uns zukommt, hätte jeder der Verantwortlichen wissen müssen", sagt die Frau mit dem Pferdeschwanz, die als Disponentin bei einer Zeitung arbeitet.
"Der Landrat und der Bürgermeister sind hier komplett unten durch".
Willmann fordert: "Beide haben total versagt und müssen zurücktreten."

Weiterlesen
↑ 2021-08-05
-
FAZ / Oliver Schlömer, Jens Giesel und Manfred Lindinger
2021-08-05 de Déjà-vu der KatastropheWar die Flutkatastrophe im Ahrtal ein bislang einmaliges Ereignis und schon der Vorbote des Klimawandels?
Zwei Bonner Geoforscher sind skeptisch und liefern neue Erkenntnisse.

 Luftbild des Ortsteils Altenburg in Altenahr
vor dem Hochwasser
Luftbild des Ortsteils Altenburg in Altenahr
vor dem Hochwasser


 Eine Luftaufnahme vom 15. Juli zeigt den
vom Ahr-Hochwasser überflutenden Ortsteil
Eine Luftaufnahme vom 15. Juli zeigt den
vom Ahr-Hochwasser überflutenden Ortsteil


 Rekonstruierte Abflussmengen
Rekonstruierte Abflussmengen
Spitzenabflüsse des Hochwassers vom 14. Juli 2021
Schuld 500 bis 600 m3/sec
Dernau 1.000 bis 1.200 m3/sec
Walporzheim 1.200 bis 1.300 m3/sec
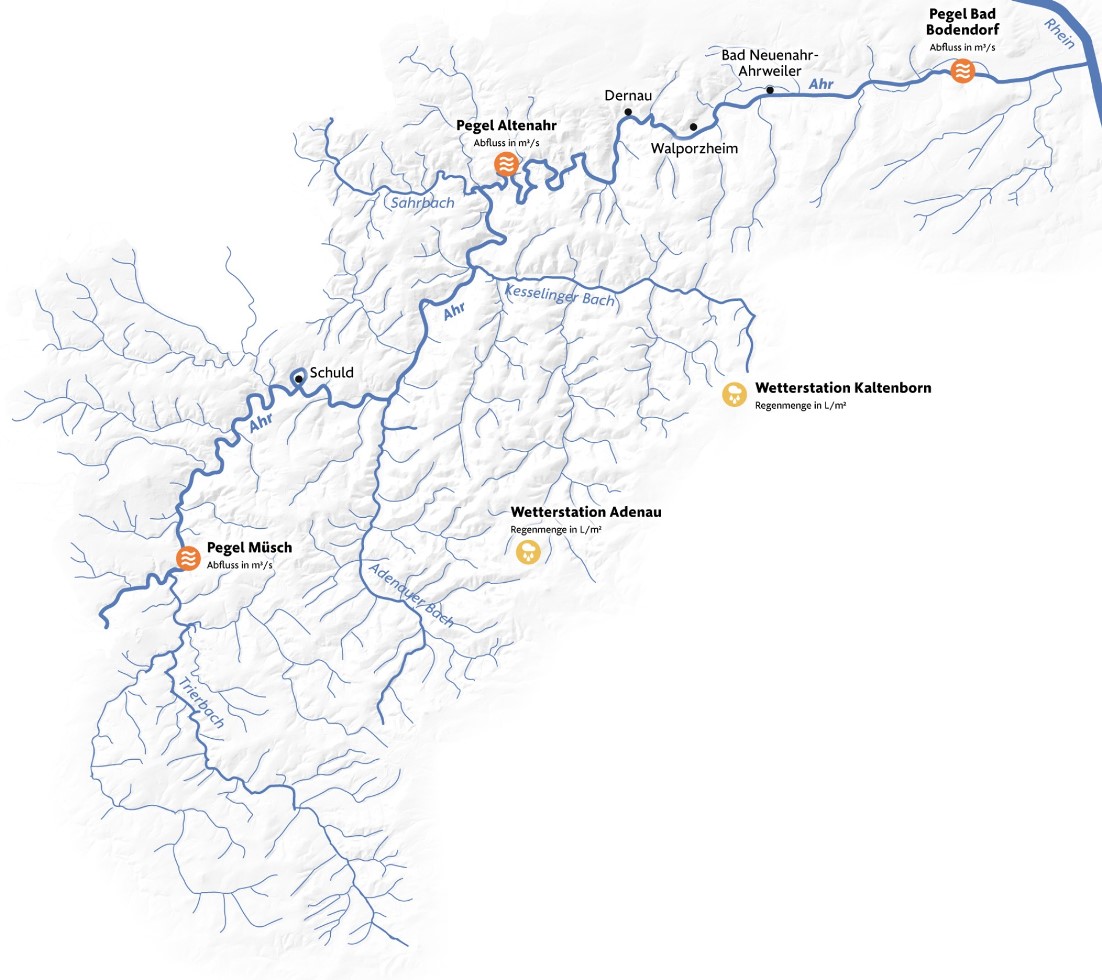
1348: Ahr-Hochwassers
Die früheste Erwähnung eines Ahr-Hochwassers datiert bereits auf das Jahr 1348.
30. May 1601: Antweiler
An diesem Tag erhob sich unversehens am Nachmittag ein Ungewitter mit Regen und Hagel, verfinsterte sich der Himmel, die Schleusen des Himmels öffneten sich und unvorstellbare Wassermassen stürzten hernieder, so daß die entsetzten Bewohner an den Weltuntergang glaubten"
Juli 1804
Spitzenabflüsse in Kubikmeter pro Sekunde
Dernau 1.000 bis 1.300Flussabwärts im rund 10 Kilometer entfernten Dernau waren es im Juli 1804 sogar unglaubliche 1.000 bis 1.300 Kubikmeter pro Sekunde.
Ein trauriger Rekordwert, der in den folgenden zweihundert Jahren nicht ansatzweise erreicht werden sollte.
Juni 1910: Altenahr
Spitzenabflüsse in Kubikmeter pro Sekunde
Dernau 500 bis 650
Deutlich höhere Spitzenabflüsse (als am 2. Juni 2016) konnten Roggenkamp und Herget in Altenahr für den Juni 1910 rekonstruieren.
Ihren Berechnungen zu Folge strömten damals 450 bis 650 Kubikmeter pro Sekunde durch Altenahr.
2. Juni 2016: Ahr
Spitzenabflüsse in Kubikmeter pro Sekunde
Altenahr 236Beim bislang höchsten gemessenen Hochwasser flossen am 2. Juni 2016 236 Kubikmeter pro Sekunde durch die Ahr.
Juli 2021: Hochwasser
Spitzenabflüsse des Hochwassers vom 14. Juli, in Kubikmeter pro Sekunde
Schuld 500 bis 600
Dernau 1.000 bis 1.200
Walporzheim 1.200 bis 1.300"In der historischen Einordung zeigt sich, dass es sich bei dem Hochwasser vom Juli 2021 um eine Wiederholung des Hochwassers vom Juli 1804 handelt", erklärt Roggenkamp.
Damals wie heute war sommerlicher Starkregen der Auslöser des Hochwassers.
"Trotz vergleichbarer Abflussgrößen erreichte das Hochwasser vom Juli 2021 größere Wasserstände als 1804.
In Dernau lag der Wasserstand ca. 1,5 Meter oberhalb des Wasserstandes von 1804.
Die heute dichtere Bebauung des Hochwasserbetts verkleinert die durchströmte Fläche und ließ die Wasserstände lokal überproportional ansteigen."
"Exakte Berechnungen des Spitzenabflusses sind durch das Auftreten von pulsierendem Abfluss erschwert", erklärt Roggenkamp.
"Sogenannte Verklausungen an Brücken und anderen Querbauwerken - durch angespülte Bäume, Autos und andere Trümmerteile - erzeugten Barrieren und ließen den Wasserstand durch Rückstau steigen.
Nach dem Bruch, oder dem Überspülen der Barriere, sank der Wasserstand dann plötzlich."
Nicht nur die angeschwemmten Barrieren brachen unter dem Druck des anströmenden Wasser zusammen, auch wurden zahlreiche Brücken schwer beschädigt oder sogar vollkommen zerstört.
"Das Hochwasser vom Juli 2021 ist als extremes, aber nicht einmaliges Ereignis einzustufen.
Ähnliches hat sich bekanntermaßen bereits in vorindustrieller Zeit ereignet".
Thomas Roggenkamp
"Im Ahrtal wurde wie in vielen anderen Orten in ganz Deutschland in die natürlichen Überschwemmungsgebiete der Flüsse gebaut.
Es ist eine politische Abwägung,
welche Nutzungen innerhalb des Hochwasserbetts zukünftig ausgewiesen werden
und welche Schutzmaßnahmen für die bestehenden Ortslagen im Hochwasserbett getroffen werden sollen."
Obwohl die Unsicherheiten der Extremwertstatistik bei geringem Stichprobenumfang bekannt sind,
wurden die schweren Hochwasserereignisse von 1804 und 1910 in der Beurteilung der Gefährdungsabschätzung nicht berücksichtigt.
Dann kam es zur Flutkatastrophe am 14. Juli 2021.
↑ 2021-08-03
-
Deutschlandfunk
2021-08-03 de Hitzewellen und Unwetter "Das ist Wetter, das aus Klimaveränderungen resultiert"Wochenlange Hitze oder wochenlang Tiefdruckgebiete und Regen - solche Wetterszenarien werden wir in den kommenden Jahren deutlich häufiger erleben, sagte die ARD-Wetterexpertin Claudia Kleinert.
Im Gespräch mit dem Dlf erläuterte sie, warum festzementierte stabile Wetterlagen Folgen des Klimawandels sind.
Mit solchen Wetterszenarien sei in den kommenden Jahren deutlich häufiger zu rechnen.
"Weil das auch eine Folge des Klimawandels ist, eingefahrene Wetterlagen", so Kleinert.
Von Zufall oder einem Ausrutscher könne man aufgrund der - zum Teil extremen - Wetterereignisse der vergangenen sechs Jahre nicht mehr sprechen, betonte die Wetterxpertin.
↑ 2021-07-27
-
Rhein Zeitung / Dirk Eberz, Manfred Ruch, Angela Kauer-Schöneich und Anke Mersmann
2021-07-27 de Bad Neuenahr-Ahrweiler: Landesamt sah den Pegelstand von sieben Metern um 20 Uhr voraus - Evakuierungsaufruf erfolgte um 23.09 UhrDas Mainzer Landesamt für Umwelt hat am 14. Juli schon um kurz nach 20 Uhr eine Flutwelle von sieben Metern für die frühen Morgenstunden des 15. Juli im Ahrtal vorhergesagt.
Das geht aus einem Diagramm hervor, das unserer Zeitung vorliegt.
Wie der Abteilungsleiter Hydrologie, Thomas Bettmann, auf Anfrage unserer Zeitung bestätigte, ist die Prognose mithilfe von Computermodellen erstellt und dann automatisiert an Landkreise und Katwarn weitergegeben worden.
Gegen 20.45 Uhr wurde demnach der Pegel in Altenahr beim Stand von 5,75 Metern von den Fluten weggerissen.
Ein Vorfall, den der Diplom-Ingenieur noch nie erlebt hat.
Danach fiel die digitale Datenübermittlung aus.
Die Hydrologen des Landesamts mussten deshalb mit Simulationen arbeiten, in die vor allem die Niederschlagsmengen einflossen.
Und es schüttete bis tief in die Nacht hinein fast ohne Unterlass wie aus Eimern. 120 bis 140 Liter pro Quadratmeter, sagt Hydrologe Bettmann.
Nicht die befürchteten 200 - dafür aber flächendeckend und über rund zwölf Stunden.
Hinzu kam, dass der Starkregen auf gesättigte Böden traf, was die Lage zusätzlich verschärfte.
Das Wasser konnte nicht versickern, floss fast komplett ab und türmte sich zu einer gigantischen Flutwelle auf, die wie ein Tsunami durchs enge Tal rauschte.
Auf wie viele Meter die Ahr in dieser verheerenden Katstrophennacht tatsächlich anschwoll, muss das Landesamt noch exakt auswerten.
Denn Messungen ohne Pegel sind für die Wissenschaftler ein Stück weit wie ein Blindflug.
Aber man geht von rund acht Metern aus.
Die Folgen sind katastrophal.
Auch weil erst um 23.09 Uhr die Meldung rausging, einen jeweils 50 Meter breiten Streifen rechts und links des Flusses zu evakuieren.
Viel zu spät.
Und auch viel zu schmal.
Die Flutkatastrophe forderte am Ende mindestens 132 Todesopfer, 74 Menschen werden weiter vermisst.
Was sich da am 14. Juli zusammenbraute, war auf dem Diagramm des Landesamts für Umwelt auch für Laien sehr gut zu erkennen.
Schon am frühen Nachmittag machte die Kurve einen scharfen Knick nach oben.
In den folgenden Stunden verwandelte sich die Ahr von einem harmlosen Flüsschen in einen tödlichen Strom.
Innerhalb weniger Stunden schwoll der Pegelstand bei Altenahr von 90 Zentimetern auf fast sechs Meter an.
Zum Vergleich: Beim Hochwasser von 2016 wurden "nur" gut 3,70 Meter erreicht - mit schweren Folgen.
Um 17.17 Uhr rief das Landesamt für Umwelt schließlich die höchste Warnstufe "lila" aus.
Da stand der Pegel schon bei 2,78 Metern. Um 17.40 Uhr trat der Krisenstab in der Kreisverwaltung um Landrat Jürgen Pföhler und Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Michael Zimmermann zusammen.
Sie mussten hilflos mit ansehen, wie das Wasser stieg und stieg.
Bis sich am frühen Abend plötzlich eine allgemeine Erleichterung breit machte.
Landrat Pföhler sprach im Exklusivinterview mit unserer Zeitung am Sonntag von einem Schlüsselmoment: "Der prognostizierte Pegelstand von fünf Metern wurde um 19.09 Uhr vom Hochwassermeldedienst Rheinland-Pfalz auf gut vier Meter herunterkorrigiert.
Das muss man wissen", sagte er.
Tatsächlich hatte der Deutsche Wetterdienst (DWD) seine Prognosen für den Pegel Altenahr am frühen Abend kurzeitig gesenkt, dies aber rasch wieder revidiert, wie Recherchen unserer Zeitung ergaben.
Doch bei den Verantwortlichen vor Ort kam diese Korrektur offenbar nicht zeitnah an.
Sie gingen offenbar weiter von der trügerischen Annahme aus, dass sich die Lage entspannt hatte.
Das bestätigt auch das Telefonat eines Sinziger Feuerwehrmanns, das von Passanten am 14. Juli gegen 21.30 Uhr zufällig mitgehört wurde.
Demnach war die dortige Feuerwehr darüber informiert worden, dass sich der Scheitelpunkt zu diesem Zeitpunkt bereits in Ahrweiler befinde.
Man rechnete an der Ahrmündung noch mit einem Anstieg der Flut um eineinhalb bis zwei Meter.
Besorgniserregend, aber beherrschbar.
Nach 19.09 Uhr herrschte jedenfalls kollektives Aufatmen im Krisenstab.
"Wenn wir uns mal das sogenannte Jahrhunderthochwasser von 2016 im Ahrkreis anschauen, war damals der höchste Pegelstand 3,71 Meter", erinnert sich Pföhler.
"Da sage ich mal wertend für alle diese Einheiten:
Gut. Damals hatten wir 3,71, jetzt haben wir vier."
Etwa zu der Zeit stieß dann auch Innenminister Roger Lewentz (SPD) zur technischen Einsatzleitung hinzu.
Lewentz sprach von einem ruhig und konzentriert arbeitenden Krisenstab, den er gegen 19.30 Uhr wieder mit dem Gefühl verließ, dass die Lage im Griff sei.
Einen Anlass, die Bevölkerung aus dem Gebiet zu evakuieren, sah man jedenfalls nicht.
"Auch Minister Lewentz hatte keine andere Einschätzung", betonte Pföhler am Sonntag.
Die Folgen waren fatal, denn der Pegel in Altenahr sank nicht.
Ganz im Gegenteil:
Er überschritt sogar die zuvor prognostizierten fünf Meter und schnellte in nicht mal zwei Stunden auf 5,75 Meter hoch.
Danach riss der Pegel selbst ab, die Fluten hatten ihn mitgerissen.
Der Wasserstand veränderte sich somit nicht mehr.
Das fiel in der Einsatzzentrale aber erst später auf.
"Irgendwann gegen 22 Uhr war klar, der Pegel ändert sich nicht mehr, da ist irgendwas", sagte Fachbereichsleiter Erich Seul am Sonntag.
Die Vorhersage des Landesamts für Umwelt hatte allerdings schon zwei Stunden früher gezeigt, welche Wasserwand auf das Ahrtal zurollt.
Warum also sind wertvolle 120 Minuten verstrichen?
Klare Antworten gab es auch am Montag bei einer Pressekonferenz zur Lage im Katastrophengebiet nicht.
Auf dem Podium: Innenminister Lewentz und Landrat Pföhler.
Man wollte offenbar einen Schulterschluss demonstrieren nach Tagen, in denen sich die beiden nicht gemeinsam zur Katastrophe im Ahrtal geäußert hatten.
Noch einmal beschrieb der Landrat, dass alle Beteiligten im Krisenstab zunächst erleichtert waren, aufatmeten - und dann von der Realität überrollt wurden.
"Es war wie ein Tsunami, der alle überfordert hat", bekräftigt Pföhler.
Die Rettungskräfte seien ebenso von der Situation überfordert gewesen wie die Kräfte im Lagezentrum des Landes bei der ADD, "weil es so etwas noch nie in Deutschland gegeben hat".
Worte, die er im Gespräch mit unserer Zeitung später noch mal wiederholte.
An das Land gerichtet, forderte er, dass beim aktiven Hochwasserschutz jetzt endlich etwas getan werden müsse.
"Für mich stellt sich auch die Frage: Müssen wir die Ahr womöglich verlegen?"
↑ 2021-07-23
-
NZZ / Eric Gujer, Chefredaktor der «Neuen Zürcher Zeitung».
2021-07-23 de DER ANDERE BLICK - Die billigste Ausrede nach dem Hochwasser: Der Klimawandel ist an allem schuldNach einer Flutkatastrophe ist die Versuchung gross, dafür die Erderwärmung verantwortlich zu machen.
Eindimensionale Erklärungen sind jedoch gefährlich.
So spricht einiges dafür, dass der Hochwasserschutz vernachlässigt wurde.
Kanzlerin Merkel tut es, Ministerpräsident Laschet tut es auch und die Grüne Baerbock sowieso.
Alle Parteien mit Ausnahme der AfD fordern als Reaktion auf das Hochwasser mehr Klimaschutz.
Wenn alle Politiker dasselbe sagen, sollten die Bürger misstrauisch werden.
Entweder sind die Forderungen tatsächlich alternativlos, dann fragt man sich allerdings, weshalb Bund und Länder sie nicht längst umgesetzt haben.
Oder die Politiker zeigen mit dem Finger so resolut in die eine Richtung, um von eigenen Versäumnissen abzulenken und in der Stunde der Not Entschlossenheit und Handlungsfähigkeit zu simulieren.
Die dritte Möglichkeit ist eine Mischung aus allem.
Die richtige Antwort auf die Flutkatastrophe fällt nicht so einfach aus, weil die Lage unübersichtlich ist und verschiedene Faktoren beim Entstehen des Hochwassers mitgewirkt haben.
Die Welt ist nun einmal komplizierter, als durch den Matsch stapfende Politiker ihre Wähler glauben machen wollen.
Die Parteien denken, sie hätten jeden Wahlkampf schon verloren, wenn sie komplexe Zusammenhänge zu erläutern versuchten.
Sie halten die Bürger für reichlich einfach gestrickt oder zumindest für unwillig, sich mit Sachverhalten zu beschäftigen, die sich nicht in der Schlagzeile einer Boulevardzeitung zusammenfassen lassen.
Claus Kleber ist ein Meister der Apokalypse
Der Klimawandel begünstigt ohne Zweifel Starkregen, weil warme Luft mehr Feuchtigkeit aufnehmen kann.
Allerdings haben in Deutschland solche sintflutartigen Niederschläge in den Sommermonaten nicht zugenommen.
Eine andere Theorie besagt, der in grosser Höhe von West nach Ost wehende Jetstream werde durch den Klimawandel so beeinflusst, dass er die Ausbreitung von stationären Wetterlagen wie das Tief «Bernd» fördere.
Der Erklärungsversuch ist allerdings unter Meteorologen umstritten.
Eine klare Evidenz gibt es nicht, was das «heute journal» nicht daran hinderte, die Behauptung mehr oder minder als Tatsache auszugeben.
Nicht nur die Politik, auch der öffentlichrechtliche Rundfunk verbreitet das Narrativ:
Der Klimawandel ist an allem schuld.
Ein Meister des Framings ist der ZDF-Moderator Claus Kleber.
Mit apokalyptischem Timbre raunt er von den Naturgewalten, welche den Menschen für den Raubbau an der Schöpfung bestrafen würden.
Kleber verbreitet seine kruden Theorien selbst dann, wenn eine Interviewpartnerin schüchtern darauf hinweist, der Klimawandel spiele sicher eine Rolle, sei allerdings gewiss nicht der einzige Grund für die Überschwemmungen.
Framing ist allemal wichtiger als Fakten.
Warum das so ist, darüber lässt sich nur spekulieren.
Will man in öffentlichrechtlichen Redaktionen den Grünen im Wahlkampf helfen?
Oder regt sich die deutsche Lust an der Romantik mit ihrer Neigung, den Menschen als Störfaktor für eine im Urzustand heile Natur zu betrachten?
Wie sehr sich die Romantik in der deutschen Politik manifestiert, zeigte sich früher in der Angst vor dem Waldsterben oder zeigt sich heute im irrationalen Umgang mit der Atomenergie, deren Beitrag zum Kampf gegen den Klimawandel man wider alles Wissen leugnet.
Von den Vermutungen zurück zu den Tatsachen.
Das besonders verwüstete Ahrtal wurde letztmals 1910 von einer vergleichbaren Flutwelle mit damals 57 Todesopfern heimgesucht.
Verheerende Überschwemmungen sind also im Wortsinn eine Jahrhundertkatastrophe - selten, aber eben doch wiederkehrend.
Helmut Lussi, der Bürgermeister der Gemeinde Schuld, berichtete in der «Welt», die Lage sei ausser Kontrolle geraten, als sich von der Ahr mitgerissene «Campingmobile und Öltanks, grosse Bäume und Autos» in einer Brücke verkeilt hätten.
Daraufhin habe sich das Wasser seinen Weg mitten durch die Ortschaft gesucht.
Haben die Behörden die Gefahrenstellen in den Flusstälern konsequent entschärft?
Die Schilderung erinnert an das Hochwasser in Brig im schweizerischen Bergkanton Wallis im Jahr 1993.
Damals löste Schwemmgut die Katastrophe aus.
Es verstopfte den Durchfluss unter einer Brücke in der Innenstadt, nachdem das Flüsschen Saltina wegen heftiger Regenfälle angeschwollen war.
Die Behörden zogen die Lehren aus der Überschwemmung mit zwei Todesopfern.
Sie bauten nicht nur Rückhaltebecken für das Schwemmgut, sondern auch eine hydraulische Brücke, die bei steigendem Pegel automatisch angehoben wird.
Das System bewährt sich.
Obwohl die Saltina im Oktober 2000 dreissig Prozent mehr Wasser führte als 1993, kam es zu keinen grösseren Problemen.
Ein ähnlicher Weckruf war in der Schweiz das Hochwasser 2005.
Danach investierten die Kantone an Bächen, Flüssen und Seen in den Hochwasserschutz.
So fielen in der letzten Woche die Schäden trotz regional höheren Pegelständen als 2005 deutlich geringer aus.
Es ist natürlich viel leichter, den Klimawandel verantwortlich zu machen, als der Frage nachzugehen, ob Versäumnisse beim Hochwasserschutz das Ausmass der Katastrophe mitverursacht haben.
In den Alpen gehören Schlammlawinen, sogenannte Murgänge, zum Alltag nach starken Regenfällen.
Hat man im Berchtesgadener Land die baulichen Schutzvorkehrungen in den letzten Jahrzehnten kontinuierlich modernisiert?
In engen Tälern wie an der Ahr entwickelt Wasser in Engstellen die reissende Kraft einer Turbine.
Die hydraulischen Effekte, die selbst unscheinbare Bäche innerhalb weniger Stunden zu Todesfallen werden lassen, sind gut erforscht.
Wurden sie in den Mittelgebirgen unterschätzt, weil man Murgänge und Überflutungen als ein Phänomen von Alpen und grossen Flüssen betrachtete?
An Rhein und Mosel hat man nach Hochwassern in den achtziger Jahren viel Geld für mobile Barrieren und andere Vorrichtungen ausgegeben.
Die nächsten Wochen werden zeigen, ob entlang von Ahr und Erft mit gleicher Sorgfalt vorgegangen wurde.
Wenn sich herausstellen sollte, dass die Behörden die letzten Jahre nur unzureichend zur Vorbereitung genutzt haben, werden sich die Landesregierungen der Debatte über die politische Verantwortung stellen müssen.
Verständlicherweise reden Markus Söder, Armin Laschet und Malu Dreyer lieber über die Erderwärmung.
Angesichts der ungewöhnlich vielen Toten wird auch zu klären sein, ob die Frühwarnsysteme funktionierten und ob die Behörden Warnungen rasch genug weitergaben.
Es wird sich zeigen, ob man sich mit Alarmplänen und der Aufklärung der Bevölkerung für den schlimmstmöglichen Fall gewappnet hat.
Erste Stimmen beklagen bereits, Warnungen seien zu spät verbreitet worden.
Mit Erstaunen vernimmt man die Äusserung von Innenminister Horst Seehofer, die Bundesrepublik habe in Gefahrenlagen kein flächendeckendes Sirenensystem, aber auch keine andere Warnvorrichtung.
In der Schweiz ist das in durch Hochwasser gefährdeten Zonen, etwa entlang der Sihl, Standard.
Galt in Deutschland einmal mehr die Devise «Geiz ist geil»?
Laut einer Faustformel verhindert jeder Euro für den Hochwasserschutz knapp drei Euro an Schäden.
Die Investitionen rechnen sich also.
Eine Doppelstrategie gegen die Erderwärmung
Fragen müssen beantwortet und Schwachstellen ausgemerzt werden:
Verbesserungen, die Menschenleben retten und Sachschäden vermeiden.
Was konkret getan werden kann, muss jetzt angepackt werden.
Daher ist es gefährlich, wenn Politiker die Flutkatastrophe vorrangig unter dem Gesichtspunkt der Erderwärmung diskutieren.
Im besten Fall dämpfen die Massnahmen zum Klimaschutz ohnehin nur den Temperaturanstieg der Atmosphäre.
Die Rückkehr zu einem wie auch immer gearteten Status quo ante ist illusorisch.
Mit anderen Worten:
Die bereits eingetretenen Wetterphänomene wie die Häufung von Extremereignissen lassen sich nicht rückgängig machen.
Die Anpassung an die Veränderungen ist unausweichlich.
Der Streit, ob der Klimawandel bekämpft werden muss oder ob die Adaption an die Verhältnisse genügt, ist eine Scheindebatte.
Es braucht beides.
Der Worst Case ist dabei noch gar nicht eingerechnet: dass die europäischen Anstrengungen für einen nachhaltigen Klimaschutz wirkungslos verpuffen, weil der Rest der Welt nicht im gleichen Ausmass mitzieht.
Hier wird ein gravierender Unterschied sichtbar, der in Zukunft noch Kopfzerbrechen bereiten könnte.
Selbst kleinere technische und bauliche Anpassungen an den Klimawandel zeigen im nationalen Rahmen unmittelbar Wirkung, umfangreiche Programme wie das der EU zur Dämpfung des Temperaturanstiegs womöglich nicht.
↑ 2021-07-22
-
NZZ / Simon Haas
2021-07-22 de Ist der Klimawandel schuld an der Flutkatastrophe?Starkregen hat es schon immer gegeben, das zeigen historische Wetterdaten.
Durch die globale Erwärmung könnten solche Ereignisse zwar häufiger auftreten.
Die jüngste Hochwasserkatastrophe auf den Klimawandel zu schieben, greift aber zu kurz.
Klimaaktivisten sind sich ihrer Sache sicher:
Die Erderwärmung ist schuld an der Jahrhundertflut, Klimaschutz der beste Katastrophenschutz.
Auch viele Politiker und Medien verwiesen schnell auf den Klimawandel und schoben die Verantwortung für das Hochwasser in Deutschland auf einen fernen Höhenwind über dem Nordatlantik.
In ihren Wetterberichten am Vorabend der Katastrophe hatten dieselben Medien noch über eine verregnete Tomatenernte berichtet (SWR Rheinland-Pfalz) und von «kräftigem Dauerregen» gesprochen (ZDF).
Zu diesem Zeitpunkt lag seit zehn Stunden eine konkrete Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) vor, vom europäischen Hochwasser-Warnsystem Efas bereits seit drei Tagen.
Politik und Medien hätten es besser wissen können.
Denn Hochwasserkatastrophen nach langanhaltendem Starkregen gab es schon immer.
Schon vor dem Klimawandel. Auch im Ahrtal.
Noch kein Trend zu mehr Regen im Sommer
Fakt ist aber:
Die globale Erwärmung führt zu mehr Niederschlag, weil warme Luft mehr Feuchtigkeit aufnehmen kann.
Tatsächlich haben auch in Deutschland die Niederschlagsmengen seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1881 zugenommen.
Nur für den Sommer zeigt sich kein eindeutiger Trend.
Beim Starkregen hingegen ist die Datenlage noch vergleichsweise dünn.
Zwar beobachten die DWD-Klimatologen seit Beginn der Radarmessungen im Jahr 2001 einen Anstieg von langanhaltendem, starkem Niederschlag.
Noch sei der Beobachtungszeitraum aber zu kurz, um Aussagen über das Klima zu treffen.
«Für den Sommer lassen sich derzeit mit den vorhandenen Beobachtungsdaten und den bekannten Methoden keine Trends der Anzahl von Tagen mit hohen Niederschlagsmengen identifizieren», schreibt der DWD in seinem Klimareport.
Für andere Regionen, etwa die Schweiz, ist die Zunahme besser dokumentiert.
Hochwasser im Einzugsgebiet grosser deutscher Flüsse kommen laut einem Bericht des Umweltbundesamts ebenfalls nicht häufiger vor als früher.
Die Daten zeigen allerdings nicht, wie gross das Ausmass des jeweiligen Hochwassers war.
Bild: Hochwasser an deutschen Flüssen haben nicht zugenommen
«Einzelereignisse wie das Hochwasser in Westdeutschland ursächlich auf den Klimawandel zurückzuführen, ist nach wie vor sehr schwierig», betont der Klimaforscher Sebastian Sippel von der ETH Zürich.
Der Einfluss der globalen Erwärmung lässt sich allerdings mit sogenannten Attributionsstudien beziffern.
So konnten Wissenschafter zeigen, dass Starkregenereignisse an der Seine und der Loire im Jahr 2016 durch den Klimawandel etwa doppelt so häufig auftreten.
Für den Starkregen an der Elbe und der Donau im Jahr 2013 gelang ihnen ein solcher Nachweis hingegen nicht.
Für die Flut im Jahr 2021 steht eine solche Studie noch aus.
Mehr Hochwasser - aber nicht zwangsläufig gefährlicher
In Zukunft dürften sich Extremwetter-Ereignisse wie langanhaltender Starkniederschlag aber auch in Deutschland häufen.
Das zeigen Szenarien der Klimaforscher.
Um zukünftige Entwicklungen besser voraussagen zu können, lohnt sich auch der Blick in die Vergangenheit:
Laut einem internationalen Forscherteam um Günter Blöschl von der TU Wien befindet sich Mitteleuropa inmitten einer Hochwasserphase.
Von diesen Phasen gab es in den letzten 500 Jahren insgesamt neun, jeweils in unterschiedlichen Regionen Europas.
Die gegenwärtige Flutphase unterscheidet sich laut der Studie allerdings von ihren Vorgängern:
Früher kam es in Kältephasen zu Überschwemmungen, heute treten sie eher im Sommer auf.
Selbst wenn Hochwasser im Sommer künftig zunehmen, müssen diese nicht zwangsläufig zu mehr Todesopfern und grösseren Sachschäden führen - trotz wachsender Bevölkerung.
Laut einer Studie der Gemeinsamen Forschungsstelle der EU-Kommission sind Sturzfluten und Flusshochwasser global gesehen weniger gefährlich als früher.
Als Grund nennen die Forscher einen funktionierenden Katastrophenschutz wie moderne Frühwarnsysteme.
Anders als beim Klimawandel blieb die deutsche Politik in dieser Frage bisher auffallend wortkarg.
↑ 2021-07-21
-
EIKE Europäisches Institut für Klima und Energie
Axel Robert Göhring
2021-07-21 de "Klimawandel" als Ausrede für tödliches Versagen von Regierung und Behörden? Volle Wasserbecken in Erwartung der Dürre?Wir stellen drei Fragen:
Sind die mittlerweile über 150 Toten der Rheinlandflut auf krasses Politiker-und Amtsversagen zurückzuführen?
Warum versagten sie?
Wurden Staubecken wochenlang nicht geleert, weil Klima-Alarmisten die Sommerdürre seit Jahren als Standard-Argument verwenden?
↑ 2021-07-21
-
ScienceFiles
2021-07-21 de Monumentales Staatsversagen: Die Flutkatastrophe hätte verhindert werden könnenWar es nicht erstaunlich,
wie schnell die Klima-Krieger versucht haben, das Hochwasser, das entlang von Ahr und Erft gewütet hat, für ihren Klimawandel-Kampf zu instrumentalisieren
und noch bevor die derzeit mehr als 150 Opfer beerdigt sind, politisches Kapital daraus zu schlagen?
Wer bislang nur geahnt hat,
dass Klimawandel-Hysteriker eine Art von Mensch sind, die im moralischen Vakuum lebt, die keinerlei Beziehung zu anderen Menschen herzustellen in der Lage ist, der Empathie nicht einmal als Wort verständlich ist, der weiß es spätestens, seit Klima-Aktivisten gegen die Flutkatastrophe streiken, während Freiwillige vor Ort im Schlamm wühlen.
Die völlige Lebensunfähigkeit und völlige Unfähigkeit, soziale Beziehungen überhaupt aufzunehmen, geschweige denn zu leben, sie war nie so deutlich wie derzeit.
Und nun wirft ein Beitrag, der heute in der Sunday Times erschienen ist,
ein ganz neues Licht auf die Katastrophe, die u.a. die Eifel heimgesucht hat.
Die Katastrophe war vermeidbar.
Die Regierungen von Bund und Ländern und die Verantwortlichen vor Ort, sie haben Warnungen ignoriert,
die schon NEUN Tage vor der Katastrophe ausgesprochen wurden.
↑ 2021-07-20
-
EIKE Europäisches Institut für Klima und Energie
The Sunday Times / Christian Freuer
2021-07-20 de Der wirkliche Grund für die Flutkatastrophe in Deutschland: Ein "monumentales Scheitern des Warnsystems"Wetterwissenschaftler sagen, dass ein "monumentales Versagen des Systems" direkt für den Tod und die Verwüstung verantwortlich ist, ausgelöst durch den Regen eines ganzen Monats, der in dieser Woche an zwei Tagen fiel.
-
GWPF The Global Warming Policy Forum / The Sunday Times
2021-07-18 en The real reason for Germany's flood disaster: A 'monumental failure of the warning system'Weather scientists say a 'monumental failure of the system' is directly to blame for the death and devastation triggered by a month's worth of rain that fell in two days this week
↑ 2021-07-19
-
Talsperren Net
de Füllstände von Talsperren in DeutschlandDiese Webseite soll eine Übersicht der Talsperren in Deutschland geben.
Diese wird in Abständen erweitert und aktualisiert.
Es werden alle Talsperren und Hochwasserrückhaltebecken mit mehr als 1,00 Million m3 Stauraum aufgelistet.
↑ 2021-07-19
-
Tagesschau
2021-07-19 de Der Druck wächst beim Thema KlimaschutzCSU-Chef Söder fordert einen "Klima-Ruck",
Grünen-Kanzlerkandidatin Baerbock einen schnelleren Kohleausstieg
und Umweltministerin Schulze mehr erneuerbare Energien.
Angesichts des Hochwassers ist klar: Klimaschutz muss Priorität haben.
Angesichts der Hochwasserkatastrophe in mehreren Bundesländern steht der Klimaschutz ganz oben auf der Tagesordnung.
Die Politik dringt mehrheitlich auf verstärkte Maßnahmen.
Bayerns Ministerpräsident Markus Söder forderte im ARD-morgenmagazin einen "Klima-Ruck" für Deutschland.
Das Unwetter mit verheerenden Folgen vor allem in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen, aber auch im Südosten Bayerns nannte er einen Weckruf.
↑ 2021-07-18
-
Hadmut Danisch / Ansichten eines Informatikers
2021-07-18 de Hat die Warnung vor der Flut nicht funktioniert?Ich halte es für überaus wichtig, nun herauszufinden, warum es hier keine ordentliche Warnung und auch vorher keine Vorbereitung gegeben hat.
Oder man da überhaupt gebaut hat.
Und ob beispielsweise Brücken die Überschwemmungen verursacht haben, wie damals in Dresden.
Und dabei sollte man sich auf keinen Fall vom Klimageschwätz ablenken lassen.
Ich will das wissen, ob das vorher bekannt war, dass das Wasser kommt, und in unfähigen Behörden versackt ist.
Und wenn das so ist, dann würde ich gerne wissen, warum.
Ob man sich mehr um Gender und Quoten als um seine Aufgaben gekümmert hat.
Das wäre mal etwas für Landes- oder Bundestagsanfragen, aber ich weiß noch nicht, in welche Zuständigkeiten das fällt.
Man sollte aber unbedingt nachbohren, auf wessen Konto weit über 100 Tote, Milliardenschäden und ruinierte Existenzen gehen.
Außerdem liegen mir mehrere Hinweise vor, wonach sich keine Sau um die Talsperren und Stauseen gekümmert hat und die alle schon seit Wochen randvoll waren, also nichts mehr aufnehmen konnten.
Vielleicht wollte man auch einfach für die große Greta-Dürre vorsorgen.
Warum können Talsperren und Stausehen überhaupt zu 100 % voll werden und damit keine Notfallreserve mehr haben?
Und warum muss die Feuerwehr aus der bruchgefährdeten Talsperre bei Euskirchen Wasser abpumpen, um Druck von der Mauer zu nehmen?
Stellt Euch mal vor, man hätte 8, 24, 48 Stunden vorher eine konkrete und ernste Warnung bekommen.
Was dann an Menschenleben, Gegenständen, Hab und Gut, Fahrzeugen
hätte gerettet werden können.
In wievielen Häusern es schon gereicht hätte, die wertvollsten Dinge in das erste Obergeschoss zu bringen und die Fahrzeuge auf den Berg zu fahren.
Oder einfach von vornherein die Häuser so zu bauen, dass der Rohbau bis 1. OG sowas aushält?
Hat man die Warnungen ignoriert,
um den Grünen und Fridays for Future im Wahlkampf keinen Ansatzpunkt zu liefern
und kein Affentheater von Greta, Luisa & Co. zu provozieren?
↑ 2021-07-17
-
Domradio
2021-07-17 de Jesuit Alt ruft zur Bekämpfung des Klimawandels auf: "Das Schlimmste noch verhindern"Angesichts der aktuellen Unwetterkatastrophe blickt Jesuitenpater Jörg Alt erschüttert auf den Zusammenhang zum Klimawandel.
Warum er trotz allem glaubt, dass es für einen Systemwechsel noch nicht zu spät ist, erklärt er im Interview.
Die Kipppunkte kommen schneller als vorhergesagt,
aber dennoch müssen wir das Vertrauen haben, dass das, was wir tun, in Gemeinschaft mit anderen und Gottes Hilfe
das Schlimmste noch verhindern kann.
Aber das reicht alleine noch nicht.
Selbst wenn jemand heute vegan wird, kein Flugzeug und kein Auto mehr benutzt.
Es sind nur 25 Prozent, was jeder als Einzelner an seinem ökologischen Fußabdruck reduzieren kann, weil ja letzten Endes Straßen, Infrastruktur, Krankenhäuser und andere Dinge trotzdemwegen uns vorgehalten werden.
Aber was jeder wirklich tun kann, ist, mit seinem Nachbarn zu reden.
Wenn dieser ein Klimaskeptiker ist, kann man ihn davon überzeugen, dass der Klimawandel real ist und dass es gravierende Folgen haben wird, wenn wir nichts tun.
↑ 2021-07-16
-
NZZ
2021-07-16 de Deutschland sollte auch über Dämme und Frühwarnsysteme und nicht nur über Windräder und Elektroautos redenDie politische Aufarbeitung der Unwetterkatastrophe in Deutschland konzentriert sich auf den Streit über die Energiewende.
Fragen zum besseren Schutz der Bevölkerung vor Unwetterkatastrophen wären mindestens so wichtig.
Die gewaltigen Schäden durch die Unwetter in Deutschland und Belgien werfen Fragen auf, wie die Bevölkerung besser davor geschützt werden kann.
Die schweren Unwetter in Westdeutschland und ihre erschreckende Zahl von Todesopfern sind eine unglaubliche Tragödie.
Blickt man auf die politischen Debatten der letzten zwei Tage, entsteht allerdings der Eindruck, als wäre das Ereignis für viele Personen eher ein Glücksfall.
Sie sehen sich in ihrer Weltanschauung bestätigt
und ziehen in politischen Statements, in Medienkommentaren oder auf den sozialen Netzwerken blitzschnell die
mal hämisch, mal warnend gemeinte Schlussfolgerung:
Das sind die Folgen des Klimawandels.
Diese Gewissheit löst dann häufig, zumal im Kontext des Bundestagswahlkampfs, zweierlei Reaktionen aus.
Erstens: Schuld an der Tragödie sind jene Politiker und Lobbyisten, die eine forschere Gangart bei der deutschen Energiewende verzögern.
Zweitens: Jetzt müssen wir erst recht loslegen mit dem Bau von Windrädern, Solarpanels und Elektroautos.
Das Klimaproblem geht nicht mehr weg
Dass der Klimawandel einen Einfluss auf die Häufigkeit und die Heftigkeit schwerer Unwetter in der Art des jüngsten Starkregens in Westeuropa hat, ist zwar weniger einfach zu belegen, als viele meinen.
Aber es ist nach allem bekannten Wissen wahrscheinlich.
Zahlreich sind auch die wissenschaftlichen Studien mit der Erkenntnis, dass es weltweit kostengünstiger ist, in Vorkehrungen zur Reduktion der Klimaerwärmung zu investieren, als nichts zu tun und bloss in die Beseitigung der langfristigen Folgeerscheinungen Geld zu stecken.
Das ist eines der zentralen Argumente dafür, dass hohe Investitionen in den Klimaschutz wichtig sind und dass die Klimapolitik zu Recht ein zentrales Thema unser Zeit ist.
Wenn aber der Schutz der Bevölkerung vor solchen Unwetterkatastrophen primär im beschleunigten Ausbau erneuerbarer Energieträger oder von Ladestationen an Autobahnen gesehen wird, dann werden zwei grundlegende Wesensmerkmale des Klimawandels übersehen.
Erstens ist die Klimaerwärmung ein globales Phänomen.
Deutschland trägt bloss knapp 2 Prozent zum weltweiten Ausstoss an Treibhausgasen bei.
Wenn Deutschland diese Emissionen nun mit verstärkten Anstrengungen ein paar Jahre früher als geplant auf null senken würde, würde der Klimawandel dadurch bestenfalls marginal abgeschwächt.
Es steht nicht in der Macht deutscher Politiker oder Konsumenten, wesentlichen Einfluss auf das Klima zu nehmen.

 Each Country's Share of CO₂ Emissions
Each Country's Share of CO₂ Emissions
Published Jul 16, 2008 Updated Aug 12, 2020

Zweitens ist der Klimawandel ein sehr langfristiges Phänomen.
Selbst wenn jetzt die ganze Welt auf einen Schlag aufhörte, fossile Energieträger zu verbrennen, ginge der Klimawandel zunächst weiter.
Die Erwärmung wäre langsamer und weniger weitgehend, als derzeit erwartet wird, aber sie würde nicht rückgängig gemacht.
Der Klimawandel ist ein Faktum und wird bleiben.
Wenn er katastrophale Wetterphänomene wie Starkregen oder Dürreperioden begünstigt, dann reicht eine Reduktion der CO₂-Emissionen nicht.
Die Gesellschaft muss sich auch besser vor den Folgen der Klimaerwärmung schützen.
Besserer Schutz vor Unwettern
Die Fragen nach der Verantwortung, die deutschen Politikern jetzt gestellt werden sollten, sind deshalb nicht nur die nach der Stilllegung von Kohlekraftwerken oder dem Bau zusätzlicher Windparks.
Es sind auch Fragen nach geeigneten Warnsystemen vor Sturzfluten für die Bevölkerung gefährdeter Gebiete.
Es sind Fragen nach nötigen baulichen Massnahmen zum Ableiten grosser Regenmengen und zum Schutz von Siedlungsgebieten vor Überschwemmungen.
Und es sind Fragen der Raumplanung, welche die Siedlungsentwicklung in hochwassergefährdeten Regionen sinnvoll steuern sollte.
Solche Fragen nach dem Management der negativen Folgen des Klimawandels werden im klimapolitischen Diskurs zumeist tabuisiert.
Klimaschützer befürchten, dass sie als Ausrede für Nichtstun missbraucht werden.
Doch wer diese Fragen vermeidet, verschliesst die Augen vor der Realität und bringt damit die Bevölkerung in Gefahr.
Der Klimawandel ist da.
Er führt zu häufigeren Gefahrenlagen.
Politik und Gesellschaft müssen sich darauf einstellen und geeignete Vorsorgemassnahmen treffen.
Das ändert nichts daran, dass die ganze Welt ihre Treibhausgasemissionen reduzieren muss, um in Zukunft nicht noch mehr Gefahrenlagen entstehen zu lassen.
Das ist kein Gegensatz, sondern eine sich ergänzende Strategie der Risikovorsorge.
↑ Flut: Artikel Schweiz
Mit folgendem Link wird von anderen Webseiten auf diese Seite verwiesen.
▶↑ 2021-08-06
-
Schweizerische Eidgenossenschaft
Eidgenössisches Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport
2021-08-06 de Hochwasser im Juli: Bewährungsprobe für den Schweizer HochwasserschutzHochwasser im Juli 2021
Die anhaltenden und starken Niederschläge im Juli haben in weiten Teilen der Schweiz zu Hochwasser geführt.
Das Bundesamt für Umwelt (BAFU) verzeichnete an seinen hydrologischen Messstationen neue Rekordwerte für den Neuenburger- und Bielersee.
Die von Bund, Kantonen und Gemeinden ergriffenen Massnahmen zum Hochwasserschutz haben sich bewährt:
Es gab keine Opfer zu beklagen und trotz Überschwemmungen halten sich die Hochwasserschäden nach ersten Einschätzungen in Grenzen.
Heftige Gewitter und Hagelzüge begleiteten im Juli intensive Regenfälle.
Der Monat zählte an zahlreichen Messstationen von MeteoSchweiz zu den fünf niederschlagsreichsten seit Messbeginn.
Während des Hauptereignisses vom 12. bis 15. Juli 2021 wurden fast in der ganzen Schweiz Niederschlagssummen von mehr als 100 mm verzeichnet, am Alpennordhang und im Tessin verbreitet über 150 mm.
Das ist die Niederschlagsmenge, die für gewöhnlich innerhalb des ganzen Monats Juli fällt.
Die Niederschläge fielen nach dem feuchten Juni auf ein bereits gefülltes hydrologisches System und liessen die Gewässer rasch weiter anschwellen.
Dies führte verbreitet zu Hochwasser und Überschwemmungen (siehe Link zum Webdossier).
Bewährungsprobe für Hochwasserschutz-Massnahmen
Dank vorsorglicher Massnahmen zum Hochwasserschutz von Bund, Kantonen und Gemeinden konnten grössere Überschwemmungen vermieden werden.
Die lokalen Einsatzkräfte bereiteten sich aufgrund der Prognosen und Warnungen frühzeitig vor, und die Bevölkerung wurde über verschiedene Kanäle laufend informiert.
Hochwasserschutzbarrieren wie Beaverschläuche wurden errichtet und Schwemmholz laufend entfernt, um den Abfluss zu gewährleisten.
Die Entlastungsstollen in Thun (BE) und Lyss (BE) wurden aktiviert.
Ein besonders starkes Gewitter mit Hagelschlag und Sturmböen traf in der Nacht auf den 13. Juli 2021 die Region Zürich.
Um einem zu starken Anstieg der Limmat vorzubeugen, wurde der Sihlsee (SZ) vorsorglich abgesenkt.
In Basel wurde die Schifffahrt für sechs Tage eingestellt.
Um die Jurarandseen möglichst rasch absenken zu können, beschlossen das BAFU und die betroffenen Kantone Bern, Waadt, Freiburg, Neuenburg, Solothurn und Aargau am 16. Juli gemeinsam, den Abfluss der Aare aus dem Bielersee temporär zu erhöhen.
Weniger Überschwemmungen trotz ähnlicher Regenmengen
Beim Hochwasser im Juli 2021 fielen insgesamt vergleichbare Regenmengen auf eine ähnlich grosse Fläche, wie im grossen August-Hochwasser von 2005 (6 Todesopfer, Schäden von rund 3 Milliarden Franken).
Damals fielen verbreitet über 200 mm Niederschlag in 72 Stunden am Alpennordhang.
Der Niederschlag im Juli war jedoch über einen längeren Zeitraum verteilt.
Deshalb führte er zwar insgesamt zu einem höheren Abflussvolumen, jedoch zu tieferen Maximalpegeln in den einzelnen Flüssen, als beim Hochwasser von 2005.
Nur an wenigen Messstationen wurden die Höchstwerte von 2005 übertroffen, so z.B. an der Reuss in Luzern.
Murgänge, Rutschungen und Oberflächenabfluss
An verschiedenen Orten kam es wegen der gesättigten Böden und anhaltender Niederschläge, kombiniert mit intensiven Gewittern und Hagel, zu Murgängen, Rutschungen und verbreitet Oberflächenabfluss.
Strassen und Schienenverbindungen waren teils während mehrerer Tage unterbrochen.
So zum Beispiel in den Kantonen Schwyz und Uri oder am Genfersee in der Waadt.
Auch im Kanton Tessin lösten die Niederschläge verschiedene Rutschungen aus.
So war die Nord-Südachse A2 wegen Erdrutschen mehrere Stunden unterbrochen, aber auch Strassen in den Seitentälern.
Häufig gab es Schäden durch Oberflächenabfluss:
Das Wasser drang von aussen in Gebäude ein und flutete Garagen, Keller oder Unterführungen.
Schutz vor Naturgefahren als Daueraufgabe
Die Ereignisse im Juli 2021 haben gezeigt, wie wichtig Massnahmen zum Hochwasserschutz sind.
Gerade vor dem Hintergrund des Klimawandels, aber auch in Bezug auf die Nutzung der Siedlungsfläche muss der Schutz vor Hochwasser und anderen Naturgefahren kontinuierlich an neue Rahmenbedingungen angepasst werden - und ist deshalb eine Daueraufgabe.
Die Erkenntnisse aus dem Juli-Hochwasser fliessen in die laufende Optimierung der organisatorischen, planerischen und baulichen Hochwasserschutz-Massnahmen ein.
↑ 2021-07-26
-
Schweizerische Eidgenossenschaft
Bundesamt für Umwelt BAFU
2021-07-26 de Hochwasser Juli 2021: Intensive Niederschläge führten verbreitet zu ÜberschwemmungenUnwetter, Hochwasser an Flüssen und Überschwemmungen an Seen
Der Juli war in seiner ersten Hälfte nass und das Wetter instabil wie bereits im Juni.
Viele Gewässer erreichten die Gefahrenstufe 3,
mancherorts stiegen die Pegel in die Gefahrenstufe 4 oder gar 5.
Besonders stark betroffen waren der Thunersee, der Neuenburger- und Bielersee sowie der Vierwaldstättersee.
↑ 2021-07-16
-
Tages-Anzeiger
2021-07-16 de Schweiz: Das Unwetter sorgt für das schlimmste Schadensjahr seit 2005"Die Versicherer ziehen derweil eine erste Bilanz:.
Sie fällt düster aus; Wasser und Schlamm haben ganze Gemeinden verwüstet.
So zeichnet sich schon jetzt ab, dass dieses Jahr für die 18 kantonalen Gebäudeversicherungen ein besonders kostspieliges Jahr wird.
Dem Verband wurden bislang Schäden von rund 450 Millionen Franken gemeldet.
Teurer war es in den letzten zwanzig Jahren nur im Katastrophenjahr 2005.
20'000 beschädigte Fahrzeuge an einem Tag
Laut Hochrechnungen des Versicherers Mobiliar haben die Unwetter seit dem 20. Juni Schäden in der Höhe von 280 Millionen Franken verursacht.
Allein der Hagelzug vom 28. Juni habe zu 20'000 Fahrzeugschäden in der Höhe von 90 Millionen Franken geführt.
Zum Vergleich: Das August-Hochwasser von 2005 sorgte bei der Mobiliar für Schäden von insgesamt 450 Millionen Franken.
↑ Flut: Videos
Mit folgendem Link wird von anderen Webseiten auf diese Seite verwiesen.
▶↑ 2021-09-22
-
Wetternet
2021-09-22 de Klimaerwärmung gestoppt? Eisschmelze am Nordpol ist ausgebremst!
Klimaerwärmung gestoppt? Eisschmelze am Nordpol ist ausgebremst!
Überraschende Daten vom Meereis am Nordpol.
Ist die Eisschmelze ausgebremst?
Aktuelle Daten deuten darauf hin, dass wir kein neues Rekordminimum bei der Eisfläche bekommen werden.
Erholt sich das Meereis am Nordpol wieder?
↑ 2021-09-20
Es ist die erste große Flutbilanz der Regierung
- und offenbar sind Bund und Länder trotz Versagen und katastrophaler Pannen mit ihrer Arbeit sehr zufrieden!
Vor allem ein Satz in dem 20-seitigen Papier (liegt BILD vor) von Innen- und Finanzministerium macht sprachlos.
Auf Seite 10 heißt es:
"Das System des Bevölkerungsschutzes mit der klaren kommunalen Verantwortung und der aufwachsenden Unterstützung durch Landkreise, Länder und den Bund hat sich in dieser langanhaltenden Hochwasserlage grundsätzlich als trag- und leistungsfähig erwiesen, wird aber gleichwohl im Rahmen eines Evaluierungsprozesses betrachtet werden."
Dabei klagen die Flutopfer u. a. über nächtliche Plünderungen.
Und Kanzlerin Angela Merkel (67, CDU) hatte bei ihrem letzten Besuch im Flutgebiet Anfang September versprochen:
"Wir werden Sie nicht vergessen."
Entsprechend empört sind Politiker über den selbstzufriedenen Tonfall der Bilanz.
CSU-Innenexperte Michael Kuffer (49) zu BILD:
"Die Familien von 183 Todesopfern und 800 Verletzten müssen das als puren Hohn empfinden!"
Katharina (37, Büroangestellte) und Thomas Dederich (39) aus
Walporzheim:
Die Alarmierung am 14. Juli hat absolut nicht funktioniert.
Dieses Versagen war das schlimmste.
90 Prozent der Hilfe kam dann von Freiwilligen.
Es gibt hier Menschen, die zu Hause nicht essen oder duschen können.
Es ist immer noch eine Katastrophe und wir finden, so sollte man das auch behandeln."
↑ 2021-09-19
-
Die kalte Sonne (Fritz Vahrenholt & Sebastian Lüning)
2021-07-19 de Schuld an der Katastrophe war nicht der Klimawandel - sondern Starkregen!Die schlimme Flutkatastrophe in Westdeutschland rüttelt weiter auf.
Nachdem die Überschwemmungen zunächst von Aktivisten und Politikern reflexhaft als Produkt des Klimawandels interpretiert wurde, hat sich nun das Blatt gewendet.
Immer mehr Medien hinterfragen nun die Instrumentalisierung der Flut und fordern eine ganz andere Diskussion:
Weshalb haben die Bundesregierung und Regionalverwaltungen trotz Starkregenwarnung bis zu 4 Tage vor der Katastrophe nicht entschiedener reagiert?
Weshalb wurde nicht früher und großmaßstäblicher evakuiert.
Eine britische Expertin für Hochwasserwarnungen zeigt sich enttäuscht, dass die deutschen Behörden hier offenbar gepennt haben.
Die Politik war mehr am aktuellen Wahlkampf interessiert, und kümmerte sich zu spät um das praktische Management vor Ort.
Es ist einfach nicht genug, fragwürdige Thesen von Klimaalarmisten zu verkünden, anstatt rechtzeitig und umsichtig zu handeln.
Wenn vermeintliche Gefahren im Jahr 2100 wichtiger sind, als Katastrophenvorsorge echter Gefahren 2021, dann sagt das viel über die Entscheidungsträger.
Vielleicht rütteln die schlimmen Vorkommnisse die Planer nun endlich wach:
Kümmert Euch um die wahren Probleme, anstatt über eine schönschaurige Klima-Horror-Picture Show der weit entfernten Zukunft zu theoretisieren.
Hier einige wichtige Artikel zum Thema der letzten Tage.
↑ 2021-08-27
Die verheerende Flut hat viele Häuser zerstört.
Von einigen ist nichts übriggeblieben, andere werden abgerissen oder wiederaufgebaut.
Diese Woche sind wir in Altenahr unterwegs, unter anderem im Ortsteil Altenburg, in dem der Großteil der Häuser schwere Schäden hat.
Wie geht es den Menschen dort?
Viele wissen noch nicht, wieviel Geld sie aus dem Spendentopf bekommen und unter welchen Voraussetzungen.
Unklar ist auch, ob sie ihr Haus am ursprünglichen Ort wieder aufbauen dürfen.
Viele Ahr-Anwohner sind ratlos.
↑ 2021-08-19
Die Welt dreht sich weiter und die Flutkatastrophe ist zum größten Teil wieder aus den Medien verschwunden.
Zurück bleibt nur die ewige Leier vom menschengemachten Klimawandel.
Doch die Menschen, die um ihre Liebsten trauern, die von den Geschehnissen traumatisierten sind, die alles verloren haben, sind weiterhin da, wenn die Aufmerksamkeit der Medien lange abgeklungen ist.
In unserer heutigen Sendung "Flutkatastrophe und Klimawandel - Große Sprüche, keine Taten" sprechen wir darüber, wie die schrecklichen Bilder der Flut zwar liebend gerne für die Klimaagenda instrumentalisiert wurden, aber keine reellen Taten gefolgt sind - die Opfer wurden alleine gelassen, Helfer sogar noch vertrieben.
Ins Studio zugeschaltet wird Britta Mecking aus Blessem in NRW.
Sie ist Flutopfer und wird aktuell vor Ort gebraucht, deshalb kann sie nicht ins Studio kommen.
Frau Mecking schildert, dass niemand etwas getan hat, um sie zu warnen.
Wie sie und ihre Nachbarn Keller leer gepumpt haben - auf sich gestellt, denn die Zufahrtsstraße wurden abgeriegelt, auch Helfer konnten nicht durchkommen.
Im Studio sind
Norbert Bolz - Publizist, Medien- und Kommunikationstheoretiker -
und Sebastian Lüning - Geologe, Privatforscher, Autor des Buches "Die kalte Sonne".
Sie sprechen mit Roland Tichy über Fakten.
Darüber, dass es schon immer Flutkatastrophen gegeben hat, dafür braucht es keinen menschengemachten Klimawandel.
Und obwohl es den Politiker ein großes Anliegen ist, Probleme zu lösen, die weit in der Zukunft liegen, scheinen sie keinerlei Interesse daran zu haben, die Katastrophen zu beseitigen, die im Jetzt liegen.
Doch wie kann es sein, dass die Politiker damit durchkommen?
Und wann werden die Menschen endlich merken, dass unser Politiker nur reden, aber nicht handeln?
Auch darüber diskutiert Roland Tichy mit seinen Gästen heute Abend bei Tichys Ausblick.
↑ 2021-08-16
-
EIKE Europäisches Institut für Klima und Energie
2021-08-16 de Klimawissen - kurz & bündig: Wie die Politik Ahrweiler instrumentalisiert
Klimawissen - kurz & bündig: Wie die Politik Ahrweiler instrumentalisiert
Nachdem die heißen Sommer mit Dürre ausfielen, nutzten Medien und Politiker sogleich das Hochwasser als Beweis für den menschgemachten Klimawandel.
↑ 2021-08-13
-
Outdoor Chiemgau Der Krisenvorsorgekanal
2021-08-13 de Warnung vor Gefahren? Aber wie? DWD APP, NINA + Insiderinfos Ahrtal
Warnung vor Gefahren? Aber wie? DWD APP, NINA + Insiderinfos Ahrtal
Wie kann man sich von Fehlentscheidungen der Behörden unabhängig machen und immer gewarnt werden?
↑ 2021-08-08
-
Bastifbr
2021-08-08 de Vor und nach der Flut 2021:
Die Ahr-Rotweinstraße von Altenahr nach Dernau
Vor und nach der Flut 2021:
Die Ahr-Rotweinstraße von Altenahr nach Dernau
Das Video zeigt die Schäden entlang der Rotweinstraße im Ahrtal exakt zwei Wochen nach der Flut vom 14. auf den 15. Juli 2021.
Beginn der Fahrt ist hier vom völlig zerstörten Abschnitt "Am Tunnel" in Altenahr in Richtung Osten nach Dernau.
Besten Dank an "Rockdrummer71", der das Video im Juli 2015 aus seiner Perspektive gefilmt hat und an Timmy für die Ideenfindung.
↑ 2021-08-06
-
NZZ Neue Zürcher Zeitung
2021-08-06 de Die verheerende Flut in Ahrweiler -
eine Video-Rekonstruktion des Hochwassers
Die verheerende Flut in Ahrweiler -
eine Video-Rekonstruktion des Hochwassers
Die mit Abstand meisten Todesopfer forderte das Hochwasser in Deutschland im Landkreis Ahrweiler.
Warum war die Flut dort so verheerend?
Augenzeugenvideos der Hochwasserkatastrophe in Deutschland.
Es ist die Naturkatastrophe mit den meisten Todesopfern seit den 1960er Jahren.
Besonders verheerend war die Flut in Rheinland-Pfalz im Landkreis Ahrweiler.
Über 130 Menschen verloren hier ihr Leben.
Wie genau spielte sich diese Katastrophe ab?
Wir zeigen Wetterdaten, Satellitenbilder und Zeugenvideos, um besser zu verstehen, wie es zur tödlichen Flut kommen konnte.
Montag, 12. Juli 2021 - die Vorhersagen
Wir beginnen die Rekonstruktion zwei Tage vor der Überschwemmung im Ahrtal.
Wettervorhersage Deutscher Wetterdienst vom Montag, 12. Juli 2021:
«Das Wetter in Deutschland will sich einfach nicht beruhigen.»
In der Vorhersage prognostiziert der Deutsche Wetterdienst Überflutungen in Rheinland-Pfalz.
Sprecher: «Lokal sind nach aktuellem Stand
sogar Mengen bis 200 Liter pro Quadratmeter
nicht ausgeschlossen.
Das bedeutet natürlich auch in dieser Region: Überflutungen.»
Dienstag, 13. Juli - Warnung vor extremen Unwettern
Am nächsten Tag fällt vielerorts in Deutschland enorm viel Regen.
Es kommt zu ersten Hochwassern.
Der Deutsche Wetterdienst spricht jetzt für 17 Regionen eine Warnung vor extremen Unwettern aus - höchste Warnstufe.
Darunter auch für den Landkreis Ahrweiler.
Mittwoch, 14. Juli - Hochwasserwarnung und Evakuierung
Die Ahr fliesst hier mit vielen Kurven durch das Tal -
Häuser sind nahe am Fluss gebaut.
Hügel umgeben die Dörfer.
Am Mittwoch, dem 14. Juli, trifft der extreme Starkregen die Region.
Der sonst ruhige Fluss verwandelt sich in einen reissenden Strom - hier trägt der Fluss ein Wohnmobil mit.
Über ein Internetarchiv haben wir die Hochwasserfrühwarnung für Rheinland-Pfalz aufgerufen.
Sicher seit kurz vor 18 Uhr gilt auch hier höchste Warnstufe für die Ahr:
Das bedeutet: «Überflutung bebauter Gebiete in grösserem Umfang.»
Diese Grafik zeigt den Pegelstand der Ahr in der Gemeinde Altenahr.
Am Nachmittag steigt der Pegel plötzlich stark an.
Er übersteigt die Marke des bisherigen Höchststands.
Um 20 Uhr 45 erlischt das Signal - der Pegelstandsmesser wurde von den Fluten weggerissen.
Der letzte gemessene Pegelstand beträgt 5,7 Meter.
Der Krisenstab soll erst gegen 22 Uhr bemerkt haben, dass sich der Pegel nicht mehr verändert, berichtet die «Rhein-Zeitung».
Tatsächlich steigt der Pegel weiter an.
Um 23 Uhr 09 folgt der Aufruf zur Teilevakuierung:
«Aufgrund der starken Regenereignisse sollen die Bewohnerinnen und Bewohner der Städte Bad Neuenahr-Ahrweiler, Sinzig und Bad Bodendorf, die 50 Meter rechts und 50 Meter links von der Ahr wohnen, ihre Wohnungen verlassen.»
Für viele Menschen kommt dieser Aufruf zu spät.
Die 50 Meter sind zu knapp bemessen.
Donnerstag, 15. Juli, und die Tage danach - retten, bergen und die Aufarbeitung
Diese Aufnahme zeigt das überflutete Seniorenheim und die Grundschule in Altenahr.
Sie liegen über 250 Meter vom Fluss entfernt.
Um das Ausmass der Katastrophe zu erfassen, werden Satellitendaten zu Hilfe genommen.
Hier eine Notfallkarte, um Rettungskräfte zu unterstützen.
Die roten Punkte markieren zerstörte Gebäude, die orangen beschädigte Gebäude.
In Sinzig, kurz bevor die Ahr in den Rhein fliesst, wird ein Heim für Menschen mit Beeinträchtigung überflutet - allein hier sterben 12 Menschen.
Ein Grund, warum die Region nicht besser auf Hochwasser vorbereitet gewesen sein könnte:
Die Gefahr wurde möglicherweise unterschätzt.
Hier die Gefahrenkarte für extreme Hochwasser, die statistisch seltener als alle 100 Jahre auftreten sollten.
Die blauen Flächen würden dabei überflutet - hier wieder das Seniorenheim und die Grundschule, welche wir schon kennen.
Viele dieser Schäden hätte es also selbst bei einem extremen Hochwasser gar nicht geben dürfen.
Dagegen zeigt ein neuer Bericht:
Für die Berechnung der Überflutungsgefahr wurden historische Hochwasser im Ahrtal aus den Jahren 1804 und 1911 nicht berücksichtigt.
![]()
![]() Pegel Altenahr 1804 und 1911 nicht berücksichtigt
Pegel Altenahr 1804 und 1911 nicht berücksichtigt
grau: Maximaler Abflusss,
orange: Abfluss Mittelwert,
blau: Minimale Abfluss

So wurde die Gefahr möglicherweise unterschätzt.
Die Schäden durch die Flut sind riesig.
Rettungskräfte, die Bundeswehr und Freiwillige helfen bei der Evakuierung und den Aufräumarbeiten.
Der Wiederaufbau wird noch Jahre dauern.
Die Rekonstruktion zeigt:
Das Hochwasser wäre vorhersehbar gewesen
- doch es war wohl die Verkettung von verschiedenen Faktoren, welche die Flut im Landkreis Ahrweiler zur verheerenden Katastrophe machte.
↑ 2021-08-06
-
SWR Doku
2021-08-06 de Die Müllflut - Schuttentsorger im Ahrtal
Die Müllflut - Schuttentsorger im Ahrtal
Das Hochwasser im Ahrtal hat nicht nur Menschenleben gekostet, Existenzen vernichtet und Gebäude zerstört - es hat auch Müll und Schutt historischen Ausmaßes zurückgelassen.
Freiwillige Helfer, Feuerwehr und THW befreien genauso wie Bundeswehr und diverse Baufirmen Gebäude und Straßen von Schlamm, Trümmern und Treibgut, dazu kommen Tonnen an Sperrmüll aus den Häusern der Anwohner.
Doch wohin damit?
Die aktuelle Reportage beleuchtet neben der Müllbergung im Ahrtal, auch die Müllverarbeitung auf dem Umschlagplatz in Niederzissen, auf dem die Mitarbeiter teils 14 Stunden arbeiten.
Schlussendlich wird die Müll-Flut auf der Deponie Eiterköpfe in Ochtendung auf einem 8-Meter-hohen Müllberg endgelagert, den 400 LKW täglich mit Sperrmüll, Schrott und Unrat aus dem Katastrophengebiet füllen.
↑ 2021-08-04
-
ARD
2021-08-04 de Organisationschaos im Krisengebiet? | Report Mainz
Organisationschaos im Krisengebiet? | Report Mainz
Seit zweieinhalb Wochen kämpfen die Menschen im Ahrtal gegen Schlamm und Chaos.
Unsere Reportage aus dem Flutgebiet zeigt, bei der Organisation der Hilfe läuft einiges schief.
↑ 2021-08-03
-
ARD
2021-08-03 de REPORT MAINZ vom 3. August 2021
REPORT MAINZ vom 3. August 2021
↑ 2021-08-03
-
Spiegel TV
2021-08-03 de Wer zahlt? Und wer ist schuld? - Die Aufarbeitung der Flut
Wer zahlt? Und wer ist schuld? - Die Aufarbeitung der Flut
Knapp drei Wochen nach der Flut wird die Katastrophe aufgearbeitet.
Wer ist schuld?
Und warum wurden viele Menschen nicht rechtzeitig gewarnt?
Auch die Folgekosten des Hochwassers müssen beziffert werden.
Die Schadenregulierer der Versicherungen sind vor Ort.
SPIEGEL TV mit einer Reportage aus dem Ahrtal.
↑ 2021-07-28
-
Dominik Jung
2021-07-28 de Kältewelle im August!
Temperatursturz mitten in den Hundstagen.
Keine Sommerhitze in Sicht!
Kältewelle im August!
Temperatursturz mitten in den Hundstagen.
Keine Sommerhitze in Sicht!
Was ist denn nun los? Der August startet richtig frisch.
Nachts sinken die Temperaturen unter 10 Grad, in den Alpen deutet sich in den Tälern sogar Bodenfrost an.
Ist der Hochsommer vorbei, bevor er überhaupt angefangen hat?
↑ 2021-07-27
-
Spiegel TV
2021-07-27 de Zwischen Hoffnung, Wut und Trauer: Das Leben nach der Flut
Zwischen Hoffnung, Wut und Trauer: Das Leben nach der Flut
Ein Mann verliert sein Hotel und die Versicherung will nicht zahlen.
Ein Pärchen hat nur noch einen Rucksack und weiß nicht, wie es weitergehen soll.
Und mittendrin: tausende freiwillige Helfer, die Schlamm schippen und Häuser entrümpeln.
Eine Reportage aus den Krisengebieten der Ahr.
↑ 2021-07-27
-
WDR Doku
2021-07-27 de Nach der Flut: Sie haben alles verloren
Nach der Flut: Sie haben alles verloren
Über mehrere Tage hat der WDR für diese aktuelle Doku Menschen in drei Orten im Westen bei der Bewältigung der Hochwasserkatastrophe begleitet: in Erftstadt, im Winzerdorf Dernau und in Bad Münstereifel.
In Erftstadt-Blessem tut sich ein riesiger Krater auf, der mehrere Häuser und Straßen verschluckt hat.
Auch das Haus, in dem Sylvia und Christian Schauff bis vor kurzem gewohnt haben, ist darin verschwunden.
Aus ihrer Wohnung konnten sie sich nur noch durchs Hochwasser watend retten - mit ihren beiden Haustieren, einem Hund und einer Katze.
Blessem, das war bis vor kurzem "ihr kleines Paradies", in dem die Nachbarschaft stimmte, Gemüse und Obst angebaut wurde.
Jetzt stehen sie vor dem Nichts.
Und gleichzeitig erfahren sie Hilfe von vielen Seiten.
Viele, vor allem junge Helfer sind gekommen, um mit anzupacken, wo es geht.
Viele Keller in Blessem sind wieder leergepumpt, Häuser entrümpelt, langsam wird die Lage etwas übersichtlicher.
Und bei einigen hat sich die Betroffenheit in Wut verwandelt.
Wie konnte es sein, dass eine Kiesgrube ein derartiges Loch in ihren Ort reißt?
Darüber soll jetzt in einer Bürgerversammlung geredet werden.
Die Gemeinde Dernau am Rotweinwanderweg im Herzen des Ahrtals ist weltberühmt für ihre Weine.
Jetzt sieht es hier teilweise aus wie in einem Kriegsgebiet: Trümmerhaufen, zugeschüttete Gassen, fehlende Häuserfronten, überall Schlamm. Über 120 Tote meldet der Kreis Ahrweiler eine Woche nach der Flut, mehr als 150 Menschen werden noch vermisst.
Dernau hat keinen Strom, kein Trinkwasser, es wird Monate dauern, allein das Nötigste wiederherzustellen.
"Unser Haus ist komplett zerstört", sagt Wolfgang W., der wie viele andere jetzt damit beschäftigt ist, den Schlamm in Eimerketten aus den Häusern zu schippen.
Jeder, der hilft, ist von oben bis unten voll mit Schlamm.
Doch jeden Tag kommen unzählige Helfer:innen nach Dernau, manche aus 400 Kilometer Entfernung.
Im nahegelegenen Ort Gelsdorf liegt das Bauunternehmen von Tobias und David Lanzerath.
In den letzten Tagen haben die beiden Brüder ihre Firma gemeinsam mit Freund:innen und Kolleg:innen in ein Spenden- und Logistikzentrum verwandelt.
Sie alle packen ehrenamtlich mit an.
Sie halten zusammen, um in Dernau zu retten, was zu retten ist.
Als die Wassermengen den Hof von Christin Vongerichten und ihrem Mann in Bad Münstereifel fluten, stehen ihre 40 Pferde plötzlich im Wasser.
Unter Einsatz ihres Lebens holen sie die Pferde aus den Boxen und bringen sie den Berg hinauf, wo sie vor dem Wasser sicher sind.
Die Pferde konnten sie retten, aber die Ranch ist ein Totalschaden, die Halle einsturzgefährdet, die Ställe sind kaputt.
Im mittelalterlichen Bad Münstereifel selbst kämpfen Spezialist:innen zusammen mit den Menschen vor Ort auch um das Gedächtnis ihrer Stadt.
Schränke voller Urkunden, einige über ein halbes Jahrtausend alt, müssen aus dem überfluteten Stadtarchiv geborgen und schnellstmöglich gereinigt und schockgefroren werden.
Einen Steinwurf entfernt wurde der Haushaltswarenladen von Hubert Roth völlig zerstört, er hat rund eine halbe Million Euro Schaden, keinen Versicherungsschutz.
Dafür jede Menge Wut:
"Die versprochene Hilfe ist jetzt schon zu klein dimensioniert, und nach meinen Erfahrungen bleibt es eh bei Versprechungen - Wahlkampfgetöse, sonst nichts!".
Bücherladenbesitzer Josef Mütter ist bewegt von der Hilfe vor Ort:
"Diese Hilfsbereitschaft, diese gelebte Nächstenliebe, die man jetzt überall im Ort sieht, muss das Fundament des Neuanfangs werden."
Angela Merkel und Armin Laschet sprechen an diesem Tag direkt vor seinem Laden.
Von ihnen werden wohl nicht die entscheidenden Impulse kommen, sagt Josef Mütter.
"Mit uns Menschen fängt alles an."
↑ 2021-07-27
Die Rheinzeitung aus Koblenz fasst heute das unfassbare Behördenversagen zusammen:
Zwischenzeitlich wurde auf dem Weg zur ganz großen Katastrophe sogar noch Entwarnung gegeben!
Katastrophe mit Ansage!
Ein aktueller Podcast mit unserem Wetterexperten Dominik Jung:
Das aktuelle Wetter für Deutschland vom 19. Juli 2021.
Man hat selten so ein Totalversagen der deutschen Behörden erlebt wie bei dieser Flut-Katastrophe.
Die Archivkarten zeigen eindeutig, dass seit Tagen klar war, was da auf Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz zukommt.
Selbst die Aussage das Wasser sei erst in der Nacht und bei Dunkelheit gekommen kann widerlegt werden.
Das macht einfach nur fassungslos.
Diplom-Meteorologe Dominik Jung fasst die Prognosen im Vorfeld zusammen.
Seit Sonntag war schon klar, dass extreme Regenmengen vom Himmel kommen.
↑ 2021-07-24
Am Samstagnachmittag hat in den Krisengebieten in Rheinland-Pfalz erneut Regen eingesetzt.
Die Lage sei aber nicht so verschärft wie vergangene Woche, hieß es.
Freiwillige Helfer müssen die Region verlassen.
Im Laufe des Tages sei laut Deutschem Wetterdienst (DWD) mit örtlichen Niederschlägen im Bereich von maximal 30 bis 40 Litern pro Quadratmeter zu rechnen, teilte die Leiterin des Katastrophenschutzstabs, Begona Hermann, mit.
Stellenweise würden auch nur 10 Liter erwartet.
Ab Sonntagmorgen gegen 6 Uhr könne sich die Wetterlage aber noch verschärfen.
Den besonders betroffenen Kommunen sei daher ein Evakuierungsangebot gemacht worden, sagte Hermann.
In den gefährdeten Orten Schuld, Insul, Dümpelfeld und Bad Neuenahr-Ahrweiler sollen die Menschen demnach mit Shuttlebussen zu einer Notunterkunft in Leimersdorf gebracht werden können.
"Das entscheiden dann die Menschen selbst", so Hermann.
In diesem SWR Extra seht ihr den aktuellen Stand zum Hochwasser in Rheinland-Pfalz.
↑ 2021-07-22
-
Dominik Jung
2021-07-22 de Klimawandel: Ausrede für politisches Totalversagen in
der Flutkatastrophe! Neue heftige Gewitter!
Klimawandel: Ausrede für politisches Totalversagen in
der Flutkatastrophe! Neue heftige Gewitter!
Das aktuelle Wetter für Deutschland vom 21. Juli 2021.
Der Klimawandel muss nach der Flut-Katastrophe als Ausrede für ein unfassbares politisches und behördliches Versagen herhalten.
Einfach kaum zu fassen.
Beim Wetter ist zunächst noch Ruhe angesagt, doch ab dem Wochenende geht es schon wieder los.
Neue Unwetter ziehen auf.
Es wird aber nicht flächendeckend Starkregen geben wie am vergangenen Mittwoch.
↑ 2021-07-20
-
Dominik Jung
2021-07-20 de Das Totalversagen der Behörden! Wetterkarten beweisen:
Extrem‑Unwetter war seit Tagen bekannt!
Das Totalversagen der Behörden! Wetterkarten beweisen:
Extrem‑Unwetter war seit Tagen bekannt!
Katastrophe mit Ansage! Ein aktueller Podcast mit unserem Wetterexperten Dominik Jung.
-
Dominik Jung
2021-07-20 de Katastrophenschutz: Wie hätten die vielen Toten verhindert werden können? | DW News
Katastrophenschutz: Wie hätten die vielen Toten verhindert werden können? | DW News
Hätten die vielen Toten verhindert werden können?
War die Flutkatastrophe in Deutschland vorherzusehen?
Jetzt werden die Fragen drängender und die Antworten von politisch verantwortlichen kleinlauter.
Das Innenministerium im Bundesland Nordrhein-Westfalen hat eingeräumt, dass die Überflutungen nicht überraschend kamen.
Denn vier Tage vor den Fluten hat das Europäische Hochwasser-Warnsystem die Regierungen in Deutschland und Belgien gewarnt.
24 Stunden vorher sogar sehr präzise.
Eine britische Professorin, die das Warnsystem mitentwickelt hat spricht von monumentalem Systemversagen.
↑ 2021-07-19
-
Akademie Raddy
2021-07-19 de Flutkatastrophe 2021: Die wahren Gründe für die Flut
Flutkatastrophe 2021: Die wahren Gründe für die Flut
Nachtrag:
Aufgrund der Kritik hat der Wupperverband jetzt gesagt, warum er die Talsperren voll befüllt hat und der Hochwasserschutz daher nicht funktionieren konnte:
"Wir hatten Angst vor Dürren durch Klimawandel, und daher haben wir alle Talsperren gefüllt."
Musste Wuppertal in den Fluten versinken, weil man sich im Klimawahn befindet?
Oder ist dies eine Ausrede, damit Tourismus und Ökostrom funktionieren?
Die Schweiz hat übrigens eine Richtlinie für Talsperren: Talsperren dürfen höchstens zu 80% befüllt sein.
Lokalnachrichten aus Remscheid
Ein Lokalsender aus dem Überschwemmungsgebiet Remscheid führte kurz vor dem Hochwasser ein Interview mit einem GRÜNEN Politiker (Sportdezernent Thomas Neuhaus) und einem Mitarbeiter von "Arbeit Remscheid" am Rande der Wupper-Talsperre.
Dort freut man sich, dass der Wasserstand der Wuppertalsperre extrem hoch ist, was toll für das Tourismusprojekt ist.
Dummerweise scheinen die beiden Jungs nicht zu begreifen, dass eine volle Talsperre keinen Schutz gegen Hochwasser mehr bietet.
↑ 2021-07-18
-
Crazy Krauthead
2021-07-18 de Bürgermeister von Schuld gibt Merkel Kontra
Bürgermeister von Schuld gibt Merkel Kontra
Frau Merkel reiste wegen den Hochwasserschäden nach Schuld in der Eifel und gab da natürlich eine Pressekonferenz….
↑ 2021-07-18
Die aktuelle Lage im Südwesten ist weiterhin angespannt.
Im Großraum Ahrweiler in Rheinland-Pfalz ist die Zahl der Todesopfer laut Angaben der Polizei auf mindestens 110 gestiegen.
Zudem gebe es mehr als 670 Verletzte.
Während die Pegelstände mancherorts zurückgehen und die Aufräum-Arbeiten voranschreiten, wird das ganze Ausmaß der Hochwasserkatastrophe vor allem im Nordes des Landes deutlich.
↑ 2021-07-17
-
NWR Paddlier
2021-07-17 de Wuppertalsperre läuft über:
Maximale Stauhöhe um Mitternacht überschritten:
14. Juli 2021 23:00
Wuppertalsperre läuft über:
Maximale Stauhöhe um Mitternacht überschritten:
14. Juli 2021 23:00
Durch anhaltenden Starkregen erreichte der Stauinhalt der Wuppertalsperre am 14. Juli 2021 um 23:00 das Vollstauziel.
Weshalb der Hochwasserschutzraum binnen kurzer Zeit aufgebraucht war und das Wasser ungehindert über den Überlauf ins Tal stürzte, wo die ersten Wupperorte rasch vom Wasser erreicht wurden.
Zwischen 23:00 und 6:00 strömten jedoch noch über eine Million Kubikmeter Wasser in das Staubecken.
↑ 2021-07-16
-
SWR
2021-07-16 de Hochwasser: Die aktuelle Lage im Südwesten
| SWR Extra am 16.07.2021
Hochwasser: Die aktuelle Lage im Südwesten
| SWR Extra am 16.07.2021
Die Hochwasser-Situation in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen ist immer noch katastrophal.
Starke Regenfälle hatten besonders im Norden von Rheinland-Pfalz für Hochwasser und Überflutungen gesorgt.
Baden-Württemberg hilft mit Rettungskräften und Material.
In den Katastrophengebieten von Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen ist die Lage nach wie vor schwierig.
Immer noch herrscht Hochwasser und es werden viele Menschen vermisst, Gebäude müssen evakuiert und Straßen von Schutt und Schlamm geräumt werden.
Das Land Baden-Württemberg hat die Unterstützung für das Nachbarland Rheinland-Pfalz inzwischen deutlich ausgeweitet, teilte der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl (CDU) am Freitag mit.
Weitere 600 Einsatzkräfte von Sanitätsdienst, Feuerwehr und Technischem Hilfswerk seien am Donnerstagabend und in der Nacht in die Hochwassergebiete in Rheinland-Pfalz entsandt worden.
Höhenretter, Hochwasserspezialisten und Hubschrauber seien dabei.
↑ 2021-07-15
-
Tagesschau
2021-07-15 de "Es ist wirklich verheerend"
"Es ist wirklich verheerend"
Nach dem schweren Unwetter gehen die Einsatzkräfte von mindestens 38 Toten in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen aus.
Zahlreiche Menschen werden noch vermisst, viele warten auf Rettung.
Ministerpräsidentin Dreyer zeigte sich schockiert.
Ganze Orte sind überflutet, Häuser einfach weggeschwommen.
Polizeihubschrauber sind unterwegs, um Menschen von Hausdächern zu retten.
Wie viele Menschen im Zusammenhang mit der Katastrophe starben, ist noch unklar - auch, weil noch immer Dutzende Menschen vermisst werden.
Allein im besonders schwer betroffenen Kreis Ahrweiler geht die Polizei von 18 Toten aus.
Aus dem Kreis Euskirchen im ebenfalls betroffenen Bundesland Nordrhein-Westfalen werden 15 Tote gemeldet.
Weitere Tote gibt es in Rheinbach, Köln, Solingen und im Kreis Unna - Menschen, die von den Fluten weggerissen wurden oder in ihren gefluteten Kellern starben.
-
Tagesschau
2021-07-15 de Besonders dramatisch ist die Unwetterlage in Rheinland-Pfalz und NRW
Besonders dramatisch ist die Unwetterlage in Rheinland-Pfalz und NRW
-
Tagesschau
2021-07-15 de Jan Schulte, WDR, über die aktuelle Situation in Hagen
Jan Schulte, WDR, über die aktuelle Situation in Hagen
-
Tagesschau
2021-07-15 de Bahnverkehr massiv beeinträchtigt
Bahnverkehr massiv beeinträchtigt
↑ 2021-06-02
-
Arte
2021-06-02 de Starkregen und Sturzfluten
Starkregen und Sturzfluten
2016: Starkregen und Sturzfluten in Simbach in Niederbayern
Am 1. Juni 2021 begeht Simbach am Inn in Niederbayern ein trauriges Jubiläum.
Sieben Menschen kamen vor fünf Jahren bei einem Jahrhundert-Hochwasser ums Leben.
Die Katastrophe hat sich den Einwohnern tief ins Gedächtnis gebrannt.
Die Angst, dass sich die Katastrophe wiederholen könnte, lässt die Bürger nicht los.
Was muss für nachhaltigen Hochwasserschutz getan werden?
Der Simbach, der der Gemeinde seinen Namen gegeben hat, ist eigentlich nur ein kleines Gewässer, doch der Starkregen hatte es im Nu anschwellen lassen.
Der Ort war von den Wassermassen, dem Treibholz und dem Schlamm, die diese mit sich brachten, regelrecht verwüstet worden.
Die Katastrophe hat sich den Einwohnern tief ins Gedächtnis gebrannt.
Inzwischen wurde zwar viel Aufbauarbeit geleistet,
wichtige Schutz-Maßnahmen wurden angestoßen.
Doch die Mühlen der Bürokratie mahlen langsam und vieles steht bisher nur auf dem Papier.
Unterdessen lässt die Angst, dass sich die Katastrophe wiederholen könnte, die Bürger nicht los.
Und die Angst ist berechtigt.
Experten sagen: Starkregen und Sturzfluten, wie sie Simbach 2016 erlebt hat, werden zunehmen - eine von vielen Folgen des Klimawandels.
Der Film begleitet die Anstrengungen in Simbach und andernorts, solchen Unwetter-Katastrophen vorzubeugen.
Und er hinterfragt: Sind wir gerüstet?
Oder muss mehr für nachhaltigen Hochwasserschutz getan werden?
Wie schützt man sich zum Beispiel im benachbarten Österreich, wo man aufgrund von Gletscherschmelze und Wildbächen von jeher Erfahrungen im Umgang mit solchen akuten Wetterereignissen hat?
↑ 2021-03-28
-
[W] wie Wissen
2021-03-28 de Die Flut kommt - todsicher
Die Flut kommt - todsicher
Wie die deutschen Küsten gegen die steigenden Fluten aufgerüstet werden
Hochwasserschutz in der Großstadt
Meeresspiegel - Wie wird er gemessen und was lässt ihn künftig wie stark steigen?
Sperrwerke und Mega-Dämme.
↑ 2021-05-09
-
2021-05-09de
 Fluss-Hochwässer haben in den letzten 50 Jahren global abgenommen
(K35)
Fluss-Hochwässer haben in den letzten 50 Jahren global abgenommen
(K35)
▶Klimaschau Wird demnächst gelöscht, da die Kalte Sonne nicht mehr publiziert wird!
-
Geophisical Research Letter / Slater et al. 2021
Global Changes in 20-Year, 50-Year, and 100-Year River Floods -
University of Oxford
Major floods increased in temperate climates but decreased elsewhere: Oxford study -
NoTricksZone / Kenneth Richard
New Study: 100-Year Flood Events Are Globally Decreasing In Frequency And Probability Since 1970
↑ 2019-10-27
-
BR Doku
2019-10-26 de Unwetter und Überschwemmungen: Der Wetter-Wahnsinn - stürmisch und teuer
Unwetter und Überschwemmungen: Der Wetter-Wahnsinn - stürmisch und teuer
In dieser Dokumentation aus dem Jahr 2018
geht es um die Änderungen beim Wetter und die katastrophalen Auswirkungen auf uns und unsere Umwelt.
Der ARD-Wetterexperte Sven Plöger verdeutlicht, welche Rolle bei den zunehmenden Unwettern der Klimawandel spielt und Versicherungsexperten erklären, welche Folgen das für Hausbesitzer hat.
↑ Flut: Videos
Mit folgendem Link wird von anderen Webseiten auf diese Seite verwiesen.
▶↑ 2021-09-22
-
Wetternet
2021-09-22 de Klimaerwärmung gestoppt? Eisschmelze am Nordpol ist ausgebremst!
Klimaerwärmung gestoppt? Eisschmelze am Nordpol ist ausgebremst!
Überraschende Daten vom Meereis am Nordpol.
Ist die Eisschmelze ausgebremst?
Aktuelle Daten deuten darauf hin, dass wir kein neues Rekordminimum bei der Eisfläche bekommen werden.
Erholt sich das Meereis am Nordpol wieder?
↑ 2021-09-20
Es ist die erste große Flutbilanz der Regierung
- und offenbar sind Bund und Länder trotz Versagen und katastrophaler Pannen mit ihrer Arbeit sehr zufrieden!
Vor allem ein Satz in dem 20-seitigen Papier (liegt BILD vor) von Innen- und Finanzministerium macht sprachlos.
Auf Seite 10 heißt es:
"Das System des Bevölkerungsschutzes mit der klaren kommunalen Verantwortung und der aufwachsenden Unterstützung durch Landkreise, Länder und den Bund hat sich in dieser langanhaltenden Hochwasserlage grundsätzlich als trag- und leistungsfähig erwiesen, wird aber gleichwohl im Rahmen eines Evaluierungsprozesses betrachtet werden."
Dabei klagen die Flutopfer u. a. über nächtliche Plünderungen.
Und Kanzlerin Angela Merkel (67, CDU) hatte bei ihrem letzten Besuch im Flutgebiet Anfang September versprochen:
"Wir werden Sie nicht vergessen."
Entsprechend empört sind Politiker über den selbstzufriedenen Tonfall der Bilanz.
CSU-Innenexperte Michael Kuffer (49) zu BILD:
"Die Familien von 183 Todesopfern und 800 Verletzten müssen das als puren Hohn empfinden!"
Katharina (37, Büroangestellte) und Thomas Dederich (39) aus
Walporzheim:
Die Alarmierung am 14. Juli hat absolut nicht funktioniert.
Dieses Versagen war das schlimmste.
90 Prozent der Hilfe kam dann von Freiwilligen.
Es gibt hier Menschen, die zu Hause nicht essen oder duschen können.
Es ist immer noch eine Katastrophe und wir finden, so sollte man das auch behandeln."
↑ 2021-09-19
-
Die kalte Sonne (Fritz Vahrenholt & Sebastian Lüning)
2021-07-19 de Schuld an der Katastrophe war nicht der Klimawandel - sondern Starkregen!Die schlimme Flutkatastrophe in Westdeutschland rüttelt weiter auf.
Nachdem die Überschwemmungen zunächst von Aktivisten und Politikern reflexhaft als Produkt des Klimawandels interpretiert wurde, hat sich nun das Blatt gewendet.
Immer mehr Medien hinterfragen nun die Instrumentalisierung der Flut und fordern eine ganz andere Diskussion:
Weshalb haben die Bundesregierung und Regionalverwaltungen trotz Starkregenwarnung bis zu 4 Tage vor der Katastrophe nicht entschiedener reagiert?
Weshalb wurde nicht früher und großmaßstäblicher evakuiert.
Eine britische Expertin für Hochwasserwarnungen zeigt sich enttäuscht, dass die deutschen Behörden hier offenbar gepennt haben.
Die Politik war mehr am aktuellen Wahlkampf interessiert, und kümmerte sich zu spät um das praktische Management vor Ort.
Es ist einfach nicht genug, fragwürdige Thesen von Klimaalarmisten zu verkünden, anstatt rechtzeitig und umsichtig zu handeln.
Wenn vermeintliche Gefahren im Jahr 2100 wichtiger sind, als Katastrophenvorsorge echter Gefahren 2021, dann sagt das viel über die Entscheidungsträger.
Vielleicht rütteln die schlimmen Vorkommnisse die Planer nun endlich wach:
Kümmert Euch um die wahren Probleme, anstatt über eine schönschaurige Klima-Horror-Picture Show der weit entfernten Zukunft zu theoretisieren.
Hier einige wichtige Artikel zum Thema der letzten Tage.
↑ 2021-08-27
Die verheerende Flut hat viele Häuser zerstört.
Von einigen ist nichts übriggeblieben, andere werden abgerissen oder wiederaufgebaut.
Diese Woche sind wir in Altenahr unterwegs, unter anderem im Ortsteil Altenburg, in dem der Großteil der Häuser schwere Schäden hat.
Wie geht es den Menschen dort?
Viele wissen noch nicht, wieviel Geld sie aus dem Spendentopf bekommen und unter welchen Voraussetzungen.
Unklar ist auch, ob sie ihr Haus am ursprünglichen Ort wieder aufbauen dürfen.
Viele Ahr-Anwohner sind ratlos.
↑ 2021-08-19
Die Welt dreht sich weiter und die Flutkatastrophe ist zum größten Teil wieder aus den Medien verschwunden.
Zurück bleibt nur die ewige Leier vom menschengemachten Klimawandel.
Doch die Menschen, die um ihre Liebsten trauern, die von den Geschehnissen traumatisierten sind, die alles verloren haben, sind weiterhin da, wenn die Aufmerksamkeit der Medien lange abgeklungen ist.
In unserer heutigen Sendung "Flutkatastrophe und Klimawandel - Große Sprüche, keine Taten" sprechen wir darüber, wie die schrecklichen Bilder der Flut zwar liebend gerne für die Klimaagenda instrumentalisiert wurden, aber keine reellen Taten gefolgt sind - die Opfer wurden alleine gelassen, Helfer sogar noch vertrieben.
Ins Studio zugeschaltet wird Britta Mecking aus Blessem in NRW.
Sie ist Flutopfer und wird aktuell vor Ort gebraucht, deshalb kann sie nicht ins Studio kommen.
Frau Mecking schildert, dass niemand etwas getan hat, um sie zu warnen.
Wie sie und ihre Nachbarn Keller leer gepumpt haben - auf sich gestellt, denn die Zufahrtsstraße wurden abgeriegelt, auch Helfer konnten nicht durchkommen.
Im Studio sind
Norbert Bolz - Publizist, Medien- und Kommunikationstheoretiker -
und Sebastian Lüning - Geologe, Privatforscher, Autor des Buches "Die kalte Sonne".
Sie sprechen mit Roland Tichy über Fakten.
Darüber, dass es schon immer Flutkatastrophen gegeben hat, dafür braucht es keinen menschengemachten Klimawandel.
Und obwohl es den Politiker ein großes Anliegen ist, Probleme zu lösen, die weit in der Zukunft liegen, scheinen sie keinerlei Interesse daran zu haben, die Katastrophen zu beseitigen, die im Jetzt liegen.
Doch wie kann es sein, dass die Politiker damit durchkommen?
Und wann werden die Menschen endlich merken, dass unser Politiker nur reden, aber nicht handeln?
Auch darüber diskutiert Roland Tichy mit seinen Gästen heute Abend bei Tichys Ausblick.
↑ 2021-08-16
-
EIKE Europäisches Institut für Klima und Energie
2021-08-16 de Klimawissen - kurz & bündig: Wie die Politik Ahrweiler instrumentalisiert
Klimawissen - kurz & bündig: Wie die Politik Ahrweiler instrumentalisiert
Nachdem die heißen Sommer mit Dürre ausfielen, nutzten Medien und Politiker sogleich das Hochwasser als Beweis für den menschgemachten Klimawandel.
↑ 2021-08-13
-
Outdoor Chiemgau Der Krisenvorsorgekanal
2021-08-13 de Warnung vor Gefahren? Aber wie? DWD APP, NINA + Insiderinfos Ahrtal
Warnung vor Gefahren? Aber wie? DWD APP, NINA + Insiderinfos Ahrtal
Wie kann man sich von Fehlentscheidungen der Behörden unabhängig machen und immer gewarnt werden?
↑ 2021-08-08
-
Bastifbr
2021-08-08 de Vor und nach der Flut 2021:
Die Ahr-Rotweinstraße von Altenahr nach Dernau
Vor und nach der Flut 2021:
Die Ahr-Rotweinstraße von Altenahr nach Dernau
Das Video zeigt die Schäden entlang der Rotweinstraße im Ahrtal exakt zwei Wochen nach der Flut vom 14. auf den 15. Juli 2021.
Beginn der Fahrt ist hier vom völlig zerstörten Abschnitt "Am Tunnel" in Altenahr in Richtung Osten nach Dernau.
Besten Dank an "Rockdrummer71", der das Video im Juli 2015 aus seiner Perspektive gefilmt hat und an Timmy für die Ideenfindung.
↑ 2021-08-06
-
NZZ Neue Zürcher Zeitung
2021-08-06 de Die verheerende Flut in Ahrweiler -
eine Video-Rekonstruktion des Hochwassers
Die verheerende Flut in Ahrweiler -
eine Video-Rekonstruktion des Hochwassers
Die mit Abstand meisten Todesopfer forderte das Hochwasser in Deutschland im Landkreis Ahrweiler.
Warum war die Flut dort so verheerend?
Augenzeugenvideos der Hochwasserkatastrophe in Deutschland.
Es ist die Naturkatastrophe mit den meisten Todesopfern seit den 1960er Jahren.
Besonders verheerend war die Flut in Rheinland-Pfalz im Landkreis Ahrweiler.
Über 130 Menschen verloren hier ihr Leben.
Wie genau spielte sich diese Katastrophe ab?
Wir zeigen Wetterdaten, Satellitenbilder und Zeugenvideos, um besser zu verstehen, wie es zur tödlichen Flut kommen konnte.
Montag, 12. Juli 2021 - die Vorhersagen
Wir beginnen die Rekonstruktion zwei Tage vor der Überschwemmung im Ahrtal.
Wettervorhersage Deutscher Wetterdienst vom Montag, 12. Juli 2021:
«Das Wetter in Deutschland will sich einfach nicht beruhigen.»
In der Vorhersage prognostiziert der Deutsche Wetterdienst Überflutungen in Rheinland-Pfalz.
Sprecher: «Lokal sind nach aktuellem Stand
sogar Mengen bis 200 Liter pro Quadratmeter
nicht ausgeschlossen.
Das bedeutet natürlich auch in dieser Region: Überflutungen.»
Dienstag, 13. Juli - Warnung vor extremen Unwettern
Am nächsten Tag fällt vielerorts in Deutschland enorm viel Regen.
Es kommt zu ersten Hochwassern.
Der Deutsche Wetterdienst spricht jetzt für 17 Regionen eine Warnung vor extremen Unwettern aus - höchste Warnstufe.
Darunter auch für den Landkreis Ahrweiler.
Mittwoch, 14. Juli - Hochwasserwarnung und Evakuierung
Die Ahr fliesst hier mit vielen Kurven durch das Tal -
Häuser sind nahe am Fluss gebaut.
Hügel umgeben die Dörfer.
Am Mittwoch, dem 14. Juli, trifft der extreme Starkregen die Region.
Der sonst ruhige Fluss verwandelt sich in einen reissenden Strom - hier trägt der Fluss ein Wohnmobil mit.
Über ein Internetarchiv haben wir die Hochwasserfrühwarnung für Rheinland-Pfalz aufgerufen.
Sicher seit kurz vor 18 Uhr gilt auch hier höchste Warnstufe für die Ahr:
Das bedeutet: «Überflutung bebauter Gebiete in grösserem Umfang.»
Diese Grafik zeigt den Pegelstand der Ahr in der Gemeinde Altenahr.
Am Nachmittag steigt der Pegel plötzlich stark an.
Er übersteigt die Marke des bisherigen Höchststands.
Um 20 Uhr 45 erlischt das Signal - der Pegelstandsmesser wurde von den Fluten weggerissen.
Der letzte gemessene Pegelstand beträgt 5,7 Meter.
Der Krisenstab soll erst gegen 22 Uhr bemerkt haben, dass sich der Pegel nicht mehr verändert, berichtet die «Rhein-Zeitung».
Tatsächlich steigt der Pegel weiter an.
Um 23 Uhr 09 folgt der Aufruf zur Teilevakuierung:
«Aufgrund der starken Regenereignisse sollen die Bewohnerinnen und Bewohner der Städte Bad Neuenahr-Ahrweiler, Sinzig und Bad Bodendorf, die 50 Meter rechts und 50 Meter links von der Ahr wohnen, ihre Wohnungen verlassen.»
Für viele Menschen kommt dieser Aufruf zu spät.
Die 50 Meter sind zu knapp bemessen.
Donnerstag, 15. Juli, und die Tage danach - retten, bergen und die Aufarbeitung
Diese Aufnahme zeigt das überflutete Seniorenheim und die Grundschule in Altenahr.
Sie liegen über 250 Meter vom Fluss entfernt.
Um das Ausmass der Katastrophe zu erfassen, werden Satellitendaten zu Hilfe genommen.
Hier eine Notfallkarte, um Rettungskräfte zu unterstützen.
Die roten Punkte markieren zerstörte Gebäude, die orangen beschädigte Gebäude.
In Sinzig, kurz bevor die Ahr in den Rhein fliesst, wird ein Heim für Menschen mit Beeinträchtigung überflutet - allein hier sterben 12 Menschen.
Ein Grund, warum die Region nicht besser auf Hochwasser vorbereitet gewesen sein könnte:
Die Gefahr wurde möglicherweise unterschätzt.
Hier die Gefahrenkarte für extreme Hochwasser, die statistisch seltener als alle 100 Jahre auftreten sollten.
Die blauen Flächen würden dabei überflutet - hier wieder das Seniorenheim und die Grundschule, welche wir schon kennen.
Viele dieser Schäden hätte es also selbst bei einem extremen Hochwasser gar nicht geben dürfen.
Dagegen zeigt ein neuer Bericht:
Für die Berechnung der Überflutungsgefahr wurden historische Hochwasser im Ahrtal aus den Jahren 1804 und 1911 nicht berücksichtigt.
![]()
![]() Pegel Altenahr 1804 und 1911 nicht berücksichtigt
Pegel Altenahr 1804 und 1911 nicht berücksichtigt
grau: Maximaler Abflusss,
orange: Abfluss Mittelwert,
blau: Minimale Abfluss

So wurde die Gefahr möglicherweise unterschätzt.
Die Schäden durch die Flut sind riesig.
Rettungskräfte, die Bundeswehr und Freiwillige helfen bei der Evakuierung und den Aufräumarbeiten.
Der Wiederaufbau wird noch Jahre dauern.
Die Rekonstruktion zeigt:
Das Hochwasser wäre vorhersehbar gewesen
- doch es war wohl die Verkettung von verschiedenen Faktoren, welche die Flut im Landkreis Ahrweiler zur verheerenden Katastrophe machte.
↑ 2021-08-06
-
SWR Doku
2021-08-06 de Die Müllflut - Schuttentsorger im Ahrtal
Die Müllflut - Schuttentsorger im Ahrtal
Das Hochwasser im Ahrtal hat nicht nur Menschenleben gekostet, Existenzen vernichtet und Gebäude zerstört - es hat auch Müll und Schutt historischen Ausmaßes zurückgelassen.
Freiwillige Helfer, Feuerwehr und THW befreien genauso wie Bundeswehr und diverse Baufirmen Gebäude und Straßen von Schlamm, Trümmern und Treibgut, dazu kommen Tonnen an Sperrmüll aus den Häusern der Anwohner.
Doch wohin damit?
Die aktuelle Reportage beleuchtet neben der Müllbergung im Ahrtal, auch die Müllverarbeitung auf dem Umschlagplatz in Niederzissen, auf dem die Mitarbeiter teils 14 Stunden arbeiten.
Schlussendlich wird die Müll-Flut auf der Deponie Eiterköpfe in Ochtendung auf einem 8-Meter-hohen Müllberg endgelagert, den 400 LKW täglich mit Sperrmüll, Schrott und Unrat aus dem Katastrophengebiet füllen.
↑ 2021-08-04
-
ARD
2021-08-04 de Organisationschaos im Krisengebiet? | Report Mainz
Organisationschaos im Krisengebiet? | Report Mainz
Seit zweieinhalb Wochen kämpfen die Menschen im Ahrtal gegen Schlamm und Chaos.
Unsere Reportage aus dem Flutgebiet zeigt, bei der Organisation der Hilfe läuft einiges schief.
↑ 2021-08-03
-
ARD
2021-08-03 de REPORT MAINZ vom 3. August 2021
REPORT MAINZ vom 3. August 2021
↑ 2021-08-03
-
Spiegel TV
2021-08-03 de Wer zahlt? Und wer ist schuld? - Die Aufarbeitung der Flut
Wer zahlt? Und wer ist schuld? - Die Aufarbeitung der Flut
Knapp drei Wochen nach der Flut wird die Katastrophe aufgearbeitet.
Wer ist schuld?
Und warum wurden viele Menschen nicht rechtzeitig gewarnt?
Auch die Folgekosten des Hochwassers müssen beziffert werden.
Die Schadenregulierer der Versicherungen sind vor Ort.
SPIEGEL TV mit einer Reportage aus dem Ahrtal.
↑ 2021-07-28
-
Dominik Jung
2021-07-28 de Kältewelle im August!
Temperatursturz mitten in den Hundstagen.
Keine Sommerhitze in Sicht!
Kältewelle im August!
Temperatursturz mitten in den Hundstagen.
Keine Sommerhitze in Sicht!
Was ist denn nun los? Der August startet richtig frisch.
Nachts sinken die Temperaturen unter 10 Grad, in den Alpen deutet sich in den Tälern sogar Bodenfrost an.
Ist der Hochsommer vorbei, bevor er überhaupt angefangen hat?
↑ 2021-07-27
-
Spiegel TV
2021-07-27 de Zwischen Hoffnung, Wut und Trauer: Das Leben nach der Flut
Zwischen Hoffnung, Wut und Trauer: Das Leben nach der Flut
Ein Mann verliert sein Hotel und die Versicherung will nicht zahlen.
Ein Pärchen hat nur noch einen Rucksack und weiß nicht, wie es weitergehen soll.
Und mittendrin: tausende freiwillige Helfer, die Schlamm schippen und Häuser entrümpeln.
Eine Reportage aus den Krisengebieten der Ahr.
↑ 2021-07-27
-
WDR Doku
2021-07-27 de Nach der Flut: Sie haben alles verloren
Nach der Flut: Sie haben alles verloren
Über mehrere Tage hat der WDR für diese aktuelle Doku Menschen in drei Orten im Westen bei der Bewältigung der Hochwasserkatastrophe begleitet: in Erftstadt, im Winzerdorf Dernau und in Bad Münstereifel.
In Erftstadt-Blessem tut sich ein riesiger Krater auf, der mehrere Häuser und Straßen verschluckt hat.
Auch das Haus, in dem Sylvia und Christian Schauff bis vor kurzem gewohnt haben, ist darin verschwunden.
Aus ihrer Wohnung konnten sie sich nur noch durchs Hochwasser watend retten - mit ihren beiden Haustieren, einem Hund und einer Katze.
Blessem, das war bis vor kurzem "ihr kleines Paradies", in dem die Nachbarschaft stimmte, Gemüse und Obst angebaut wurde.
Jetzt stehen sie vor dem Nichts.
Und gleichzeitig erfahren sie Hilfe von vielen Seiten.
Viele, vor allem junge Helfer sind gekommen, um mit anzupacken, wo es geht.
Viele Keller in Blessem sind wieder leergepumpt, Häuser entrümpelt, langsam wird die Lage etwas übersichtlicher.
Und bei einigen hat sich die Betroffenheit in Wut verwandelt.
Wie konnte es sein, dass eine Kiesgrube ein derartiges Loch in ihren Ort reißt?
Darüber soll jetzt in einer Bürgerversammlung geredet werden.
Die Gemeinde Dernau am Rotweinwanderweg im Herzen des Ahrtals ist weltberühmt für ihre Weine.
Jetzt sieht es hier teilweise aus wie in einem Kriegsgebiet: Trümmerhaufen, zugeschüttete Gassen, fehlende Häuserfronten, überall Schlamm. Über 120 Tote meldet der Kreis Ahrweiler eine Woche nach der Flut, mehr als 150 Menschen werden noch vermisst.
Dernau hat keinen Strom, kein Trinkwasser, es wird Monate dauern, allein das Nötigste wiederherzustellen.
"Unser Haus ist komplett zerstört", sagt Wolfgang W., der wie viele andere jetzt damit beschäftigt ist, den Schlamm in Eimerketten aus den Häusern zu schippen.
Jeder, der hilft, ist von oben bis unten voll mit Schlamm.
Doch jeden Tag kommen unzählige Helfer:innen nach Dernau, manche aus 400 Kilometer Entfernung.
Im nahegelegenen Ort Gelsdorf liegt das Bauunternehmen von Tobias und David Lanzerath.
In den letzten Tagen haben die beiden Brüder ihre Firma gemeinsam mit Freund:innen und Kolleg:innen in ein Spenden- und Logistikzentrum verwandelt.
Sie alle packen ehrenamtlich mit an.
Sie halten zusammen, um in Dernau zu retten, was zu retten ist.
Als die Wassermengen den Hof von Christin Vongerichten und ihrem Mann in Bad Münstereifel fluten, stehen ihre 40 Pferde plötzlich im Wasser.
Unter Einsatz ihres Lebens holen sie die Pferde aus den Boxen und bringen sie den Berg hinauf, wo sie vor dem Wasser sicher sind.
Die Pferde konnten sie retten, aber die Ranch ist ein Totalschaden, die Halle einsturzgefährdet, die Ställe sind kaputt.
Im mittelalterlichen Bad Münstereifel selbst kämpfen Spezialist:innen zusammen mit den Menschen vor Ort auch um das Gedächtnis ihrer Stadt.
Schränke voller Urkunden, einige über ein halbes Jahrtausend alt, müssen aus dem überfluteten Stadtarchiv geborgen und schnellstmöglich gereinigt und schockgefroren werden.
Einen Steinwurf entfernt wurde der Haushaltswarenladen von Hubert Roth völlig zerstört, er hat rund eine halbe Million Euro Schaden, keinen Versicherungsschutz.
Dafür jede Menge Wut:
"Die versprochene Hilfe ist jetzt schon zu klein dimensioniert, und nach meinen Erfahrungen bleibt es eh bei Versprechungen - Wahlkampfgetöse, sonst nichts!".
Bücherladenbesitzer Josef Mütter ist bewegt von der Hilfe vor Ort:
"Diese Hilfsbereitschaft, diese gelebte Nächstenliebe, die man jetzt überall im Ort sieht, muss das Fundament des Neuanfangs werden."
Angela Merkel und Armin Laschet sprechen an diesem Tag direkt vor seinem Laden.
Von ihnen werden wohl nicht die entscheidenden Impulse kommen, sagt Josef Mütter.
"Mit uns Menschen fängt alles an."
↑ 2021-07-27
Die Rheinzeitung aus Koblenz fasst heute das unfassbare Behördenversagen zusammen:
Zwischenzeitlich wurde auf dem Weg zur ganz großen Katastrophe sogar noch Entwarnung gegeben!
Katastrophe mit Ansage!
Ein aktueller Podcast mit unserem Wetterexperten Dominik Jung:
Das aktuelle Wetter für Deutschland vom 19. Juli 2021.
Man hat selten so ein Totalversagen der deutschen Behörden erlebt wie bei dieser Flut-Katastrophe.
Die Archivkarten zeigen eindeutig, dass seit Tagen klar war, was da auf Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz zukommt.
Selbst die Aussage das Wasser sei erst in der Nacht und bei Dunkelheit gekommen kann widerlegt werden.
Das macht einfach nur fassungslos.
Diplom-Meteorologe Dominik Jung fasst die Prognosen im Vorfeld zusammen.
Seit Sonntag war schon klar, dass extreme Regenmengen vom Himmel kommen.
↑ 2021-07-24
Am Samstagnachmittag hat in den Krisengebieten in Rheinland-Pfalz erneut Regen eingesetzt.
Die Lage sei aber nicht so verschärft wie vergangene Woche, hieß es.
Freiwillige Helfer müssen die Region verlassen.
Im Laufe des Tages sei laut Deutschem Wetterdienst (DWD) mit örtlichen Niederschlägen im Bereich von maximal 30 bis 40 Litern pro Quadratmeter zu rechnen, teilte die Leiterin des Katastrophenschutzstabs, Begona Hermann, mit.
Stellenweise würden auch nur 10 Liter erwartet.
Ab Sonntagmorgen gegen 6 Uhr könne sich die Wetterlage aber noch verschärfen.
Den besonders betroffenen Kommunen sei daher ein Evakuierungsangebot gemacht worden, sagte Hermann.
In den gefährdeten Orten Schuld, Insul, Dümpelfeld und Bad Neuenahr-Ahrweiler sollen die Menschen demnach mit Shuttlebussen zu einer Notunterkunft in Leimersdorf gebracht werden können.
"Das entscheiden dann die Menschen selbst", so Hermann.
In diesem SWR Extra seht ihr den aktuellen Stand zum Hochwasser in Rheinland-Pfalz.
↑ 2021-07-22
-
Dominik Jung
2021-07-22 de Klimawandel: Ausrede für politisches Totalversagen in
der Flutkatastrophe! Neue heftige Gewitter!
Klimawandel: Ausrede für politisches Totalversagen in
der Flutkatastrophe! Neue heftige Gewitter!
Das aktuelle Wetter für Deutschland vom 21. Juli 2021.
Der Klimawandel muss nach der Flut-Katastrophe als Ausrede für ein unfassbares politisches und behördliches Versagen herhalten.
Einfach kaum zu fassen.
Beim Wetter ist zunächst noch Ruhe angesagt, doch ab dem Wochenende geht es schon wieder los.
Neue Unwetter ziehen auf.
Es wird aber nicht flächendeckend Starkregen geben wie am vergangenen Mittwoch.
↑ 2021-07-20
-
Dominik Jung
2021-07-20 de Das Totalversagen der Behörden! Wetterkarten beweisen:
Extrem‑Unwetter war seit Tagen bekannt!
Das Totalversagen der Behörden! Wetterkarten beweisen:
Extrem‑Unwetter war seit Tagen bekannt!
Katastrophe mit Ansage! Ein aktueller Podcast mit unserem Wetterexperten Dominik Jung.
-
Dominik Jung
2021-07-20 de Katastrophenschutz: Wie hätten die vielen Toten verhindert werden können? | DW News
Katastrophenschutz: Wie hätten die vielen Toten verhindert werden können? | DW News
Hätten die vielen Toten verhindert werden können?
War die Flutkatastrophe in Deutschland vorherzusehen?
Jetzt werden die Fragen drängender und die Antworten von politisch verantwortlichen kleinlauter.
Das Innenministerium im Bundesland Nordrhein-Westfalen hat eingeräumt, dass die Überflutungen nicht überraschend kamen.
Denn vier Tage vor den Fluten hat das Europäische Hochwasser-Warnsystem die Regierungen in Deutschland und Belgien gewarnt.
24 Stunden vorher sogar sehr präzise.
Eine britische Professorin, die das Warnsystem mitentwickelt hat spricht von monumentalem Systemversagen.
↑ 2021-07-19
-
Akademie Raddy
2021-07-19 de Flutkatastrophe 2021: Die wahren Gründe für die Flut
Flutkatastrophe 2021: Die wahren Gründe für die Flut
Nachtrag:
Aufgrund der Kritik hat der Wupperverband jetzt gesagt, warum er die Talsperren voll befüllt hat und der Hochwasserschutz daher nicht funktionieren konnte:
"Wir hatten Angst vor Dürren durch Klimawandel, und daher haben wir alle Talsperren gefüllt."
Musste Wuppertal in den Fluten versinken, weil man sich im Klimawahn befindet?
Oder ist dies eine Ausrede, damit Tourismus und Ökostrom funktionieren?
Die Schweiz hat übrigens eine Richtlinie für Talsperren: Talsperren dürfen höchstens zu 80% befüllt sein.
Lokalnachrichten aus Remscheid
Ein Lokalsender aus dem Überschwemmungsgebiet Remscheid führte kurz vor dem Hochwasser ein Interview mit einem GRÜNEN Politiker (Sportdezernent Thomas Neuhaus) und einem Mitarbeiter von "Arbeit Remscheid" am Rande der Wupper-Talsperre.
Dort freut man sich, dass der Wasserstand der Wuppertalsperre extrem hoch ist, was toll für das Tourismusprojekt ist.
Dummerweise scheinen die beiden Jungs nicht zu begreifen, dass eine volle Talsperre keinen Schutz gegen Hochwasser mehr bietet.
↑ 2021-07-18
-
Crazy Krauthead
2021-07-18 de Bürgermeister von Schuld gibt Merkel Kontra
Bürgermeister von Schuld gibt Merkel Kontra
Frau Merkel reiste wegen den Hochwasserschäden nach Schuld in der Eifel und gab da natürlich eine Pressekonferenz….
↑ 2021-07-18
Die aktuelle Lage im Südwesten ist weiterhin angespannt.
Im Großraum Ahrweiler in Rheinland-Pfalz ist die Zahl der Todesopfer laut Angaben der Polizei auf mindestens 110 gestiegen.
Zudem gebe es mehr als 670 Verletzte.
Während die Pegelstände mancherorts zurückgehen und die Aufräum-Arbeiten voranschreiten, wird das ganze Ausmaß der Hochwasserkatastrophe vor allem im Nordes des Landes deutlich.
↑ 2021-07-17
-
NWR Paddlier
2021-07-17 de Wuppertalsperre läuft über:
Maximale Stauhöhe um Mitternacht überschritten:
14. Juli 2021 23:00
Wuppertalsperre läuft über:
Maximale Stauhöhe um Mitternacht überschritten:
14. Juli 2021 23:00
Durch anhaltenden Starkregen erreichte der Stauinhalt der Wuppertalsperre am 14. Juli 2021 um 23:00 das Vollstauziel.
Weshalb der Hochwasserschutzraum binnen kurzer Zeit aufgebraucht war und das Wasser ungehindert über den Überlauf ins Tal stürzte, wo die ersten Wupperorte rasch vom Wasser erreicht wurden.
Zwischen 23:00 und 6:00 strömten jedoch noch über eine Million Kubikmeter Wasser in das Staubecken.
↑ 2021-07-16
-
SWR
2021-07-16 de Hochwasser: Die aktuelle Lage im Südwesten
| SWR Extra am 16.07.2021
Hochwasser: Die aktuelle Lage im Südwesten
| SWR Extra am 16.07.2021
Die Hochwasser-Situation in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen ist immer noch katastrophal.
Starke Regenfälle hatten besonders im Norden von Rheinland-Pfalz für Hochwasser und Überflutungen gesorgt.
Baden-Württemberg hilft mit Rettungskräften und Material.
In den Katastrophengebieten von Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen ist die Lage nach wie vor schwierig.
Immer noch herrscht Hochwasser und es werden viele Menschen vermisst, Gebäude müssen evakuiert und Straßen von Schutt und Schlamm geräumt werden.
Das Land Baden-Württemberg hat die Unterstützung für das Nachbarland Rheinland-Pfalz inzwischen deutlich ausgeweitet, teilte der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl (CDU) am Freitag mit.
Weitere 600 Einsatzkräfte von Sanitätsdienst, Feuerwehr und Technischem Hilfswerk seien am Donnerstagabend und in der Nacht in die Hochwassergebiete in Rheinland-Pfalz entsandt worden.
Höhenretter, Hochwasserspezialisten und Hubschrauber seien dabei.
↑ 2021-07-15
-
Tagesschau
2021-07-15 de "Es ist wirklich verheerend"
"Es ist wirklich verheerend"
Nach dem schweren Unwetter gehen die Einsatzkräfte von mindestens 38 Toten in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen aus.
Zahlreiche Menschen werden noch vermisst, viele warten auf Rettung.
Ministerpräsidentin Dreyer zeigte sich schockiert.
Ganze Orte sind überflutet, Häuser einfach weggeschwommen.
Polizeihubschrauber sind unterwegs, um Menschen von Hausdächern zu retten.
Wie viele Menschen im Zusammenhang mit der Katastrophe starben, ist noch unklar - auch, weil noch immer Dutzende Menschen vermisst werden.
Allein im besonders schwer betroffenen Kreis Ahrweiler geht die Polizei von 18 Toten aus.
Aus dem Kreis Euskirchen im ebenfalls betroffenen Bundesland Nordrhein-Westfalen werden 15 Tote gemeldet.
Weitere Tote gibt es in Rheinbach, Köln, Solingen und im Kreis Unna - Menschen, die von den Fluten weggerissen wurden oder in ihren gefluteten Kellern starben.
-
Tagesschau
2021-07-15 de Besonders dramatisch ist die Unwetterlage in Rheinland-Pfalz und NRW
Besonders dramatisch ist die Unwetterlage in Rheinland-Pfalz und NRW
-
Tagesschau
2021-07-15 de Jan Schulte, WDR, über die aktuelle Situation in Hagen
Jan Schulte, WDR, über die aktuelle Situation in Hagen
-
Tagesschau
2021-07-15 de Bahnverkehr massiv beeinträchtigt
Bahnverkehr massiv beeinträchtigt
↑ 2021-06-02
-
Arte
2021-06-02 de Starkregen und Sturzfluten
Starkregen und Sturzfluten
2016: Starkregen und Sturzfluten in Simbach in Niederbayern
Am 1. Juni 2021 begeht Simbach am Inn in Niederbayern ein trauriges Jubiläum.
Sieben Menschen kamen vor fünf Jahren bei einem Jahrhundert-Hochwasser ums Leben.
Die Katastrophe hat sich den Einwohnern tief ins Gedächtnis gebrannt.
Die Angst, dass sich die Katastrophe wiederholen könnte, lässt die Bürger nicht los.
Was muss für nachhaltigen Hochwasserschutz getan werden?
Der Simbach, der der Gemeinde seinen Namen gegeben hat, ist eigentlich nur ein kleines Gewässer, doch der Starkregen hatte es im Nu anschwellen lassen.
Der Ort war von den Wassermassen, dem Treibholz und dem Schlamm, die diese mit sich brachten, regelrecht verwüstet worden.
Die Katastrophe hat sich den Einwohnern tief ins Gedächtnis gebrannt.
Inzwischen wurde zwar viel Aufbauarbeit geleistet,
wichtige Schutz-Maßnahmen wurden angestoßen.
Doch die Mühlen der Bürokratie mahlen langsam und vieles steht bisher nur auf dem Papier.
Unterdessen lässt die Angst, dass sich die Katastrophe wiederholen könnte, die Bürger nicht los.
Und die Angst ist berechtigt.
Experten sagen: Starkregen und Sturzfluten, wie sie Simbach 2016 erlebt hat, werden zunehmen - eine von vielen Folgen des Klimawandels.
Der Film begleitet die Anstrengungen in Simbach und andernorts, solchen Unwetter-Katastrophen vorzubeugen.
Und er hinterfragt: Sind wir gerüstet?
Oder muss mehr für nachhaltigen Hochwasserschutz getan werden?
Wie schützt man sich zum Beispiel im benachbarten Österreich, wo man aufgrund von Gletscherschmelze und Wildbächen von jeher Erfahrungen im Umgang mit solchen akuten Wetterereignissen hat?
↑ 2021-03-28
-
[W] wie Wissen
2021-03-28 de Die Flut kommt - todsicher
Die Flut kommt - todsicher
Wie die deutschen Küsten gegen die steigenden Fluten aufgerüstet werden
Hochwasserschutz in der Großstadt
Meeresspiegel - Wie wird er gemessen und was lässt ihn künftig wie stark steigen?
Sperrwerke und Mega-Dämme.
↑ 2021-05-09
-
2021-05-09de
 Fluss-Hochwässer haben in den letzten 50 Jahren global abgenommen
(K35)
Fluss-Hochwässer haben in den letzten 50 Jahren global abgenommen
(K35)
▶Klimaschau Wird demnächst gelöscht, da die Kalte Sonne nicht mehr publiziert wird!
-
Geophisical Research Letter / Slater et al. 2021
Global Changes in 20-Year, 50-Year, and 100-Year River Floods -
University of Oxford
Major floods increased in temperate climates but decreased elsewhere: Oxford study -
NoTricksZone / Kenneth Richard
New Study: 100-Year Flood Events Are Globally Decreasing In Frequency And Probability Since 1970
↑ 2019-10-27
-
BR Doku
2019-10-26 de Unwetter und Überschwemmungen: Der Wetter-Wahnsinn - stürmisch und teuer
Unwetter und Überschwemmungen: Der Wetter-Wahnsinn - stürmisch und teuer
In dieser Dokumentation aus dem Jahr 2018
geht es um die Änderungen beim Wetter und die katastrophalen Auswirkungen auf uns und unsere Umwelt.
Der ARD-Wetterexperte Sven Plöger verdeutlicht, welche Rolle bei den zunehmenden Unwettern der Klimawandel spielt und Versicherungsexperten erklären, welche Folgen das für Hausbesitzer hat.
↑ Flut: Grafiken/Bilder
Mit folgendem Link wird von anderen Webseiten auf diese Seite verwiesen.
▶↑ 2021-08-08
▶Tagesschau.de: "Hier ist Ingenieurskunst gefragt"
↑ 2021-08-05
▶Flutkatastrophe: Déjà-vu der Katastrophe

|

|
![]()
![]() Rekonstruierte Abflussmengen
Rekonstruierte Abflussmengen
Spitzenabflüsse des Hochwassers vom 14. Juli 2021
Schuld 500 bis 600 m3/sec
Dernau 1.000 bis 1.200 m3/sec
Walporzheim 1.200 bis 1.300 m3/sec
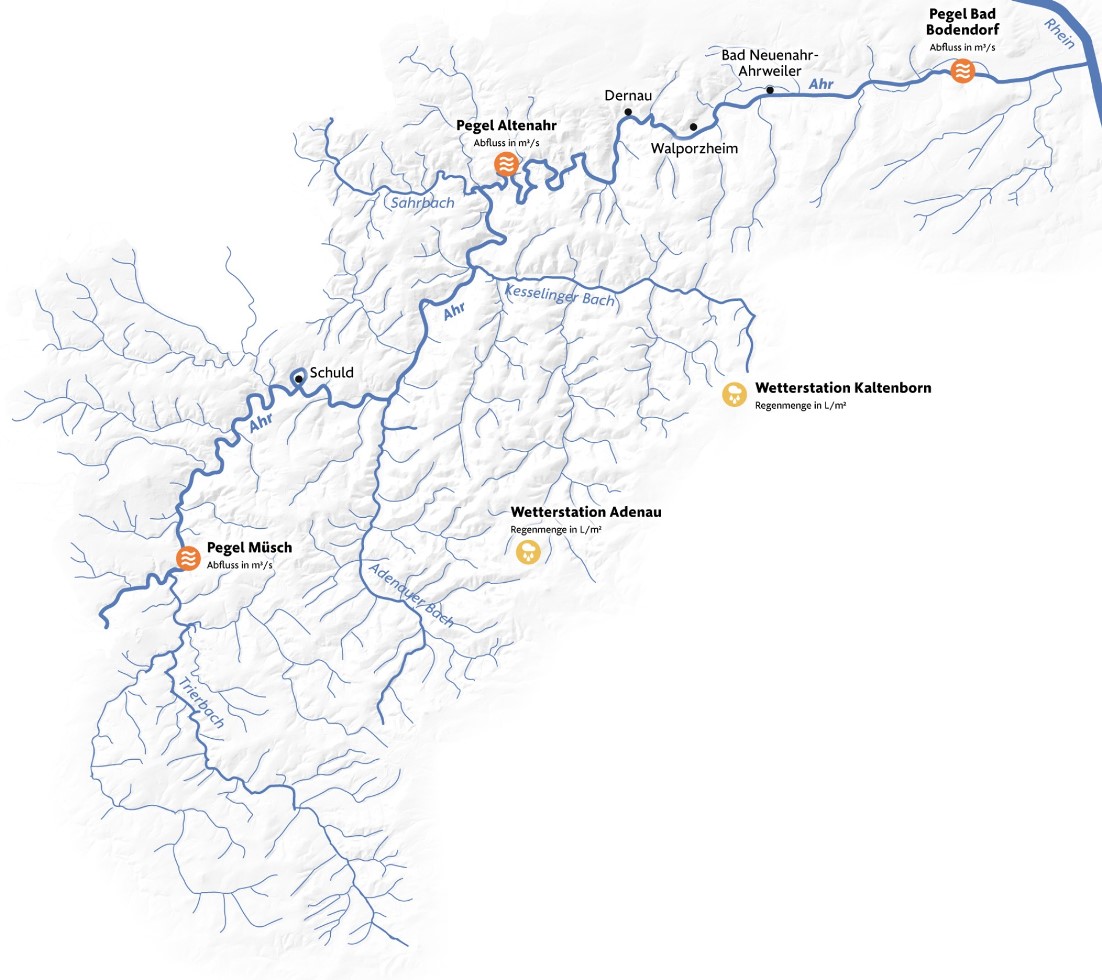
↑ 2021-07-22
▶Ist der Klimawandel schuld an der Flutkatastrophe?
↑ 2021-07-20
▶Der Klimawandel als Ausrede für das Versagen beim Katastrophenschutz
![]()
![]() Riesige Zerstörungen im Landkreis Rhein-Erft.
Riesige Zerstörungen im Landkreis Rhein-Erft.

↑ 2021-07-30
▶Bund plant Hunderte Millionen an Soforthilfe
![]()
![]() Nach Unwettern: Bund plant Hunderte Millionen an Soforthilfe
Nach Unwettern: Bund plant Hunderte Millionen an Soforthilfe

↑ 2021-08-07
▶Flutkatastrophe: Totalversagen der Klimawandel-Propheten
![]()
![]() Am 14.7. um 17.00 Uhr herausgegebene Karte
mit Warnungen vor extremer Überflutungsgefahr
Am 14.7. um 17.00 Uhr herausgegebene Karte
mit Warnungen vor extremer Überflutungsgefahr

↑ 2021-07-27
↑ 2021-08-06
▶Die verheerende Flut in Ahrweiler - eine Video-Rekonstruktion des Hochwassers
![]()
![]() Pegel Altenahr 1804 und 1911 nicht berücksichtigt
Pegel Altenahr 1804 und 1911 nicht berücksichtigt
grau: Maximaler Abflusss,
orange: Abfluss Mittelwert,
blau: Minimale Abfluss

↑ 2021-07-18
-
EIKE Europäisches Institut für Klima und Energie
Dr. Sebastian Lüning
2021-07-18 de FALSCHE PROPHETEN Faktencheck: Was das Hochwasser wirklich mit "Klima" zu tun hatIn mittelalterlichen Zeiten hätte der Priester erklärt, es wäre eine Strafe Gottes gewesen, für das frevelhafte Verhalten der Sünder.
Die heutige Erklärung ist leider nicht weit davon entfernt.
↑ 2021-07-16
![]()
![]() Each Country's Share of CO₂ Emissions
Each Country's Share of CO₂ Emissions
Published Jul 16, 2008 Updated Aug 12, 2020

⇧ de Flüsse en River fr Rivières
↑ Rhein
|
|
-
Arte
2021-08-26 de Der Flussbaumeister: Wie Tulla den Rhein begradigte
Der Flussbaumeister: Wie Tulla den Rhein begradigte
(Verfügbar: vom 26/08/2021 bis 23/11/2021 │ Dauer: 90 Min.)
Kein anderer Fluss in Europa wurde so stark vom Menschen gestaltet wie der Rhein.
Die Idee dafür lieferte der Ingenieur Johann Gottfried Tulla inmitten der Napoleonischen Kriege.
Seine Rheinbegradigung brachte sicheres Ackerland und eine klare Grenze zwischen Frankreich und Baden.
Das Dokudrama lässt die Zuschauer an Werk und Leben Tullas teilhaben.
Kein anderer Fluss in Europa wurde so stark vom Menschen gestaltet wie der Rhein.
Die Vision dafür lieferte der badische Ingenieur Johann Gottfried Tulla im 19. Jahrhundert.
Durch die Trockenlegung der Rheinauen sorgte er für die Verdrängung der Malaria, für neues Ackerland sowie sichere Grenzen zwischen Deutschland und Frankreich.
Das Doku-Drama "Der Flussbaumeister - Wie Tulla den Rhein begradigte" lässt die Zuschauer an Werk und Leben Tullas teilhaben.
Die Rheinbegradigung war das größte Bauprojekt Europas.
Viele hielten Tullas Pläne für Wahnsinn oder reine Geldverschwendung.
Gefördert von seinem Landesherrn, konnte Tulla von den Besten seiner Zeit lernen:
Bergbau in Sachsen, Wasserbau in Holland, Vermessung in Frankreich.
Aus Frankreich brachte Johann Gottfried Tulla das Metermaß nach Deutschland.
Er war einer der ersten Auslandsstudenten an der Ecole Polytechnique in Paris, zusammen mit dem Naturforscher Alexander von Humboldt und dem italienischen Physiker Alessandro Volta.
Dank Tulla konnten Dampfschiffe von Rotterdam bis Basel fahren.
Neue Häfen entstanden zu beiden Seiten des Rheins und Städte wie Ludwigshafen.
Seinen Erfolg erlebte Tulla nicht.
Der Pionier starb noch während der Bauarbeiten 1828 in Paris.
Das Doku-Drama über Tulla wurde im Juli 2019 am Oberrhein, in Rastatt und im Ecomusée d'Alsace gedreht.
Die Hauptrolle spielt Steffen Schroeder, bekannt als Kommissar der ZDF-Reihe "SOKO Leipzig".
Der Film über Johann Gottfried Tulla geht weit über eine Biografie hinaus und thematisiert auch die ökologischen Schäden, die durch Tullas Rheinausbau verursacht wurden.
-
WDR Planet Wissen
2020-05-25 de Wie der Rhein begradigt wurdeAb Basel ist der Rhein ein beeindruckender Strom.
In früheren Zeiten wand er sich hier in gewaltigen Mäandern durch eine weite Auenlandschaft, trat gerne mal über die Ufer und war ziemlich unberechenbar.
Doch dann kam Johann Gottfried Tulla.
-
Regierungspräsidium Freiburg
2015-01-28 de Der Hochwasserrückhalteraum Weil-Breisach - Neuland für den Oberrhein
Der Hochwasserrückhalteraum Weil-Breisach - Neuland für den Oberrhein
-
Regierungspräsidium Freiburg
2011-03-01 de Integriertes Rheinprogramm
Integriertes Rheinprogramm
Integriertes Rheinprogramm - Hochwasserschutz und lebendige Auen
-
WDR / Planet Wissen
2021-02-04 de Der Rhein im Wandel
Der Rhein im Wandel
Vom Naturparadies zur größten Kloake Europas.
Vater Rhein hat sich im Laufe seiner Geschichte stark verwandelt.
Vor allem seine Begradigung machte den Rhein zur größten Wasserstraße Europas und zur Abflussrinne für die Industrie.
-
SWR Geschichte und Entdeckungen
2020-03-21 de Der unsichtbare Fluss unterhalb des Rheins
Der unsichtbare Fluss unterhalb des Rheins
Im Oberrheintal liegt das größte Grundwasserreservoir Europas.
Wie ein unsichtbarer Fluss bewegt es sich unterhalb des Rheins nordwärts.
Es speist Feuchtgebiete von einzigartiger Schönheit, voller seltener Tiere und Pflanzen.
-
SWR Geschichte und Entdeckungen
2020-03-26 de Vater Rhein
Vater Rhein
Von allen Flüssen, die durch Deutschland fließen, ist der Rhein mit seinen mächtigen, manchmal auch stürmischen Fluten am stärksten mit dem Land verbunden.
Auf ihn gründeten die Romantiker im 19. Jahrhundert die deutsche Nation und machten den Fluss gar zu einem Mythos.
-
SRF / Einstein
2016-09-16 de Der Rhein - wie gefährdet ist das Ökosystem?
Der Rhein - wie gefährdet ist das Ökosystem?
Der Rhein ist einer der bedeutendsten Flüsse Europas. Um den Rhein zu nutzen, wurde der wilde Strom gebändigt. Heute dient er als Trinkwasserquelle, Energielieferant und Schifffahrtsroute. So konnten entlang seiner Ufer Autobahnen, Kraftwerke und Industrieanlagen entstehen.
-
SRF / Einstein
2016-09-16 de Der Rhein von oben
Der Rhein von oben
Für die Sendung «Der Rhein - Wie gefährdet ist das Ökosystem?» hat «Einstein»-Moderator Tobias Müller diese bedeutende Wasserstrasse per Kanu befahren - vom Alpenrhein bis nach Basel.
-
SWR Geschichte & Entdeckungen
2019-05-13 de Unser Rhein - Im Bann des Stroms
Unser Rhein - Im Bann des Stroms
Wie kommt man dem Rhein am nächsten?
Prof. Andreas Fath schwimmt vom Tomasee bis Nonnenwerth und führt zu wichtigen Schauplätzen der Geschichte und Gegenwart.
↑ Ahr
|
|
|
|
|
▶Flutkatastrophe: Déjà-vu der Katastrophe

|

|
![]()
![]() Rekonstruierte Abflussmengen
Rekonstruierte Abflussmengen
Spitzenabflüsse des Hochwassers vom 14. Juli 2021
Schuld 500 bis 600 m3/sec
Dernau 1.000 bis 1.200 m3/sec
Walporzheim 1.200 bis 1.300 m3/sec
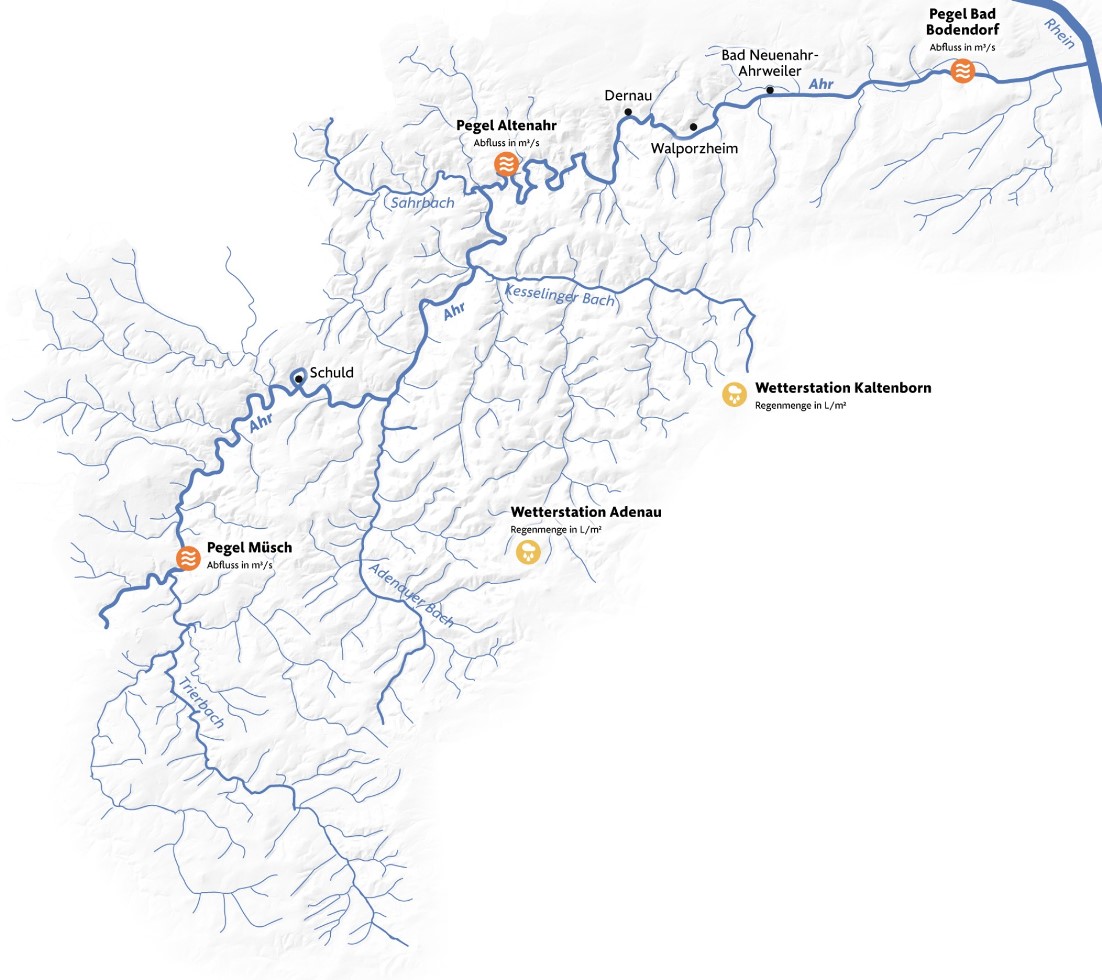
-
Ahrtal-Monografie erstmals komplett online
2003-10-01 de Das Naturschutzgebiet "Ahrschleife bei Altenahr"
- Teil II: Fauna, Flora, Geologie und Landespflegeaspekte- Anhang
Teil 2 der umfangreichen Dokumentation aus dem Jahre 2003 beleuchtet die historischen Aspekte der Landschaftsentwicklung, informiert umfangreich über die Vegetation des Naturschutzgebietes und stellt die Fauna der Region anhand verschiedener standorttypischer Arten dar.
-
Kreis Ahrweiler.de / Dr. Karl August Seel
de Die Ahr und ihre Hochwässer in alten QuellenDie Ahr ist der nördlichste Nebenfluß des Rheines im Rheinischen Schiefergebirge.
Mit einer Länge von 90 km und einem Einzugsgebiet von 900 km2 hat sie, verglichen mit den anderen Nebenflüssen, die dem Rhein aus den Mittelgebirgen zufließen, ein verhältnismäßig kleines Fluß-System.
Dieses ist jedoch sehr verzweigt und tief in den Gebirgskörper eingeschnitten.
Das ist vor allem durch die relativ großen Höhendifferenzen und geringen Fließlängen zwischen den Quellen und Mündungen des Hauptflusses und seiner Nebenbäche bedingt.
-
Kreis Ahrweiler.de / DR. HANS FRICK
de DAS Hochwasser VON 1804 IM KREISE AHRWEILERMan schrieb damals nach der im Rheinland geltenden Zeitrechnung den 2. Thermidor (= Hitzemonat) des Jahres 12 der französischen Republik.
Schon am Tage vorher waren im Niederschlagsgebiet der Ahr mehrere Gewitter niedergegangen, so daß der Gebirgsfluß vermutlich schon mehr Wasser als gewöhnlich zu Tal führte.
An dem Unglückstag selbst, einem Samstag, tobten die Elemente über der ganzen Eifel.
Infolgedessen hatten Nette und Brohl Hochwasser, und der Üßbach beschädigte nach einem Bericht, den der Präfekt des Rhein-Moseldepartements, Chaban, am 29. Aug. 1805 nach Paris gab, die Baulichkeiten des Bades Bertrich, für die der letzte Kurfürst von Trier, Clemens Wenzeslaus, über 200 000 Francs ausgegeben hatte, derart schwer, daß sie eingestürzt wären, wenn er nicht so schnell die dringendsten Reparaturen veranlaßt hätte.
Die Quellen dieser drei Flüßchen liegen mit denen einiger Ahrzuflüsse, insbesondere des Trierbachs, des Adenauer Bachs und des Kesselinger Bachs, alle auf einem verhältnismäßig kleinen Stück Hocheifel zusammen.
Doch nirgends war das Unheil so groß wie im Ahrtal,
das außer dem eigenen Wasser noch das jener rechtsseitigen Zuflüsse aufzunehmen hatte.
An der oberen Ahr - in der Gegend von Müsch und Antweiler - begann das Gewitter gegen 3 Uhr, unterhalb von Kreuzberg bis zum Rhein zwischen 4 und 5 Uhr.
Infolge von überaus starken Wolkenbrüchen goß der Regen unaufhörlich nieder, und das ganze Gebiet war mehrere Stunden "in Feuer und Wasser verwandelt".
In weniger als vier Stunden trat eine allgemeine Überschwemmung ein.
Die mit einem solchen Naturereignis vertrauten Ahrtalbewohner hatten inzwischen die gewöhnlichen Vorkehrungen getroffen.
Aber dieses Mal war jede Vorsorge unnütz.
Dem Flußlauf entlang erreichte die Flut zwischen 6 und 10 Uhr eine Höhe, wie sie bis dahin wahrscheinlich noch nicht erlebt wurde.
Im Rhein.
Antiquarius wird sie durch die Angabe charakterisiert, daß die Ahr zur Zeit des höchsten Wasserstandes über der Steinbrücke bei Rech eine Höhe von 8 Fuß, d. h. nach heutigem Maß von etwa 2,50 m, erreicht habe.
Diese Angabe deckt sich in etwa mit der Aussage der Dorseler Gedenkplatte, daß der wilde Strom in einer Höhe von acht, zehn, ja sogar bis zwanzig Schuh (über dem normalen Wasserstand) hier Steinhaufen, dort stinkenden Kot hinterlassen habe.
Vielleicht ist der Wasserstand der Ahr bei der großen Flut vom 13. Juni 1910 an einigen besonders engen Stellen des Tals noch höher gewesen.
Doch waren die Schrecken, die die Ahrbevölkerung 1804 erlebte, weit größer, da die Möglichkeit einer telefonischen Warnung der flußabwärts gelegenen Ortschaften noch nicht bestand und die Brücken, Wohnhäuser, Stallungen usw. viel weniger widerstandsfähig gebaut waren als heute.
↑ Linth
|
|
Hans Konrad Escher sollte nicht mit dem um 50 Jahre jüngeren Alfred Escher verwechselt werden. Alfred Escher, dessen Statue vor dem Zürcher Hauptbahnhof steht, hat nicht die Linth korrigiert, sondern den Gotthardtunnel gebaut. Die beiden Eschers sind allerdings miteinander verwandt. Sie stammen beide aus dem Zürcher Patriziergeschlecht Escher vom Glas. |
|
-
Schweizer Ingenieur und Architekt / ETH Periodica, Daniel Vischer
2021-09-10 de Johann Gottfried Tulla - Badischer Experte für Schweizer FlusskorrektionenDer grossherzoglich badische Beamte und Flussbauexperte Johann Gottfried Tulla (1770-1828) ist vor allem durch zwei Taten berühmt geworden: eine technisch-organisatorische und eine bildungspolitische.
Die erste betraf die Projektierung und Instradierung der Korrektion des Oberrheins von Basel bis Worms.
Die zweite bestand in der Mitbegründung der Polytechnischen Schule in Karlsruhe, der heutigen Universität
Die Linthkorrektion von Mollis zum Zürichsee
Die der Leitung von Hans Conrad Escher (1767-1823) anvertraute Linthkorrektion war in der Schweiz die erste, nach modernen Gesichtspunkten geplante flussbauliche Arbeit.
Bei ihrer Inangriffnahme 1807 ergab sich aber eine Schwierigkeit, die der Zeitgenosse und spätere Ingenieur-Offizier, Heinrich Pestalozzi von Zürich (1796-1857), wie folgt beschrieb [2]:
Als zu der Ausf¨hrung des Werks geschritten werden sollte, zeigte sich ein fühlbarer Mangel an technischen Kräften und Hilfsmitteln.
Der Flussbau stand zu jener Zeit in der Schweiz auf einer niedrigen Stufe;
Hydrotechniker waren überall nicht vorhanden; es fehlte an geübten Bauaufsehern, und die gewöhnlichen Arbeiter waren mit vielen, bei der Linth vorkommenden Arbeiten, wie Faschinenbau und dergleichen, nicht bekannt.
Escher selbst hatte wohl durch seine naturwissenschaftlichen Studien manche in das Gebiet des Wasserbaus einschlagende Kenntnisse erworben, aber die Theorie und Praxis der Hydrotechnik waren ihm völlig fremd, und noch niemals hatte er Bauten irgendwelcher Art geleitet.»
Nun war sich Escher dieser Schwierigkeit voll bewusst, so dass er den Beizug einiger kompetenter Experten veranlasste.
Für den hydrotechnischen Teil berief die Tagsatzung», wie Pestalozzi weiter berichtet, «den grossherzoglich badischen Rheinwuhr-Inspektor und Ingenieur-Major Johann Gottfried Tulla.
Es war dies eine überaus glückliche Wahl.
Tulla, in guter Schule gebildet, besass nicht bloss alle erforderlichen wissenschaftlichen Kenntnisse, sondern hatte bei den Wuhrbauten am Rhein, namentlich aber an den geschiebeführenden Bergströmen des Schwarzwalds Erfahrungen gesammelt, die ihn für die Lösung der wichtigen Aufgabe an der Linth ganz vorzüglich befähigten.
Tulla kam im September 1807 begleitet von einem Gehilfen, Ingenieur Christian Obrecht, an die Linth und unternahm sofort zahlreiche Profilmessungen für die Bestimmung der bei verschiedenen Wasserständen abfliessenden Wassermengen der Linth, bestimmte und begründete auf denselben die Querprofile der Kanäle und bearbeitete hernach die Kanalprofile nach ihrer Längenrichtung, ihrem Gefälle und der ihnen zu gebenden Konstruktion»'.
Tulla griff also das vom Berner Andreas Lanz (1740-1803) in den Jahren 1783/84 erstellte Vorprojekt der Linthkorrektion aufund verfeinerte es bis zur Baureife.
Das entsprechende Bauprojekt legte er schon nach knapp drei Monaten vor, dann riefen ihn die Amtsgeschäfte wieder nach Baden.
Die Ausarbeitung der Einzelheiten besorgte sein Gehilfe Obrecht, der 1807 und 1808 für je fünf Monate auf der Baustelle blieb.
Tulla erschien nur noch einmal vor Ort, nämlich für einige Wochen 1808.
Fuldas Handwerkliche hatten Tulla und Obrecht, übrigens «zwei geübte Faschinenleger aus dem Badischen" mitgebracht, «unter deren Anleitung die Arbeiter der Gegend im Faschinenbau Unterricht erhielten» [2].
Erstaunlich ist, wie Escher das kurze Zusammensein mit Tulla und Obrecht benutzte, um sich im Wasserbau einzuarbeiten und so eine kompetente Bauleitung des Linthwerks zu gewährleisten.
Die flussbaulichen Hauptarbeiten dauerten von 1807 bis 1816 [3].
Nachher folgten noch ausgedehnte Anpassungen der Seitenbäche sowie Meliorationsarbeiten.
1812 verdankte die Tagsatzung den Einsatz von Tulla und Obrecht aufs freundlichste.
Der entsprechende Protokollauszug wurde mit einem Brief des Landammanns der Schweiz und prächtigem Siegel nach Karlsruhe geschickt.
-
Tschanz
2021-02-19 de LINTHFLUT / Bunkerbau im WW2
LINTHFLUT / Bunkerbau im WW2
Im Zweiten Weltkrieg wurde die Linthebene nicht nur zu einem Vorzeigemodell der Anbauschlacht, sondern auch zu einem gewaltigen militärischen Abwehr-Mechanismus gegen die Nazis ausgebaut.
Mit Hilfe von Fachmännern von der Stiftung Schwyzer Festunsgwerke, Bauplänen aus dem Zweiten Weltkrieg, aber auch Bildmaterial aus dem Bundesarchiv holen wir ein unglaubliches Stück Schweizer Geschichte aus vergessenen Stollen.
↑ Rhone
-
SRF
2019-09-09 de Ja zu Milliardenkredit für dritte RhonekorrektionDer Nationalrat bewilligt eine Milliarde Franken zum Hochwasserschutz an der Rhone in den Kantonen Wallis und Waadt.
Der Nationalrat hat zum Auftakt der Herbstsession über eine Milliarde Franken für die zweite Etappe der 3. Rhonekorrektion
ohne Gegenstimme (181:0)
bewilligt.
Das grösste Hochwasserschutzprojekt der Schweiz hat einen Umfang von 3.6 Milliarden Franken.
Die dringlichsten Massnahmen waren in der ersten Etappe 2009-2019 angepackt worden.
Die zweite Etappe erstreckt sich über 20 Jahre von 2020-2039 und hat ein finanzielles Volumen von 1.642 Milliarden Franken.
Bauherren sind die Kantone Waadt und Wallis, der Bund steuert aber 1.022 Milliarden Franken bei.
Verhinderung von Milliardenschäden
Die 3. Rhonekorrektion erstreckt sich auf einer Länge von 162 Kilometern Flusslauf, von der Quelle bis zur Mündung in den Genfersee.
Geschützt werden über 12'400 Hektaren Land und gut 100'000 Menschen.
Laut Bundesrat werden damit potenzielle Hochwasserschäden im Umfang von geschätzten 10 Milliarden Franken verhindert.
Schwere Hochwasser vom Oktober 2000
Umweltministerin Simonetta Sommaruga erinnerte an die verheerenden Hochwasser in der Rhone-Ebene vom Oktober 2000, als nicht nur Ackerland, sondern auch elektrische und grosse Chemieanlagen auf einer Fläche von über tausend Hektaren unter Wasser standen.
Über 20 Menschen kamen ums Leben.
«Das Hochwasser hat gezeigt, dass die Dämme zum Teil in einem schlechten Zustand sind», so Sommaruga.
Die Korrektion beinhaltet einerseits die Absenkung des Flussbettes, wovon eher die urbanen Gebiete profitieren, wie die Umweltministerin erklärte.
Anderseits werde das Flussbett verbreitert, insbesondere zwischen Sitten und Martigny sowie im Chablais.
Schutz der Umwelt
Daneben handelt es sich um ein Projekt zur Verbesserung der Umweltqualität.
Unter anderem sollen im Zuge der 3. Rhonekorrektion die Wasserqualität erhalten und die Wasser- und Uferlebensräume geschützt und entwickelt werden.
↑ Thur
-
Wikipedia
de
Thur (Rhein)
en Thur (Rhine)
fr Thur (Suisse)
-
Tagblatt
2017-11-23 de Gemeinden befürworten die KorrekturDer Kanton Thurgau will der Thur zwischen Bürglen und Weinfelden wieder mehr Platz einräumen und den Flusslauf korrigieren.
Das Projekt kostet 28 Millionen Franken.
Es soll den Hochwasserschutz verbessern und das Naherholungsgebiet aufwerten.
Vor über 120 Jahren wurde die Thur in ein enges Korsett gezwängt.
Seither fliesst sie im vorgegebenen Bett auf vielen Streckenabschnitten schnurgerade durch den Kanton.
Mit der Thurkorrektur soll der Fluss wieder mehr Platz und die Gelegenheit bekommen, das Land «sich windend zu durchfliessen», wie es im Thurgauerlied so schön heisst.
Ein erster Abschnitt bei Frauenfeld wurde bereits korrigiert,
nun soll der zweite Folgen zwischen Bürglen und Weinfelden. Kostenpunkt: 28 Millionen Franken.
Primäres Ziel des Kantons ist ein besserer Hochwasserschutz für Weinfelden dank Überflutungsräumen und einer reduzierten Fliessgeschwindigkeit der Thur.
Dazu sollen durch eine Revitalisierung neue Lebensräume für die Tierwelt und ein attraktives Naherholungsgebiet geschaffen werden.
Einzelne Waldgebiete müssen neuen Auenwäldern weichen.
Dazu wird die Landwirtschaftsfläche in Flussnähe von 52 auf 42 Hektaren reduziert.
⇧ de Talsperren en Dams fr Barrages
▶Hochwasserschutz in Kalifornien
↑ Talsperren in Deutschland
Mit folgendem Link wird von anderen Webseiten auf diese Seite verwiesen.
▶Talsperren in Deutschland
|
↑ Talsperren Net
-
Talsperren Net
de Füllstände von Talsperren in DeutschlandDiese Webseite soll eine Übersicht der Talsperren in Deutschland geben.
Diese wird in Abständen erweitert und aktualisiert.
Es werden alle Talsperren und Hochwasserrückhaltebecken mit mehr als 1,00 Million m3 Stauraum aufgelistet.
↑ Wupperverband: Hochwasser Portal
-
Wupperverband
de Hochwasser PortalIm bundesweiten Vergleich gehört Nordrhein-Westfalen zu den Spitzenreitern, wenn es um die Anzahl der betriebenen Stauanlagen geht.
Vor allem die Anzahl an Talsperren ist in NRW sehr hoch.
Allein 14 Talsperren befinden sich im Gebiet des Wupperverbandes.
Unter den vom Wupperverband betriebenen Talsperren befindet sich auch die älteste Talsperre Nordrhein-Westfalens: die Eschbachtalsperre in Remscheid, die 1891 fertiggestellt wurde.
Auch die zweitgrößte Trinkwassertalsperre Deutschlands wird vom Wupperverband betrieben: die Große Dhünn-Talsperre im bergischen Land zwischen den Gemeinden Wermelskirchen, Wipperfürth, Kürten und Odenthal.
Talsperren und ihre Funktionen
Die Talsperren in NRW dienen in erster Linie
zur Absicherung der Trinkwasserversorgung
und zum Hochwasserschutz.
Neben dem Hochwasserschutz in Perioden mit viel Regen oder Schneeschmelze erfüllen die Talsperren jedoch auch in langen Trockenphasen einen wichtigen Zweck:
Über die Talsperren kann durch gezieltes Ablassen des Wassers ein Mindestwasserstand gehalten werden, der den Lebensraum von Pflanzen und Tieren sichern soll.
Zudem können Talsperren auch zur Bereitstellung von sogenanntem Brauchwasser dienen, das zur Verwendung in der Landwirtschaft oder auch Industrie aus der Talsperre entnommen wird.
Nicht zuletzt sind Talsperren und Stauseen wichtige Lebensräume für Tiere und Pflanzen sowie beliebte Naherholungsgebiete für Besucher.
Das Thema Arten- und Umweltschutz spielt daher auch im Gewässermanagement des Wupperverbandes, insbesondere in der Entwicklung der Talsperren und angrenzenden Gewässern, eine sehr wichtige Rolle.
Talsperren und Hochwasserschutz im Wupperverband
Hochwasserschutzmaßnahmen und ein gezieltes Hochwassermanagement im Einzugsgebiet der Wupper sind erforderlich, um erhebliche wirtschaftliche Schäden und Umweltschäden durch Überschwemmungen zu vermeiden und die Menschen in den besiedelten Gebieten zu schützen.
Als Bestandteil des technischen Hochwasserschutzes tragen Talsperren einen grundlegenden Teil zur Vermeidung von Hochwasserschäden bei.
Sie dienen mit ihrem hohen Fassungsvermögen der Wasserrückhaltung sowie der Wassermengenregulierung in den Flüssen durch gezieltes Ablassen.
Seit Bestehen der 14 Talsperren im Wupperverbandsgebiet konnten daher auch die Hochwasserereignisse im Einzugsgebiet der Wupper und ihrer Nebengewässer deutlich reduziert oder in ihrer Auswirkung abgemildert werden.
Insbesondere die Wupper dient als größte Brauchwassertalsperre Talsperre mit dem vorgelagerten Bever-Block dem Hochwasserschutz im Verbandsgebiet.
↑ 2021-08-24
-
Oberbergischer Anzeiger
2021-08-24 de Anzeige gegen Wupperverband: Hätte früher Platz in Talsperren geschaffen werden können?Wären die Überschwemmungen in der Hansestadt, als Wupper, Hönnige und Gaulbach zahlreiche Wohnungen, Firmengebäude und Keller unter Wasser setzten, vermeidbar gewesen?
Hätte der Wupperverband früher reagieren und mehr Platz in den Talsperren schaffen können?
Fragen, die sich viele Menschen stellen,
und die bald auch die Gerichte beschäftigen dürfte. Ein Wuppertaler Anwalt vertritt nach eigenen Angaben mehr als 100 Hochwassergeschädigte, er hat Strafanzeige gegen den Wupperverband eingereicht - wegen "Herbeiführung einer Überflutung".
Eine Frage ist, ob der Wasserverband möglicherweise wegen "Amtshaftung" in Regress genommen werden kann.
↑ 2021-08-08
-
Klimareporter
2021-08-08 de Wenn eine volle Talsperre wichtiger ist als FlutschutzDie Flut im Tal der Wupper wurde durch das Versagen des Talsperren-Managements zur Katastrophe.
Aus dem Flutereignis von 2002 in Sachsen hatte in Westdeutschland niemand lernen wollen.
Ob sich das nun ändert, dafür gibt es ein klares Kriterium.
Jahrhundertelang ist das Wasser der Wupper in Elberfeld und Barmen, dem heutigen Wuppertal, immer wieder über die Ufer getreten.
Als die Doppelstadt in der ersten Phase der Frühindustrialisierung zur völlig überbevölkerten Weltstadt wurde, entstanden Favela-artige Siedlungen nahe am Flusslauf, die regelmäßig überflutet wurden.
↑ 2021-07-23
↑ Volle Talsperren vor Unwetter: Ministerium will Konsequenzen ziehen
-
WDR
2021-07-23 de Volle Talsperren vor Unwetter: Ministerium will Konsequenzen ziehenWeil sie zum Teil schon vorher fast komplett voll waren, konnten die Talsperren in NRW die Regenmassen beim Unwetter nicht auffangen.
Das Umweltministerium kündigt Konsequenzen an.
![]()
![]() Füllstände der Talsperren des Wupperverbandes am 11.07.2021
Füllstände der Talsperren des Wupperverbandes am 11.07.2021

Hochwasser statt Dürre
Zudem verweist Lieberoth-Leden darauf, dass die Talsperren in den Jahren 2018 bis 2020 aufgrund der Trockenheit "extrem niedrig gefüllt waren".
Dieses Jahr habe es stattdessen eine "Aufstauphase" gegeben, weshalb die Talsperren als "ausreichend gefüllt" angesehen worden seien, um mit einem trockenen Sommer klarzukommen.
Dass es nun stattdessen zu einem schweren Hochwasser gekommen ist, sei "völlig außergewöhnlich".
Auch der Wupperverband verteidigt sich.
Im Sommerhalbjahr sei in den Talsperren mit Brauchwasser kein Hochwasserschutzraum vorgesehen, heißt es in einer Erklärung.
Stattdessen solle wegen der zunehmenden Dürresommer möglichst viel Wasser vorgehalten werden.
Und: "Um die Wupper-Talsperre ab Vorliegen einer konkreten Vorhersage für das Wuppergebiet um mehr als die Hälfte zu entleeren, reichte die Zeit nicht aus."
Ein zu schnelles Ablassen des Wassers hätte zu einer Flutwelle noch vor dem eigentlichen Hochwasser geführt.
↑ 2021-07-23
↑ Nach dem Hochwasser: Schwere Vorwürfe gegen den Wupperverband
-
WDR
2021-07-23 de Nach dem Hochwasser: Schwere Vorwürfe gegen den WupperverbandDie Flut entlang der Wupper hätte weniger dramatisch sein können, wenn die Talsperre besser reguliert gewesen wäre.
Das sagen Anwohner, die nun gegen den Wupperverband klagen.
Zu dem Horror völlig überfluteter Orte kam vergangene Woche zeitweise noch ein weiteres Schreckgespenst:
Einige große Talsperren, die voll gelaufen waren, drohten zu brechen.
Ein schnelles Ablassen des Wassers aber schien ebenso gefährlich, da es zu weiteren Überflutungen hätte führen können.
Auch an den Orten entlang der Wupper herrschte tagelang Zitterpartie:
Die Wuppertalsperre war durch den Regen übervoll, der Druck auf die Talsperrenmauer enorm.
Der Wupperverband entschied schließlich, das Wasser aus dem Stausee schrittweise abzulassen.
Im Unterlauf der Wupper strömte dadurch noch mehr Wasser durch die Orte.
Auch der See im idyllischen Stadtteil Beyenburg schwoll an und überflutete den historischen Ortskern.
Landtagsabgeordneter fordert personalle Konsequenzen
Andreas Bialas, SPD-Landtagsabgeordneter und Bezirksbürgermeister des Örtchens Langerfeld-Beyenburg, erhebt nun schwere Vorwürfe gegen den Betreiber der Wuppertalsperre.
Die Talsperre sei schon vor dem Unwetter viel zu voll gewesen.
"Wie soll sie im Notfall denn noch weiteres Wasser aufnehmen?"
Bialas fordert, dass jetzt eine Staatsanwaltschaft ermitteln müsse, welche Informationen es gegeben habe und wer wann welche Entscheidungen getroffen habe - sowohl zur maximalen Befüllung der Talsperre als auch in den Tagen ab Montag, als sie begann, überzulaufen.
Er forderte personelle Konsequenzen beim Wupperverband.
Im Sommer möglichst viel Wasser stauen
Im Sommerhalbjahr sei außerdem in den Brauchwassertalsperren kein Hochwasserschutzraum vorgesehen.
Im Gegenteil offenbar:
Wegen der zunehmenden Dürresommer soll möglichst viel Wasser vorgehalten werden.
Fakt ist wohl, dass es vergangene Woche innerhalb von 24 Stunden so viel regnete, wie sonst in gut einem Monat.
Dadurch seien den Talsperren so hohe Mengen an Wasser zugeflossen, wie noch nie zuvor.
↑ 2021-07-19
-
Akademie Raddy
2021-07-19 de Flutkatastrophe 2021: Die wahren Gründe für die Flut
Flutkatastrophe 2021: Die wahren Gründe für die Flut
Nachtrag:
Aufgrund der Kritik hat der Wupperverband jetzt gesagt, warum er die Talsperren voll befüllt hat und der Hochwasserschutz daher nicht funktionieren konnte:
"Wir hatten Angst vor Dürren durch Klimawandel, und daher haben wir alle Talsperren gefüllt."
Musste Wuppertal in den Fluten versinken, weil man sich im Klimawahn befindet?
Oder ist dies eine Ausrede, damit Tourismus und Ökostrom funktionieren?
Die Schweiz hat übrigens eine Richtlinie für Talsperren: Talsperren dürfen höchstens zu 80% befüllt sein.
Lokalnachrichten aus Remscheid
Ein Lokalsender aus dem Überschwemmungsgebiet Remscheid führte kurz vor dem Hochwasser ein Interview mit einem GRÜNEN Politiker (Sportdezernent Thomas Neuhaus) und einem Mitarbeiter von "Arbeit Remscheid" am Rande der Wupper-Talsperre.
Dort freut man sich, dass der Wasserstand der Wuppertalsperre extrem hoch ist, was toll für das Tourismusprojekt ist.
Dummerweise scheinen die beiden Jungs nicht zu begreifen, dass eine volle Talsperre keinen Schutz gegen Hochwasser mehr bietet.
↑ 2021-07-19
-
Tichys Einblick
2021-07-19 de TALSPERRE GEÖFFNET ODER NICHT? Flutwelle in Stolberg: Ein Konditor hat alles verloren und klagt an
In Stolberg hat die Flutwelle die Innenstadt verheert.
Ein Konditor, dessen Café zerstört ist, sagt:
Die Betreiber der örtlichen Talsperre haben den größten Schaden zu verantworten, weil sie eine Staumauer zur Unzeit geöffnet hätten.
Die weisen den Vorwurf von sich. Zweifel bleiben.
↑ 2021-07-19
-
ZETTELS KLEINES ZIMMER
2021-07-19 de Keine Krise ungenutzt lassen. Geschichten von der Flut.
Die Talsperren sind nicht abgelassen worden, damit sie als Rückhaltebecken dienen konnten - was eigentlich ihr Zweck ist.
↑ 2021-07-19
-
Klimareporter
2021-07-19 de Das Versagen beim HochwasserschutzNach dem Elbe-Hochwasser 2002 reagierte die rot-grüne Bundesregierung mit einem wirksamen Gesetz zum Hochwasserschutz.
Nicht nur die damalige Opposition aus Union und FDP lehnte die Vorschläge ab, sondern auch die Mehrheit der Bundesländer.
Dieses politische Versagen darf sich nicht wiederholen.
↑ 2021-07-17
-
NWR Paddlier
2021-07-17 de Wuppertalsperre läuft über:
Maximale Stauhöhe um Mitternacht überschritten:
14. Juli 2021 23:00
Wuppertalsperre läuft über:
Maximale Stauhöhe um Mitternacht überschritten:
14. Juli 2021 23:00
Durch anhaltenden Starkregen erreichte der Stauinhalt der Wuppertalsperre am 14. Juli 2021 um 23:00 das Vollstauziel.
Weshalb der Hochwasserschutzraum binnen kurzer Zeit aufgebraucht war und das Wasser ungehindert über den Überlauf ins Tal stürzte, wo die ersten Wupperorte rasch vom Wasser erreicht wurden.
Zwischen 23:00 und 6:00 strömten jedoch noch über eine Million Kubikmeter Wasser in das Staubecken.
↑ 2021-07-16
Video über den Überlauf der Rursee Talsperre am 16.07.2021.
Auch eines von zwei Rohren des Grundablasses wurde geöffnet.
↑ 2021-07-15
-
hessenschau
2021-07-15 de Talsperre läuft unkontrolliert über
Talsperre läuft unkontrolliert über
Hessenschau vom 15.07.2021
Diemelsee läuft über
↑ 2021-07-14 07:39 h
-
Westdeutsche Zeitung
2021-07-14 07:39 h de Warnung vor extremen Dauerregen für Wuppertal - Überflutungen möglich
Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt für Mittwochmorgen 7.14 Uhr bis voraussichtlich Donnerstag 6 Uhr vor ergiebigem Dauerregen (Warnstufe 4 von 4).
Die amtliche Warnung hat der Dienst am Mittwochmorgen (14. Juli 2021) ausgegeben.
Auf der A 46 Höhe des Sonnborner Kreuzes ist es am Mittwochmorgen zu Problemen gekommen:
Die Fahrbahn wurde wegen des Dauerregens überschwemmt.
Auch die Stadtwerke Wuppertal (WSW) teilten aufgrund der Wetterlage mit, dass die Gefahr von Überschwemmungen steigt - und die WSW erklärten, was es nun zu beachten gilt.
Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes strömt am Rande eines sich über Frankreich etablierenden Tiefdruckgebiets warme bis sehr warme Luft aus dem Mittelmeerraum heran.
Im Warnzeitraum zieht teilweise extremer Dauerregen über die Stadt.
Die Regenmengen können zwischen 70 und 120 Liter pro Quadratmeter innerhalb weniger Stunden erreichen.
Akkumuliert sind bis Donnerstagfrüh strichweise deutlich höhere Regenmengen zwischen 100 und 150 Liter pro Quadratmeter möglich.
↑ 2021-07-14 21:30 h
-
Twitter
2021-07-14 21:30 h de Die Wuppertalsperre ist mehr als randvoll...
![]()
![]() Wuppertalsperre am 14.07.2021 um 21:30 Uhr
Wuppertalsperre am 14.07.2021 um 21:30 Uhr
"Zufluss": 111,14 m3/s
(= 100 % rechts oben)
"Abfluss": 145,65 m3/s
(= 131,1 % links unten)

↑ 2021-07-14 22:55 h
-
Westdeutsche Zeitung
2021-07-14 22:55 h de Stadt Wuppertal warnt vor Überschwemmungen in der Nacht
Zwar hat der Regen gegen 22 Uhr in Wuppertal nachgelassen, doch die Gefahr von Überflütungen ist weiterhin groß.
Die Stadt warnt vor weiteren Wupper-Übertritten im gesamten Gebiet der Talachse.
Grund dafür sind die massiven Zuläufe in die Wuppertalsperre, die zu einem Überlauf der Talsperre führen könnten.
Die Wassermengen, die dadurch zusätzlich zum kontrollierten Ablauf in die Wupper kommen können, sind nicht absehbar.
Der Überlauf könnte binnen der nächsten Stunde passieren, so die Stadt (Stand 14. Juli 2021 um 22.30 Uhr).
Der Scheitelpunkt des Hochwassers wird gegen 1 Uhr erwartet.
Der Wupperverband sei dabei, an der Wuppertalsperre "die Kontrolle zu verlieren", so Informationen der WZ.
Die Stadt sperrt derzeit alle Unterführungen auf der Talsohle.
Die Unterführungen dürfen bis auf Weiteres nicht mehr genutzt werden.
Das gilt auch für die Unterführung B 7/ Döppersberg für den Fall, dass die Wuppertalsperre überläuft.
Weiterhin gilt der dringende Appell, die Bereiche der Talsohle in der Nähe der Wupper zu meiden.
Bürger sollen außerdem nicht versuchen, Hab und Gut aus Kellerräumen zu bergen oder aktuell abzupumpen.
Die Stadt sagt: "Die Gefahr ist noch nicht vorbei!"
Alle sensiblen Einrichtungen, die das Hochwasser erreichen könnten, seien informiert - sie verlegen, wo nötig, ihre Bewohner vorsorglich nach oben.
Außerdem wurden Obdachlose an den bekannten Schlafplätzen aufgesucht und gewarnt.
Personen sollten sich in der Nacht nicht in der Nähe der Wupper, insbesondere nicht in Muldenlagen aufhalten, Anwohner sollten in diesen Lagen die Situation beobachten oder wenn möglich Souterrain- und Erdgeschosse verlassen und das 1. Obergeschoss aufsuchen.
Eventuell müssen Trafostationen in diesen Bereichen zeitweilig abgeschaltet werden.
↑ 2021-07-05
↑ Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen (LANUV)
↑ 2021-01-21
-
WDR
2021-01-21 de Talsperren sind wieder gut gefüllt
Talsperren sind wieder gut gefüllt
Viel Regen, viel Schnee
Das sorgt zwar nicht für gute Laune, tut aber der Natur und den
Talsperren gut.
Nach dem trockenen Sommer erholt sich die Natur langsam wieder und die Talsperren laufen wieder voll.
↑ 2019-01-03
-
Antenne Unna
2019-01-03 de Dank Regen: Talsperren wieder mehr gefüllt
Das Regenwetter der letzten Wochen hat Wirkung gezeigt.
Die für das Trinkwasser im Kreis Unna wichtigen Talsperren sind wieder mit mehr Wasser gefüllt.
↑ 2018-07-30
-
Photo Lurch
2018-07-30 de Öffnung der beiden Grundablass Rohre an der Rursee Talsperre
Öffnung der beiden Grundablass Rohre an der Rursee Talsperre
2018: 80 jähriges Jubiläum der Talsperre
Video über den Überlauf der Rursee Talsperre am 28.07.2018
anläßlich des 80jährigen Jubiläum der Talsperre.
Im Video werden der Ablass von 15.000 Liter pro Sekunde gezeigt.
Im absoluten Notfall wäre sogar eine Entleerung von bis zu 60.000 Liter pro Sekunde möglich.
↑ 2007-06-30
-
WWF
2007-06 de Fünf Jahre nach der ElbeflutWurden und werden öffentliche Finanzhilfen im Sinne eines nachhaltigen Hochwasserschutzes verwendet?
Wie aus dem Ruf nach mehr Raum für die Flüsse und Rückbau in den Flussräumen die Finanzierung von Deichbauten, Stauwehren und Straßen wurde.
Nach der Oder-Flut 1997 wurde der Ruf laut,
den Flüssen wieder mehr Raum zurückzugeben.
Hochwasserschutz sollte künftig nicht mehr in Katastrophenbewältigung bestehen, sondern in einer nachhaltigen Hochwasservorsorge.
Die Politik, bis hin zu Bundeskanzler Helmut Kohl, griff diese Forderung wortstark auf.
Begründet war die Forderung in der Feststellung, dass die Flüsse in der Vergangenheit den Großteil ihrer natürlichen Überschwemmungsflächen durch Besiedelung, Flussbegradigungen und Eindeichungen verloren hatten.
So ist diese Fläche beispielsweise an der Elbe auf kümmerliche vierzehn Prozent geschrumpft worden.
Vor allem dadurch, dass natürliche Hochwässer seither in künstlich verschmälerten und begradigten Rinnen abfließen müssen, erreichen die Fluten die aktuellen Höhen und Geschwindigkeiten.
Erst dadurch, dass direkt am Flussufer und flächenhaft hinter den Deichen in den historischen Überflutungsräumen Wohnhäuser, Gewerbe und öffentliche Infrastruktur errichtet wurden, gefährden die Fluten die Menschen und die von ihnen geschaffenen Werte.
Nach der Jahrhundertflut 2002 an der Elbe und deren Zuflüssen, stellte man fest, dass der Forderung von 1997 keine Taten gefolgt waren.
Die neuen Schäden in Milliardenhöhe, die neben mehreren Menschenleben zu beklagen waren, wurden zum Anlass genommen, nun doch endlich die Weichen hin zu einem nachhaltigeren vorbeugenden Hochwasserschutz umzulegen.
Nun sollte tatsächlich den Flüssen mehr Raum gegeben werden, was letztlich auf großzügige Rückdeichungen hinauslaufen sollte.
Zugleich sollte bereits der Entstehung von Hochwassern entgegengewirkt werden, indem insbesondere bei Starkregenereignissen der Wasserrückhalt in der Fläche erhöht werden sollte.
Dazu sollten der Boden verbessert, umfangreiche Aufforstungsprogramme in Hochwasserentstehungsgebieten (Gebirgsregionen) vorgenommen und vor allem die Neuversiegelung von Flächen gestoppt werden.
Nicht zuletzt sollten Hochwasserschutzmaßnahmen mit den ohnehin erforderlichen Maßnahmen zur ökologischen Aufwertung der Gewässer verbunden werden, die die Wasserrahmenrichtlinie der EU bis 2015 fordert.
Einige Zitate
Seite 45
Beurteilung der Nachhaltigkeit Das Vorgehen im Verfahren ist als besonders deutlicher Fall von Nichtbeachtung nachhaltiger Planungsgrundlagen einzustufen: Das Vorhaben ist hochwasserschutztechnisch nicht notwendig.
Sonstige Zwecke könnten deutlich geringerem Aufwand realisiert werden.
Weiter entsteht durch die erweiterte Wehranlage selbst ein neues, unnötiges Schadenspotential im Hochwasserfall.
Seite 46
Sachverhalt
Das als Regenrückhaltebecken in Rossau angelegte Gewässer wird ständig als Wasserskianlage genutzt.
Durch den erhöhten Wasserstand im Regenrückhaltebecken, der notwendig zum Betrieb der Wasserskianlage ist, steht nicht mehr genügend Rückhaltevermögen zur Verfügung.
Ihren eigentlichen Zweck zum Regenrückhalt kann die Anlage dadurch nicht mehr wie vorgesehen erfüllen.
Seite 46
Insgesamt ist daher festzustellen:
Öffentliche Mittel für den Hochwasserschutz wurden zweckentfremdet.
Durch den künstlichen, zentral gesammelten Anstau des Regenwassers entsteht eine zusätzliche Gefahrenquelle bei Starkregen.
Das Gefahrenpotential wird hier vermutlich durch die Nutzung und die Ausführung des Regenrückhaltebeckens künstlich geschaffen.
Seite 47
Die Funktionen der Polizeidirektion Westsachen und des Polizeireviers Grimma können im Falle eines Extremhochwasserereignisses nicht sicher aufrechterhalten werden.
Dieses Risiko sollte nicht eingegangen werden, da gerade diese Institutionen maßgeblich in die Koordinierung extremen Hochwasserereignissen und bei Katastrophenfällen eingebunden sind.
Zusätzlich stellt das neu errichtete Quergebäude zwischen den beiden Hauptgebäuden ein bedeutendes Abflusshindernis in der Muldenaue dar.
Durch die neue Gebäudeverbindung entsteht ein geschlossener Querriegel von ca. 100 m Länge.
Nach der aktuell gültigen Rechtslage (vom 1. September 2003) wäre das Projekt nach § 100 Absatz 2 Nr. 4 SächsWG nicht genehmigungsfähig.
Außerdem werden durch die Neubauten ca. 0,2 ha Flussaue im Überschwemmungsgebiet neu versiegelt.
Insgesamt entsteht auch ein erhöhtes Schadenspotential durch die Lage der wichtigen Verwaltungsgebäude in der Flussaue.
Seite 49
Durch die ungerechtfertigte Finanzierung der Baumaßnahmen werden der wirklichen Zielsetzung des Fördermittelprogramms wichtige Finanzmittel entzogen.
Diese Summen fehlen dann an anderer Stelle.
Unter den Aspekten einer zukünftigen Unterhaltungslast werden die Straßen ein erhebliches Finanzierungsproblem für die verschiedenen Träger darstellen.
Bisher konnten notwendige Gelder zum Erhalt dieser Infrastruktur gerade nicht beschafft werden.
Ausgerechnet mit Hochwassergeldern erfolgten Neuversiegelungen von Flächen, die bisher der Retention zur Verfügung standen.
Seite 86
Nachhaltigkeitsprüfung
Festzuhalten ist, dass es in Niedersachsen keine ausdrückliche Hochwasserschutzstrategie auf Landesebene gibt.
Die Zuständigkeit liegt hier bei den Gemeinden.
Damit entspricht der Hochwasserschutz in Niedersachsen im Wesentlichen schlicht einer Anwendung bestehender Gesetze bei der kommunalen Planung (Bauleitplanung) und im Bauordnungsrecht.
Naturnahe Gestaltung der Oberflächengewässer (Nachhaltigkeitsaspekt (4.)) ist in Niedersachsen ein Thema, steht aber in keinem ausdrücklichen Zusammenhang mit dem Hochwasserschutz.
↑ Hochwasserschutz in Kalifornien
Mit folgendem Link wird von anderen Webseiten auf diese Seite verwiesen.
▶Hochwasserschutz in Kalifornien↑ 2021-09-02
-
Sacramento District
2021-09-02 en How the Flood Risk Management System Works
How the Flood Risk Management System Works
Did you know?
Despite its complexity, the flood risk management system in Northern California consists of only a few major components - primarily dams, levees, weirs, and bypasses.
See how they work together to move water away from people and property in this animation.
▶Hochwasserschutz in Kalifornien
↑ 2018-08-03
-
Sacramento District
2018-08-03 en San Joaquin River Flood Risk Management System
San Joaquin River Flood Risk Management System
The U.S. Army Corps of Engineers,
San Joaquin Area Flood Control Agency and State of California's Central Valley Flood Protection Board work together to reduce flood risk for the City of Stockton and surrounding area.
Learn about the complex system that helps reduce risk for over 160,000 people and one of the most productive agricultural areas in the United States.
▶Hochwasserschutz in Kalifornien
↑ 2011-07-20
-
Sacramento District
2011-07-20 en Central Valley Flood Risk
Central Valley Flood Risk
It will happen again: the ARkStorm Scenario
The ARkStorm scenario was prepared by the US Geological Survey, who gathered a team of 117 scientists and engineers - with contributions from 42 Federal, California, and local agencies and universities.
▶Hochwasserschutz in Kalifornien
↑ 2010-12-13
-
USGS Multi Hazards
2010-12-13 en This is ARkStorm
This is ARkStorm
This is a short film describing the ARkStorm Scenario
by director, Theo Alexopolous, and DesignMatters, Art Center College of Design in Pasadena.
The ARkStorm Scenario, led by the USGS and more than 100 scientists and experts from varied disciplines, details impacts of a scientifically plausible storm similar to the Great California Storm of 1861-62 in the modern day.
The scenario led to several important scientific advancements and will be used by emergency and resource managers to improve partnerships and emergency preparedness.
▶Hochwasserschutz in Kalifornien
⇧ de Regenmengen en Amounts of rain fr Quantités de pluie
▶Flutkatastrophe: Totalversagen der Klimawandel-Propheten
![]()
![]() Am 14.7. um 17.00 Uhr herausgegebene Karte
mit Warnungen vor extremer Überflutungsgefahr
Am 14.7. um 17.00 Uhr herausgegebene Karte
mit Warnungen vor extremer Überflutungsgefahr

![]()
![]() Die durchschnittliche Regenmenge in Deutschland
Die durchschnittliche Regenmenge in Deutschland
hat seit Beginn der systematischen Erfassung um rund 8 %
zugenommen.
Mittelwert: Rot, Trend: gepunktet

Doch obwohl der Blick auf die Grafik zeigt, dass dies durchaus nicht ungewöhnlich ist, haben sich zahlreiche Klimapropheten - darunter der DWD und das Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung mit seinen bunten Dürremonitor-Bildern (Bild 4) - darauf versteift, dass Deutschland wegen des Klimawandels künftig verstärkt mit Dürren zu rechnen habe.
Wie die Talsperren auf Linie gebracht wurden
Zu den üblen Folgen dieser falschen Prognosen gehört, dass deshalb eines der effizientesten Mittel zur Minderung von Flutrisiken falsch eingesetzt wurde:
Unsere Talsperren.
Diese sorgen nicht nur für die Vorratshaltung von Wasser für niederschlagsarme Zeiträume, sie können andererseits bei Unwettern auch große Regenmengen speichern und so die Flutgefahr mindern -
wenn sie denn richtig gemanagt werden,
Kleiner Beitrag zur Faktensammlung:
Hochwasserereignisse im Rheingebiet
Wikipedia Zeitreihe der Niederschlagssummen in Deutschland seit 1881
|
|
Weiterlesen: In der Tagesschau am Abend des 14.7. kein Wort von extremer Flutgefahr Ferner: Ein Warnsystem wie in einem Drittweltland Klimawarner auf höchster Drehzahl Die direkte Verantwortung der Klimapropheten Wie die Talsperren auf Linie gebracht wurden |
⇧ de Text en Text fr Texte
⇧ 2022
↑ Die Nacht, als die Flut kam - Protokoll einer Klimakatastrophe
-
Arte
2022-07-02 de Die Nacht, als die Flut kam - Protokoll einer Klimakatastrophe
Die Nacht, als die Flut kam - Protokoll einer Klimakatastrophe
⇧ 2021
↑ Extremwetterkongress: Experten warnen vor Kosten des Klimawandels
-
NDR
2021-09-24 de Extremwetterkongress: Experten warnen vor Kosten des KlimawandelsZum Abschluss des Extremwetterkongresses in Hamburg haben Expertinnen und Experten auf die Konsequenzen und Kosten des Klimawandels hingewiesen.
"Der Klimawandel verursacht durch die Zunahme extremer Wetterereignisse immer weiter steigende volkswirtschaftliche Kosten", sagte Claudia Kemfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung am Freitag in der Hansestadt.
Allein die Kosten der Flut im Ahrtal würden mit rund 30 Milliarden Euro angegeben.
Jeder in den Klimaschutz gesteckte Euro spare 15 Euro Klimaschäden ein, sagte Kemfert.
↑ Klimareport: Hamburg hat Klimaziel von 1,5 Grad schon gerissen
-
NDR
2021-09-23 de Klimareport: Hamburg hat Klimaziel von 1,5 Grad schon gerissenUmweltsenator Jens Kerstan (Grüne) hat am Donnerstag den ersten Klimareport für Hamburg vorgestellt.
Er enthält Daten vom Beginn der Wetteraufzeichnungen bis heute.
Außerdem zeigt der Klimareport den Trend für die Zukunft bis zum Ende dieses Jahrhunderts auf.
Jetzt kann man es mit Zahlen belegen
Der Klimawandel ist auch in Hamburg deutlich erkennbar.
In den letzten 140 Jahren ist die Temperatur im Jahresmittel insgesamt schon um 1,7 Grad gestiegen.
Damit hat die Hansestadt laut dem Report das Pariser Klimaziel von 1,5 Grad, gerechnet von der Industrialisierung bis heute, bereits überschritten.
Rechne: 1,7 Grad duch 140 Jahre = 0,012 Grad pro Jahr = 0,12 Grad in 10 Jahren
Zunahme: seit 1880 bis 2100 um 2,67 °C
Bemerkung: Ohne Berücksichtigun des Wärmeinsel-Effektes dieses Standortes.
Deutschlandweit sieht es ähnlich aus:
Hier liegt der Wert bei 1,6 Grad,
Rechne: 1,6 Grad duch 140 Jahre = 0,0114 Grad pro Jahr = 0,114 Grad in 10 Jahren
Zunahme: seit 1880 bis 2100 um 2,51 °C
Bemerkung: Ohne Berücksichtigung der Wärmeinsel-Effekten der vielen neuen Standorte.
weltweit nur bei 1,1 Grad.
Rechne: 1,1 Grad duch 140 Jahre = 0,008 Grad pro Jahr = 0,08 Grad in 10 Jahren
Zunahme: seit 1880 bis 2100 um 1,73 °C
Bemerkung: Auch in dieser Berechnung wurden keine Wärmeinsel-Effekte berücksichtigt.
↑ Klimaerwärmung gestoppt? Eisschmelze am Nordpol ist ausgebremst!
-
Wetternet
2021-09-22 de Klimaerwärmung gestoppt? Eisschmelze am Nordpol ist ausgebremst!
Klimaerwärmung gestoppt? Eisschmelze am Nordpol ist ausgebremst!
Überraschende Daten vom Meereis am Nordpol.
Ist die Eisschmelze ausgebremst?
Aktuelle Daten deuten darauf hin, dass wir kein neues Rekordminimum bei der Eisfläche bekommen werden.
Erholt sich das Meereis am Nordpol wieder?
↑ Flutkatastrophe Deutschland: "Flut-Bericht der Politik stimmt nicht!"
Es ist die erste große Flutbilanz der Regierung
- und offenbar sind Bund und Länder trotz Versagen und katastrophaler Pannen mit ihrer Arbeit sehr zufrieden!
Vor allem ein Satz in dem 20-seitigen Papier (liegt BILD vor) von Innen- und Finanzministerium macht sprachlos.
Auf Seite 10 heißt es:
"Das System des Bevölkerungsschutzes mit der klaren kommunalen Verantwortung und der aufwachsenden Unterstützung durch Landkreise, Länder und den Bund hat sich in dieser langanhaltenden Hochwasserlage grundsätzlich als trag- und leistungsfähig erwiesen, wird aber gleichwohl im Rahmen eines Evaluierungsprozesses betrachtet werden."
Dabei klagen die Flutopfer u. a. über nächtliche Plünderungen.
Und Kanzlerin Angela Merkel (67, CDU) hatte bei ihrem letzten Besuch im Flutgebiet Anfang September versprochen:
"Wir werden Sie nicht vergessen."
Entsprechend empört sind Politiker über den selbstzufriedenen Tonfall der Bilanz.
CSU-Innenexperte Michael Kuffer (49) zu BILD:
"Die Familien von 183 Todesopfern und 800 Verletzten müssen das als puren Hohn empfinden!"
Katharina (37, Büroangestellte) und Thomas Dederich (39) aus
Walporzheim:
Die Alarmierung am 14. Juli hat absolut nicht funktioniert.
Dieses Versagen war das schlimmste.
90 Prozent der Hilfe kam dann von Freiwilligen.
Es gibt hier Menschen, die zu Hause nicht essen oder duschen können.
Es ist immer noch eine Katastrophe und wir finden, so sollte man das auch behandeln."
↑ BaFin befürchtet für Versicherer Kosten von bis zu 8,2 Milliarden Euro
-
FAZ
2021-09-15 de BaFin befürchtet für Versicherer Kosten von bis zu 8,2 Milliarden EuroDie erwartete Schadenssumme steigt weiter und liegt nun deutlich über der jüngsten Branchenschätzung.
Doch die Finanzaufsicht hält die Assekuranz für stabil.
Die Flutkatastrophe im Rheinland und in der Eifel kostet die deutschen Versicherer nach einer Umfrage der Finanzaufsicht BaFin bis zu 8,2 Milliarden Euro.
Das sind 2,5 Milliarden mehr als die Bonner Behörde vor vier Wochen aus den Daten von 136 Sachversicherern errechnet hatte, und mehr als die rund 7 Milliarden Euro, die der Branchenverband GDV kürzlich nannte.
An die Existenz geht die Flut den Versicherern und Rückversicherern aber nicht, erklärte der oberste Versicherungsaufseher der Bafin, Frank Grund.
"Bei vielen Unternehmen geht die Bedeckungsquote zwar zurück, bei den meisten aber nur geringfügig", sagte er am Mittwoch.
Einen Großteil der Schäden können die Versicherer auf die Rückversicherer abwälzen.
6,3 Milliarden Euro der Schäden seien rückversichert,
3,3 Milliarden davon bei deutschen Rückversicherern, erklärte die BaFin.
Diese rechneten nach der BaFin-Umfrage schlimmstenfalls mit einer Brutto-Belastung von vier Milliarden Euro.
Aber auch davon könnten sie einen Großteil an Konkurrenten abwälzen.
Netto blieben sie maximal auf rund einer Milliarde Euro sitzen.
Die Münchener Rück und die Hannover Rück zählen zu den drei weltgrößten Unternehmen der Branche.
Rückversicherer übernehmen üblicherweise einen Teil von Großschäden, die einzelne Erstversicherer sonst zu überfordern drohten.
Der größte Teil der Nettobelastung der Erstversicherer nach den Überschwemmungen im Westen Deutschlands entfällt laut BaFin
mit rund 900 Millionen auf die Wohngebäudeversicherung,
jeweils rund 200 Millionen entfallen auf die Hausrat- und die Kfz-Kaskoversicherung.
Die Schäden wären noch höher,
wenn nicht nur 46 Prozent der deutschen Hausbesitzer gegen Hochwasser und Sturzfluten versichert wären.
↑ Bis zu 30 Milliarden Euro: Bundesrat billigt Hilfen für Hochwasserregionen
-
FAZ
2021-09-10 de Bis zu 30 Milliarden Euro: Bundesrat billigt Hilfen für HochwasserregionenDer Bundesrat hat den Weg frei gemacht für die Milliardenhilfen zum Wiederaufbau in den Hochwasserregionen im Westen Deutschlands.
Für den Fonds stehen bis zu 30 Milliarden Euro zur Verfügung.
↑ California: How the Flood Risk Management System Works
-
Sacramento District
2021-09-02 en How the Flood Risk Management System Works
How the Flood Risk Management System Works
Did you know?
Despite its complexity, the flood risk management system in Northern California consists of only a few major components - primarily dams, levees, weirs, and bypasses.
See how they work together to move water away from people and property in this animation.
▶Hochwasserschutz in Kalifornien
↑ Hochwasser als Ankündigung und Charakteristikum der Kleinen Eiszeit?
-
EIKE Europäisches Institut für Klima und Energie
Axel Robert Göhring
2021-08-30 de Hochwasser als Ankündigung und Charakteristikum der Kleinen Eiszeit?Die aktuellen heftigen Schneestürme in Nord und Süd und das häufiger auftretende Hochwasser könnten ein Zeichen des Klimawandels sein -
des natürlichen, und der bringt Kälte.
Das Mittelalter ging im 14. Jahrhundert zu Ende,
und mit ihm die Warmzeitära mit Bevölkerungsexplosion, Höhenburgenbau und ausgetrocknetem Rhein.
Als zentrales Ereignis wird die Pest von 1348 angesehen, die in einigen Städten und Gegenden bis zu drei Viertel der Bevölkerung auslöschte.
Im Laufe der Flut-Berichterstattung der vergangenen Wochen wurde das Magdalenenhochwasser häufiger erwähnt.
Und das war - 1342, sechs Jahre vor der Pest.
Ob ein direkter Zusammenhang besteht, können wir in einem Artikel nicht evaluieren, aber die zeitliche Nähe läßt den Verdacht aufkommen.
Die "Kleine Eiszeit" nach 1400, eigentlich "nur" eine Abkühlungsphase, ist immerhin von einigen Hochwasser-Ereignissen gekennzeichnet.
Ein Grund dafür könnte sein, daß warme Luft mehr Wasser aufnehmen kann und es sich daher seltener in Oberflächengewässern befindet.
Typisches Beispiel ist die "Thüringer Sintflut" von 1613, die mehrere Flüsse meterhoch ansteigen ließ und in Jena, Weimar, Erfurt, Stadtilm, Gotha und Apolda etliche Häuser zerstörte - und über 2.200 Menschen tötete, bei zehnfach geringerer Bevölkerung gegenüber heute.
Es gab seit 1997 mehrere Hochwasser-Ereignisse,
die zeitweilig die Medien beherrschten und Wahlen entschieden.
1997 - die Oderflut,
2002 - das Hochwasser in Bayern und Österreich,
2013 - die Flut im Osten,
2021 - die Flut im Rhein-Einzugsgebiet.
Es sieht nach Häufung aus, und das könnte ein Anzeichen für eine Abkühlung zumindest auf der Nordhalbkugel sein.
Zusammen mit den gewaltigen Schneefällen von Dezember bis Februar, und den derzeitigen Kälterekorden in Brasilien (Kaffee-Ernte fällt aus), kann sogar eine globale Abkühlung vermutet werden.
Ob die Vermutung stimmt, kann erst in 10, 20 Jahren geklärt werden;
Klima-Statistik ist von langen Datenreihen abhängig.
Eines ist aber jetzt schon sicher:
Waldbrände in Südamerika und Australien, und Hitzerekorde in Südeuropa und den Nordwest-USA sind kein Beweis für die Heißzeittheorie der Klima-Alarmisten, die exzellente Geschäfte machen.
▶Voraussagen einer neuen Kälteperiode
↑
Eine theologische Tagung beschäftigt sich mit dem Klimawandel
 Worauf noch hoffen in dieser Zeit?
Worauf noch hoffen in dieser Zeit?
-
Domradio
2021-08-28 de Eine theologische Tagung beschäftigt sich mit dem Klimawandel
Worauf noch hoffen in dieser Zeit?Von Ordnung, Unordnung, Umwelt, Klimawandel, Apokalypse und dem himmlischen Jerusalem:
Vier Tage lang geht es auf einem Kongress der Europäischen Gesellschaft für Katholische Theologie in Osnabrück um Schöpfung und Transformation.
Als neuen Rahmen für den christlichen Glauben
bezeichnete der Münchner Sozialethiker Markus Vogt
den Klimawandel und die ökologischen Herausforderungen.
↑ Tichys Ausblick - Leben nach der Flut - Wo kann man wieder bauen? | Zur Sache Rheinland-Pfalz
Die verheerende Flut hat viele Häuser zerstört.
Von einigen ist nichts übriggeblieben, andere werden abgerissen oder wiederaufgebaut.
Diese Woche sind wir in Altenahr unterwegs, unter anderem im Ortsteil Altenburg, in dem der Großteil der Häuser schwere Schäden hat.
Wie geht es den Menschen dort?
Viele wissen noch nicht, wieviel Geld sie aus dem Spendentopf bekommen und unter welchen Voraussetzungen.
Unklar ist auch, ob sie ihr Haus am ursprünglichen Ort wieder aufbauen dürfen.
Viele Ahr-Anwohner sind ratlos.
↑
Klimawandel, Flut an Ahr und Erft - und die Frage nach dem Verschulden
 nicht mehr 400 Jahre im statistischen Mittel, sondern eher 300
nicht mehr 400 Jahre im statistischen Mittel, sondern eher 300
-
Deutschlandfunk
2021-08-24 de Klimawandel, Flut an Ahr und Erft - und die Frage nach dem VerschuldenDurch den Klimawandel haben sich die Wahrscheinlichkeit und die Intensität extremer Regenfälle in Westeuropa erhöht.
Das ist das Ergebnis einer Studie, die die Rolle des Klimawandels bei den verheerenden Überschwemmungen im Juli an Ahr und Erft in Deutschland sowie an der Maas in Belgien untersucht hat.
Die "World Weather Attribution" (WWA) ist ein Zusammenschluss internationaler Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen,
in dem etwa
der Deutsche Wetterdienst (DWD),
die Universität Oxford,
die ETH Zürich
und das britische Met-Office mitarbeiten.
Sie untersuchen, inwieweit bestimmte extreme Wetterereignisse - wie Stürme, Starkregen, Hitzewellen, Kälteperioden und Dürren - der Klimaerwärmung zuzuordnen sind.
Konkret heißt es in der Studie:
Bei einer Erwärmung von zwei Grad Celsius könnte Starkregen um bis zu sechs Prozent intensiver werden.
Und solche Unwetter wie Mitte Juli hätten dann eine kürzere Wiederkehrzeit:
nicht mehr 400 Jahre im statistischen Mittel, sondern eher 300.
↑ Anzeige gegen Wupperverband: Hätte früher Platz in Talsperren geschaffen werden können?
-
Oberbergischer Anzeiger
2021-08-24 de Anzeige gegen Wupperverband: Hätte früher Platz in Talsperren geschaffen werden können?Wären die Überschwemmungen in der Hansestadt, als Wupper, Hönnige und Gaulbach zahlreiche Wohnungen, Firmengebäude und Keller unter Wasser setzten, vermeidbar gewesen?
Hätte der Wupperverband früher reagieren und mehr Platz in den Talsperren schaffen können?
Fragen, die sich viele Menschen stellen,
und die bald auch die Gerichte beschäftigen dürfte. Ein Wuppertaler Anwalt vertritt nach eigenen Angaben mehr als 100 Hochwassergeschädigte, er hat Strafanzeige gegen den Wupperverband eingereicht - wegen "Herbeiführung einer Überflutung".
Eine Frage ist, ob der Wasserverband möglicherweise wegen "Amtshaftung" in Regress genommen werden kann.
↑ Tichys Ausblick - "Flutkatastrophe und Klimawandel - Große Sprüche, keine Taten"
Die Welt dreht sich weiter und die Flutkatastrophe ist zum größten Teil wieder aus den Medien verschwunden.
Zurück bleibt nur die ewige Leier vom menschengemachten Klimawandel.
Doch die Menschen, die um ihre Liebsten trauern, die von den Geschehnissen traumatisierten sind, die alles verloren haben, sind weiterhin da, wenn die Aufmerksamkeit der Medien lange abgeklungen ist.
In unserer heutigen Sendung "Flutkatastrophe und Klimawandel - Große Sprüche, keine Taten" sprechen wir darüber, wie die schrecklichen Bilder der Flut zwar liebend gerne für die Klimaagenda instrumentalisiert wurden, aber keine reellen Taten gefolgt sind - die Opfer wurden alleine gelassen, Helfer sogar noch vertrieben.
Ins Studio zugeschaltet wird Britta Mecking aus Blessem in NRW.
Sie ist Flutopfer und wird aktuell vor Ort gebraucht, deshalb kann sie nicht ins Studio kommen.
Frau Mecking schildert, dass niemand etwas getan hat, um sie zu warnen.
Wie sie und ihre Nachbarn Keller leer gepumpt haben - auf sich gestellt, denn die Zufahrtsstraße wurden abgeriegelt, auch Helfer konnten nicht durchkommen.
Im Studio sind
Norbert Bolz - Publizist, Medien- und Kommunikationstheoretiker -
und Sebastian Lüning - Geologe, Privatforscher, Autor des Buches "Die kalte Sonne".
Sie sprechen mit Roland Tichy über Fakten.
Darüber, dass es schon immer Flutkatastrophen gegeben hat, dafür braucht es keinen menschengemachten Klimawandel.
Und obwohl es den Politiker ein großes Anliegen ist, Probleme zu lösen, die weit in der Zukunft liegen, scheinen sie keinerlei Interesse daran zu haben, die Katastrophen zu beseitigen, die im Jetzt liegen.
Doch wie kann es sein, dass die Politiker damit durchkommen?
Und wann werden die Menschen endlich merken, dass unser Politiker nur reden, aber nicht handeln?
Auch darüber diskutiert Roland Tichy mit seinen Gästen heute Abend bei Tichys Ausblick.
↑
Wie die Politik Ahrweiler instrumentalisiert
 Beweis für den menschgemachten Klimawandel
Beweis für den menschgemachten Klimawandel
-
EIKE Europäisches Institut für Klima und Energie
2021-08-16 de Klimawissen - kurz & bündig: Wie die Politik Ahrweiler instrumentalisiert
Klimawissen - kurz & bündig: Wie die Politik Ahrweiler instrumentalisiert
Nachdem die heißen Sommer mit Dürre ausfielen, nutzten Medien und Politiker sogleich das Hochwasser als Beweis für den menschgemachten Klimawandel.
↑ Warnung vor Gefahren? Aber wie? DWD APP, NINA + Insiderinfos Ahrtal
-
Outdoor Chiemgau Der Krisenvorsorgekanal
2021-08-13 de Warnung vor Gefahren? Aber wie? DWD APP, NINA + Insiderinfos Ahrtal
Warnung vor Gefahren? Aber wie? DWD APP, NINA + Insiderinfos Ahrtal
Wie kann man sich von Fehlentscheidungen der Behörden unabhängig machen und immer gewarnt werden?
↑ Extremhochwasser und Hunderte Tote an der deutschen Ahr - seit 1348 aufgezeichnet
-
Textatelier / Werner Eisenkopf, Runkel/D
2021-08-09 de Extremhochwasser und Hunderte Tote an der deutschen Ahr - seit 1348 aufgezeichnetDieses extreme Ahr-Hochwasser vom 14./15. Juli 2021, wird bereits massiv instrumentalisiert, in Politik und Medien, um Stimmung in der "Klimadiskussion" anzuheizen und dies im derzeit laufenden deutschen Bundestags-Wahlkampf auszuschlachten.
Dieser Artikel im Textatelier, soll dagegen lediglich die tatsächliche Vergangenheit im Ahrtal aufzeigen, seit es dazu überhaupt noch existierende Überlieferungen/Urkunden gibt.
Diese ergeben dann nämlich ein ganz anderes Bild.
Sie widersprechen allen heutigen Behauptungen,
daß dieses Ahr-Extremhochwasser vom 14./15. Juli 2021,
eine "Folge menschgemachten Klimawandels" sei
und mit irgendwelcher "Klimaschutzpolitik" sogar künftig vermeidbar sei.
Dies ist vielerorts aber gar nicht gewünscht,
das simple verbreitete "Klimabild" soll ja keine Kratzer erhalten.
Wer sich dazu aber dennoch wirklich ein neutraleres Bild machen möchte und eigene Schlüsse ziehen, der kann dafür die folgenden Zeilen und gern auch das Quellenmaterial dazu, in aller Ruhe lesen.
Vorläufige Schlußfrage:
WAS meldeten und melden die Fernsehsender, viele Zeitungen und auch der neue Chef des deutschen Umweltbundesamts und auch etwa eine deutsche Pfarrerin in ihrem Sonntagsbrief?
Das extreme Ahrhochwasser 2021 sei "zweifellos" Folge des menschlich verschuldeten Klimawandels durch die Industrialisierung und damit seit ca. 1850 herum, somit die Übel-Ursache?
Mit sofortigem CO₂-Stoppen könne man dies künftig vermeiden?
Ein "Grünes Norm-Wetter" mit der propagierten "Stellschraube CO₂" zurückgedreht auf irgendeinen ominösen "Durschschnitt" wie er angeblich mal gewesen sein soll und dann gehalten?
In welchem Jahr/Jahrzehnt war das denn der Fall?
Sehr geehrte Damen und Herren Journalisten und Politiker dieser Melderichtung, Sie beleidigen damit aber nun wirklich die Intelligenz der Bürger als Leser und Fernsehzuschauer!
Epilog:
Am 14./15. Juli 2021, brach eine verheerende Naturkatastrophe über das beschauliche Ahrtal herein und tötete über 140 Menschen.
Es wird auch noch viele Jahre dauern, bis die schrecklichen materiellen und auch seelischen Schäden bei den Menschen einigermaßen repariert oder verarbeitet sein werden.
Dies darf jetzt hier genauso wenig vergessen werden, wie die Hilfe und Unterstützung, die dort im Ahrtal und auch in den anderen betroffenen Gebieten, unverändert benötigt werden.
Das sind die traurigen Fakten!
↑ "Hier wurde gar keiner gewarnt": Rekonstruktion der Flut im Ahrtal
-
Der Spiegel
2021-08-10 de "Hier wurde gar keiner gewarnt": Rekonstruktion der Flut im Ahrtal
"Hier wurde gar keiner gewarnt": Rekonstruktion der Flut im Ahrtal
Als in Schuld an der Ahr schon Häuser davonschwammen, konnte man flussabwärts in Ahrweiler noch am Ufer gemütlich spazieren gehen.
Mindestens fünf Stunden brauchte die Flutwelle zwischen den beiden Orten.
Zeit genug, um die Menschen im unteren Ahrtal rechtzeitig zu warnen.
Doch es passierte lange nichts.
Warum?
Eine Rekonstruktion der Flutnacht und die Suche nach einem Verantwortlichen.
↑ Vor und nach der Flut 2021: Die Ahr-Rotweinstraße von Altenahr nach Dernau
-
Bastifbr
2021-08-08 de Vor und nach der Flut 2021:
Die Ahr-Rotweinstraße von Altenahr nach Dernau
Vor und nach der Flut 2021:
Die Ahr-Rotweinstraße von Altenahr nach Dernau
Das Video zeigt die Schäden entlang der Rotweinstraße im Ahrtal exakt zwei Wochen nach der Flut vom 14. auf den 15. Juli 2021.
Beginn der Fahrt ist hier vom völlig zerstörten Abschnitt "Am Tunnel" in Altenahr in Richtung Osten nach Dernau.
Besten Dank an "Rockdrummer71", der das Video im Juli 2015 aus seiner Perspektive gefilmt hat und an Timmy für die Ideenfindung.
↑ "Hier ist Ingenieurskunst gefragt"
Mit folgendem Link wird von anderen Webseiten auf diese Seite verwiesen.
▶Tagesschau.de: "Hier ist Ingenieurskunst gefragt"
-
Tagesschau.de
2021-08-08 de "Hier ist Ingenieurskunst gefragt"Nach der Starkregenkatastrophe wird das Ahrtal nicht so bleiben wie es war.
Was sich verändern muss, damit Menschen weiterhin am Fluss leben können, erklärt der Biologe Wolfgang Büchs im Interview mit tagesschau.de.
Büchs: Ich habe mich gewundert, dass ein solch katastrophales Ereignis dort heute noch so passieren kann.
Gleichzeitig bin ich erstaunt, dass entsprechende Hochwasser-Schutzmaßnahmen nicht getroffen wurden,
obwohl sie schon seit 100 Jahren im Gespräch sind, denn seit Jahrhunderten ist es im Abstand von etwa 100 Jahren immer wieder zu katastrophalen Fluten gekommen.
In den 1920er-Jahren wurden die schon sehr konkreten Pläne zugunsten des Baus des Nürburgrings zurückgestellt.
Dazu zählen Maßnahmen wie Hochwasser-Rückhaltebecken, die insgesamt 11,3 Millionen Kubikmeter Wasser hätten zurückhalten können.
↑ Wenn eine volle Talsperre wichtiger ist als Flutschutz
-
Klimareporter
2021-08-08 de Wenn eine volle Talsperre wichtiger ist als FlutschutzDie Flut im Tal der Wupper wurde durch das Versagen des Talsperren-Managements zur Katastrophe.
Aus dem Flutereignis von 2002 in Sachsen hatte in Westdeutschland niemand lernen wollen.
Ob sich das nun ändert, dafür gibt es ein klares Kriterium.
Jahrhundertelang ist das Wasser der Wupper in Elberfeld und Barmen, dem heutigen Wuppertal, immer wieder über die Ufer getreten.
Als die Doppelstadt in der ersten Phase der Frühindustrialisierung zur völlig überbevölkerten Weltstadt wurde, entstanden Favela-artige Siedlungen nahe am Flusslauf, die regelmäßig überflutet wurden.
↑
 Flutkatastrophe: Totalversagen der Klimawandel-Propheten
Flutkatastrophe: Totalversagen der Klimawandel-Propheten
Angesichts von vermutlich mehr als 200 Toten und tausender
vernichteter Existenzen ist jetzt nicht der Moment für
freundliche Worte.
Mit folgendem Link wird von anderen Webseiten auf diese Seite verwiesen.
▶Flutkatastrophe: Totalversagen der Klimawandel-Propheten
-
Ruhrkultour / Fred F. Mueller
2021-08-07 de Flutkatastrophe: Totalversagen der Klimawandel-ProphetenDie Flutkatastrophen infolge des Tiefs Bernd haben nicht nur in Deutschland, sondern auch in Nachbarländern ungeheure Schäden hinterlassen,
zahlreiche Menschenleben gefordert und viele Existenzen vernichtet.
Jetzt behaupten landauf, landab Fernsehen, Zeitungen und Politiker lautstark, diese Katastrophe sei eine Folge des "menschengemachten Klimawandels durch CO₂".
Deshalb solle Deutschland künftig mehr in "Klimaschutz" investieren.
Dabei haben gerade diese Verfechter eines drohenden Weltuntergangs mit dazu beigetragen, dass die Bevölkerung nicht rechtzeitig gewarnt wurde.
Angesichts von vermutlich mehr als 200 Toten und tausender vernichteter Existenzen ist jetzt nicht der Moment für freundliche Worte.
Jetzt muss Tacheles geredet werden, müssen Verantwortliche bis in höchste Ebenen genannt werden.
Dieser Fisch stinkt vom Kopf her, und davon sollte man sich nicht durch Bauernopfer bei Landräten ablenken lassen

 Am 14.7. um 17.00 Uhr herausgegebene Karte
mit Warnungen vor extremer Überflutungsgefahr
Am 14.7. um 17.00 Uhr herausgegebene Karte
mit Warnungen vor extremer Überflutungsgefahr


 Die durchschnittliche Regenmenge in Deutschland
Die durchschnittliche Regenmenge in Deutschland
hat seit Beginn der systematischen Erfassung um rund 8 % zugenommen.
Mittelwert: Rot, Trend: gepunktet

Doch obwohl der Blick auf die Grafik zeigt, dass dies durchaus nicht ungewöhnlich ist, haben sich zahlreiche Klimapropheten - darunter der DWD und das Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung mit seinen bunten Dürremonitor-Bildern (Bild 4) - darauf versteift, dass Deutschland wegen des Klimawandels künftig verstärkt mit Dürren zu rechnen habe.
Wie die Talsperren auf Linie gebracht wurden
Zu den üblen Folgen dieser falschen Prognosen gehört, dass deshalb eines der effizientesten Mittel zur Minderung von Flutrisiken falsch eingesetzt wurde:
Unsere Talsperren.
Diese sorgen nicht nur für die Vorratshaltung von Wasser für niederschlagsarme Zeiträume, sie können andererseits bei Unwettern auch große Regenmengen speichern und so die Flutgefahr mindern -
wenn sie denn richtig gemanagt werden,
Kleiner Beitrag zur Faktensammlung:
Hochwasserereignisse im Rheingebiet
Wikipedia Zeitreihe der Niederschlagssummen in Deutschland seit 1881

Weiterlesen:
In der Tagesschau am Abend des 14.7. kein Wort von extremer Flutgefahr
Ferner:
Ein Warnsystem wie in einem Drittweltland
Klimawarner auf höchster Drehzahl
Die direkte Verantwortung der Klimapropheten
Wie die Talsperren auf Linie gebracht wurden
↑ Hochwasser im Juli: Bewährungsprobe für den Schweizer Hochwasserschutz
-
Schweizerische Eidgenossenschaft
Eidgenössisches Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport
2021-08-06 de Hochwasser im Juli: Bewährungsprobe für den Schweizer HochwasserschutzHochwasser im Juli 2021
Die anhaltenden und starken Niederschläge im Juli haben in weiten Teilen der Schweiz zu Hochwasser geführt.
Das Bundesamt für Umwelt (BAFU) verzeichnete an seinen hydrologischen Messstationen neue Rekordwerte für den Neuenburger- und Bielersee.
Die von Bund, Kantonen und Gemeinden ergriffenen Massnahmen zum Hochwasserschutz haben sich bewährt:
Es gab keine Opfer zu beklagen und trotz Überschwemmungen halten sich die Hochwasserschäden nach ersten Einschätzungen in Grenzen.
Heftige Gewitter und Hagelzüge begleiteten im Juli intensive Regenfälle.
Der Monat zählte an zahlreichen Messstationen von MeteoSchweiz zu den fünf niederschlagsreichsten seit Messbeginn.
Während des Hauptereignisses vom 12. bis 15. Juli 2021 wurden fast in der ganzen Schweiz Niederschlagssummen von mehr als 100 mm verzeichnet, am Alpennordhang und im Tessin verbreitet über 150 mm.
Das ist die Niederschlagsmenge, die für gewöhnlich innerhalb des ganzen Monats Juli fällt.
Die Niederschläge fielen nach dem feuchten Juni auf ein bereits gefülltes hydrologisches System und liessen die Gewässer rasch weiter anschwellen.
Dies führte verbreitet zu Hochwasser und Überschwemmungen (siehe Link zum Webdossier).
Bewährungsprobe für Hochwasserschutz-Massnahmen
Dank vorsorglicher Massnahmen zum Hochwasserschutz von Bund, Kantonen und Gemeinden konnten grössere Überschwemmungen vermieden werden.
Die lokalen Einsatzkräfte bereiteten sich aufgrund der Prognosen und Warnungen frühzeitig vor, und die Bevölkerung wurde über verschiedene Kanäle laufend informiert.
Hochwasserschutzbarrieren wie Beaverschläuche wurden errichtet und Schwemmholz laufend entfernt, um den Abfluss zu gewährleisten.
Die Entlastungsstollen in Thun (BE) und Lyss (BE) wurden aktiviert.
Ein besonders starkes Gewitter mit Hagelschlag und Sturmböen traf in der Nacht auf den 13. Juli 2021 die Region Zürich.
Um einem zu starken Anstieg der Limmat vorzubeugen, wurde der Sihlsee (SZ) vorsorglich abgesenkt.
In Basel wurde die Schifffahrt für sechs Tage eingestellt.
Um die Jurarandseen möglichst rasch absenken zu können, beschlossen das BAFU und die betroffenen Kantone Bern, Waadt, Freiburg, Neuenburg, Solothurn und Aargau am 16. Juli gemeinsam, den Abfluss der Aare aus dem Bielersee temporär zu erhöhen.
Weniger Überschwemmungen trotz ähnlicher Regenmengen
Beim Hochwasser im Juli 2021 fielen insgesamt vergleichbare Regenmengen auf eine ähnlich grosse Fläche, wie im grossen August-Hochwasser von 2005 (6 Todesopfer, Schäden von rund 3 Milliarden Franken).
Damals fielen verbreitet über 200 mm Niederschlag in 72 Stunden am Alpennordhang.
Der Niederschlag im Juli war jedoch über einen längeren Zeitraum verteilt.
Deshalb führte er zwar insgesamt zu einem höheren Abflussvolumen, jedoch zu tieferen Maximalpegeln in den einzelnen Flüssen, als beim Hochwasser von 2005.
Nur an wenigen Messstationen wurden die Höchstwerte von 2005 übertroffen, so z.B. an der Reuss in Luzern.
Murgänge, Rutschungen und Oberflächenabfluss
An verschiedenen Orten kam es wegen der gesättigten Böden und anhaltender Niederschläge, kombiniert mit intensiven Gewittern und Hagel, zu Murgängen, Rutschungen und verbreitet Oberflächenabfluss.
Strassen und Schienenverbindungen waren teils während mehrerer Tage unterbrochen.
So zum Beispiel in den Kantonen Schwyz und Uri oder am Genfersee in der Waadt.
Auch im Kanton Tessin lösten die Niederschläge verschiedene Rutschungen aus.
So war die Nord-Südachse A2 wegen Erdrutschen mehrere Stunden unterbrochen, aber auch Strassen in den Seitentälern.
Häufig gab es Schäden durch Oberflächenabfluss:
Das Wasser drang von aussen in Gebäude ein und flutete Garagen, Keller oder Unterführungen.
Schutz vor Naturgefahren als Daueraufgabe
Die Ereignisse im Juli 2021 haben gezeigt, wie wichtig Massnahmen zum Hochwasserschutz sind.
Gerade vor dem Hintergrund des Klimawandels, aber auch in Bezug auf die Nutzung der Siedlungsfläche muss der Schutz vor Hochwasser und anderen Naturgefahren kontinuierlich an neue Rahmenbedingungen angepasst werden - und ist deshalb eine Daueraufgabe.
Die Erkenntnisse aus dem Juli-Hochwasser fliessen in die laufende Optimierung der organisatorischen, planerischen und baulichen Hochwasserschutz-Massnahmen ein.
↑
Drei Wochen nach der Hochwasser-Katastrophe
"Total im Stich gelassen":
Ahrweilers Flutopfer kochen vor Wut über mangelnde Hilfe
-
Focus Online / Frank Gerstenberg
2021-08-06 de Drei Wochen nach der Hochwasser-Katastrophe
"Total im Stich gelassen": Ahrweilers Flutopfer kochen vor Wut über mangelnde Hilfe21 Tage nach der Flutkatastrophe mit allein 139 Toten im Landkreis Ahrweiler
leben zahlreiche Menschen im Ahrtal zwischen Blankenheim und Remagen nach wie vor ohne Wasser, Strom, Duschen und Toiletten.
FOCUS Online sprach mit den Menschen in Bad Neuenahr, die von Stadt und Landrat, jedoch auch von Technischem Hilfswerk und Feuerwehr allein gelassen werden.
"Es ist eine Frechheit, was hier mit uns passiert", sagt Markus Reisenhofer (34).
Der Fernfahrer war beruflich in Bremen, als ihn um 3 Uhr in der Nacht vom 14. Juli auf den 15. Juli eine WhatsApp-Nachricht seines Vaters erreicht:
"Bad Neuenahr gibt es nicht mehr." Reisenhofer versteht nicht.
"Ich dachte erst, er macht einen Witz."
Drei Stunden später schickt ihm ein Kollege ein Foto seines Autos:
Der blaue Ford Focus schwimmt auf dem Betriebshof seiner Spedition.
Nur die Antenne ragt noch aus dem Wasser.
Zur gleichen Zeit kommt noch eine Nachricht des Vaters, der im selben Häuserblock wohnt:
"Du hast keine Wohnung mehr." Reisenhofer ist fassungslos:
"Man hat sich über Jahre eine Existenz aufgebaut und dann ist in wenigen Stunden alles zerstört", sagt der schlaksige schwarzhaarige Mann in der dunkelblauen Arbeitshose.
"Niemand war hier, niemand hat gefragt, wie es uns geht"
Auf den Tag genau drei Wochen nach der Flut führt Reisenhofer den Reporter durch seine Wohnung:
In der Küche steht ein Stromaggregat.
Im Wohnzimmer stapeln sich Müllsäcke und Decken.
An den Vorhängen ist zu erkennen, wie hoch das Wasser stand in der Erdgeschosswohnung, die immerhin noch ein halbes Stockwerk über der Straße liegt.
"Die Wohnung ist unbewohnbar", sagt er.
Er lebt inzwischen in einer Notunterkunft, wenn er nicht mit seinem LKW unterwegs ist.
Von der Stadt habe sich noch niemand blicken lassen.
Weder Bürgermeister Guido Orthen (CDU) noch andere Offizielle.
"Niemand war hier", sagt Reisenhofer.
"Niemand hat uns gefragt, wie es uns geht, wie wir die Flut erlebt haben."
Orthen sagte in einem Interview mit der FAZ, dass man bei der Versorgung mit Strom und Wasser schon "sehr weit" sei.
Die Menschen an der Kreuzstraße können darüber nur lachen:
"Wir machen uns das Wasser auf Gaskochern warm und schütten es uns dann über den Kopf.
Das ist unsere Dusche", sagt Marion Scholz (71).
Zum Waschen nehme sie Mineralwasser.
Ihr Nachbar Klaus Wächter (77) hat keine Wohnungstür mehr.
Auch keine WC-Tür.
Wenn er auf die Toilette geht, sage er laut im Haus Bescheid, damit keiner ungelegen zu Besuch kommt.
Landesamt für Umwelt bestätigt, dass Landkreis frühzeitig gewarnt wurde
Bürgermeister Guido Orthen sagte im Interview mit der FAZ, dass er "für eine Schulddiskussion nicht zur Verfügung" stehe.
"Zynisch" sei das, "ein Skandal", sagt Inge Willmann (56), die im gleichen Haus wie Scholz und Wächter wohnt.
"Was da auf uns zukommt, hätte jeder der Verantwortlichen wissen müssen", sagt die Frau mit dem Pferdeschwanz, die als Disponentin bei einer Zeitung arbeitet.
"Der Landrat und der Bürgermeister sind hier komplett unten durch".
Willmann fordert: "Beide haben total versagt und müssen zurücktreten."

Weiterlesen
↑ Ermittlungen gegen Landrat von Ahrweiler
-
Tagesschau.de
2021-08-06 de Ermittlungen gegen Landrat von AhrweilerNach der Flutkatastrophe im Ahrtal hat die Staatsanwaltschaft Ermittlungen gegen den Landrat eingeleitet.
Es geht um den Verdacht der fahrlässigen Tötung und der fahrlässigen Körperverletzung durch Unterlassen.
Bewohner offenbar zu spät gewarnt
Pföhler hatte den Angaben zufolge nach den Regeln des Landesbrand- und Katastrophenschutzgesetzes Rheinland-Pfalz "möglicherweise die Einsatzleitung inne und daher die alleinige Entscheidungsgewalt".
Das Mitglied des Krisenstabs hatte die Einsatzleitung den Erkenntnissen zufolge zumindest zeitweise übernommen.
Es hätten sich Hinweise darauf ergeben, dass die noch nicht von der Flutwelle betroffenen Bewohner des Ahrtals am 14. Juli spätestens um 20.30 Uhr hätten gewarnt und in Sicherheit gebracht werden müssen.
Dies soll laut Anfangsverdacht nicht in der gebotenen Deutlichkeit oder erst verspätet geschehen sein.
↑ Die verheerende Flut in Ahrweiler - eine Video-Rekonstruktion des Hochwassers
Mit folgendem Link wird von anderen Webseiten auf diese Seite verwiesen.
▶Die verheerende Flut in Ahrweiler - eine Video-Rekonstruktion des Hochwassers
-
NZZ Neue Zürcher Zeitung
2021-08-06 de Die verheerende Flut in Ahrweiler -
eine Video-Rekonstruktion des Hochwassers
Die verheerende Flut in Ahrweiler -
eine Video-Rekonstruktion des Hochwassers
Die mit Abstand meisten Todesopfer forderte das Hochwasser in Deutschland im Landkreis Ahrweiler.
Warum war die Flut dort so verheerend?
Augenzeugenvideos der Hochwasserkatastrophe in Deutschland.
Es ist die Naturkatastrophe mit den meisten Todesopfern seit den 1960er Jahren.
Besonders verheerend war die Flut in Rheinland-Pfalz im Landkreis Ahrweiler.
Über 130 Menschen verloren hier ihr Leben.
Wie genau spielte sich diese Katastrophe ab?
Wir zeigen Wetterdaten, Satellitenbilder und Zeugenvideos, um besser zu verstehen, wie es zur tödlichen Flut kommen konnte.
Montag, 12. Juli 2021 - die Vorhersagen
Wir beginnen die Rekonstruktion zwei Tage vor der Überschwemmung im Ahrtal.
Wettervorhersage Deutscher Wetterdienst vom Montag, 12. Juli 2021:
«Das Wetter in Deutschland will sich einfach nicht beruhigen.»
In der Vorhersage prognostiziert der Deutsche Wetterdienst Überflutungen in Rheinland-Pfalz.
Sprecher: «Lokal sind nach aktuellem Stand
sogar Mengen bis 200 Liter pro Quadratmeter
nicht ausgeschlossen.
Das bedeutet natürlich auch in dieser Region: Überflutungen.»
Dienstag, 13. Juli - Warnung vor extremen Unwettern
Am nächsten Tag fällt vielerorts in Deutschland enorm viel Regen.
Es kommt zu ersten Hochwassern.
Der Deutsche Wetterdienst spricht jetzt für 17 Regionen eine Warnung vor extremen Unwettern aus - höchste Warnstufe.
Darunter auch für den Landkreis Ahrweiler.
Mittwoch, 14. Juli - Hochwasserwarnung und Evakuierung
Die Ahr fliesst hier mit vielen Kurven durch das Tal -
Häuser sind nahe am Fluss gebaut.
Hügel umgeben die Dörfer.
Am Mittwoch, dem 14. Juli, trifft der extreme Starkregen die Region.
Der sonst ruhige Fluss verwandelt sich in einen reissenden Strom - hier trägt der Fluss ein Wohnmobil mit.
Über ein Internetarchiv haben wir die Hochwasserfrühwarnung für Rheinland-Pfalz aufgerufen.
Sicher seit kurz vor 18 Uhr gilt auch hier höchste Warnstufe für die Ahr:
Das bedeutet: «Überflutung bebauter Gebiete in grösserem Umfang.»
Diese Grafik zeigt den Pegelstand der Ahr in der Gemeinde Altenahr.
Am Nachmittag steigt der Pegel plötzlich stark an.
Er übersteigt die Marke des bisherigen Höchststands.
Um 20 Uhr 45 erlischt das Signal - der Pegelstandsmesser wurde von den Fluten weggerissen.
Der letzte gemessene Pegelstand beträgt 5,7 Meter.
Der Krisenstab soll erst gegen 22 Uhr bemerkt haben, dass sich der Pegel nicht mehr verändert, berichtet die «Rhein-Zeitung».
Tatsächlich steigt der Pegel weiter an.
Um 23 Uhr 09 folgt der Aufruf zur Teilevakuierung:
«Aufgrund der starken Regenereignisse sollen die Bewohnerinnen und Bewohner der Städte Bad Neuenahr-Ahrweiler, Sinzig und Bad Bodendorf, die 50 Meter rechts und 50 Meter links von der Ahr wohnen, ihre Wohnungen verlassen.»
Für viele Menschen kommt dieser Aufruf zu spät.
Die 50 Meter sind zu knapp bemessen.
Donnerstag, 15. Juli, und die Tage danach - retten, bergen und die Aufarbeitung
Diese Aufnahme zeigt das überflutete Seniorenheim und die Grundschule in Altenahr.
Sie liegen über 250 Meter vom Fluss entfernt.
Um das Ausmass der Katastrophe zu erfassen, werden Satellitendaten zu Hilfe genommen.
Hier eine Notfallkarte, um Rettungskräfte zu unterstützen.
Die roten Punkte markieren zerstörte Gebäude, die orangen beschädigte Gebäude.
In Sinzig, kurz bevor die Ahr in den Rhein fliesst, wird ein Heim für Menschen mit Beeinträchtigung überflutet - allein hier sterben 12 Menschen.
Ein Grund, warum die Region nicht besser auf Hochwasser vorbereitet gewesen sein könnte:
Die Gefahr wurde möglicherweise unterschätzt.
Hier die Gefahrenkarte für extreme Hochwasser, die statistisch seltener als alle 100 Jahre auftreten sollten.
Die blauen Flächen würden dabei überflutet - hier wieder das Seniorenheim und die Grundschule, welche wir schon kennen.
Viele dieser Schäden hätte es also selbst bei einem extremen Hochwasser gar nicht geben dürfen.
Dagegen zeigt ein neuer Bericht:
Für die Berechnung der Überflutungsgefahr wurden historische Hochwasser im Ahrtal aus den Jahren 1804 und 1911 nicht berücksichtigt.
![]()
![]() Pegel Altenahr 1804 und 1911 nicht berücksichtigt
Pegel Altenahr 1804 und 1911 nicht berücksichtigt
grau: Maximaler Abflusss,
orange: Abfluss Mittelwert,
blau: Minimale Abfluss

So wurde die Gefahr möglicherweise unterschätzt.
Die Schäden durch die Flut sind riesig.
Rettungskräfte, die Bundeswehr und Freiwillige helfen bei der Evakuierung und den Aufräumarbeiten.
Der Wiederaufbau wird noch Jahre dauern.
Die Rekonstruktion zeigt:
Das Hochwasser wäre vorhersehbar gewesen
- doch es war wohl die Verkettung von verschiedenen Faktoren, welche die Flut im Landkreis Ahrweiler zur verheerenden Katastrophe machte.
↑ Die Müllflut - Schuttentsorger im Ahrtal
-
SWR Doku
2021-08-06 de Die Müllflut - Schuttentsorger im Ahrtal
Die Müllflut - Schuttentsorger im Ahrtal
Das Hochwasser im Ahrtal hat nicht nur Menschenleben gekostet, Existenzen vernichtet und Gebäude zerstört - es hat auch Müll und Schutt historischen Ausmaßes zurückgelassen.
Freiwillige Helfer, Feuerwehr und THW befreien genauso wie Bundeswehr und diverse Baufirmen Gebäude und Straßen von Schlamm, Trümmern und Treibgut, dazu kommen Tonnen an Sperrmüll aus den Häusern der Anwohner.
Doch wohin damit?
Die aktuelle Reportage beleuchtet neben der Müllbergung im Ahrtal, auch die Müllverarbeitung auf dem Umschlagplatz in Niederzissen, auf dem die Mitarbeiter teils 14 Stunden arbeiten.
Schlussendlich wird die Müll-Flut auf der Deponie Eiterköpfe in Ochtendung auf einem 8-Meter-hohen Müllberg endgelagert, den 400 LKW täglich mit Sperrmüll, Schrott und Unrat aus dem Katastrophengebiet füllen.
↑
Hochwasser im Ahrtal: Déjà-vu der Katastrophe
 Die früheste Erwähnung eines Ahr-Hochwassers datiert bereits
auf das Jahr 1348.
Die früheste Erwähnung eines Ahr-Hochwassers datiert bereits
auf das Jahr 1348.
Mit folgendem Link wird von anderen Webseiten auf diese Seite verwiesen.
▶Flutkatastrophe: Déjà-vu der Katastrophe
-
FAZ / Oliver Schlömer, Jens Giesel und Manfred Lindinger
2021-08-05 de Déjà-vu der KatastropheWar die Flutkatastrophe im Ahrtal ein bislang einmaliges Ereignis und schon der Vorbote des Klimawandels?
Zwei Bonner Geoforscher sind skeptisch und liefern neue Erkenntnisse.

 Luftbild des Ortsteils Altenburg in Altenahr
vor dem Hochwasser
Luftbild des Ortsteils Altenburg in Altenahr
vor dem Hochwasser


 Eine Luftaufnahme vom 15. Juli zeigt den
vom Ahr-Hochwasser überflutenden Ortsteil
Eine Luftaufnahme vom 15. Juli zeigt den
vom Ahr-Hochwasser überflutenden Ortsteil


 Rekonstruierte Abflussmengen
Rekonstruierte Abflussmengen
Spitzenabflüsse des Hochwassers vom 14. Juli 2021
Schuld 500 bis 600 m3/sec
Dernau 1.000 bis 1.200 m3/sec
Walporzheim 1.200 bis 1.300 m3/sec
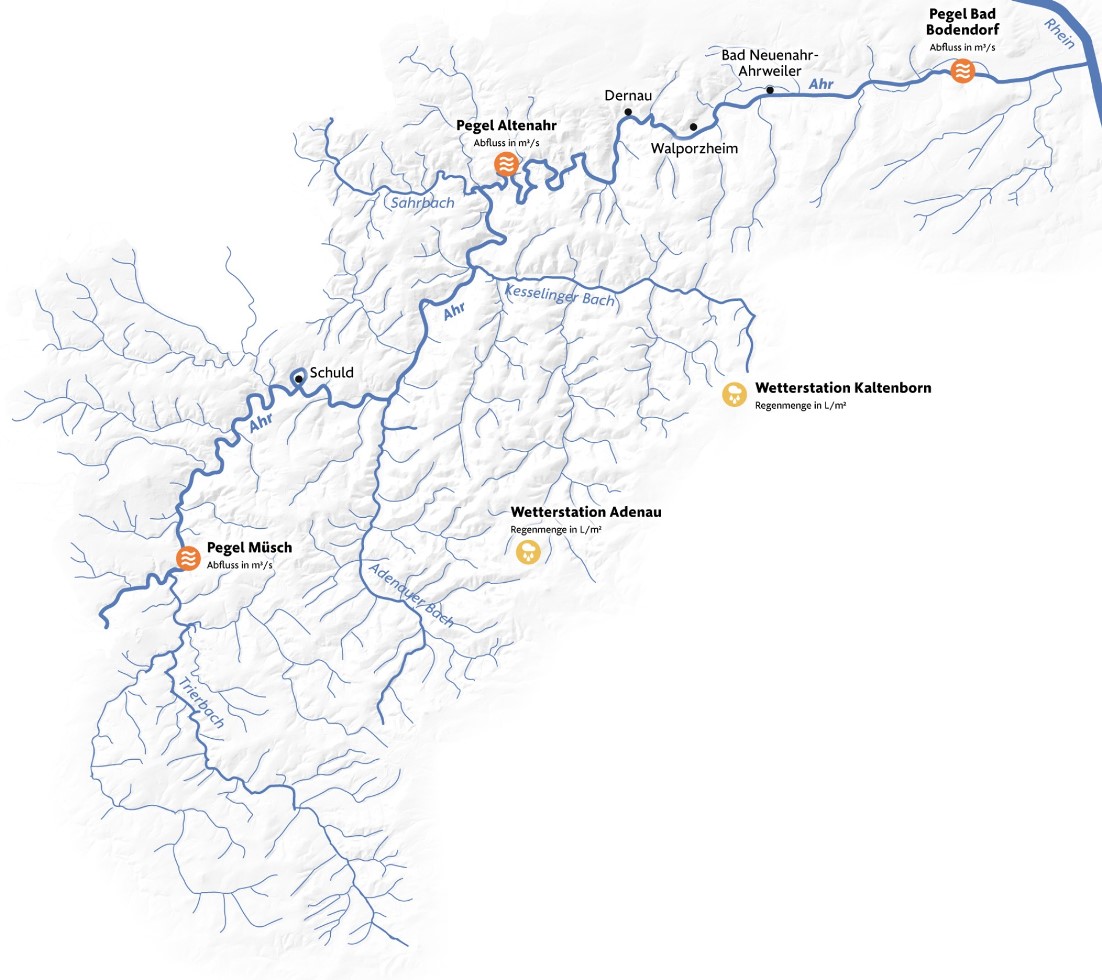
1348: Ahr-Hochwassers
Die früheste Erwähnung eines Ahr-Hochwassers datiert bereits auf das Jahr 1348.
30. May 1601: Antweiler
An diesem Tag erhob sich unversehens am Nachmittag ein Ungewitter mit Regen und Hagel, verfinsterte sich der Himmel, die Schleusen des Himmels öffneten sich und unvorstellbare Wassermassen stürzten hernieder, so daß die entsetzten Bewohner an den Weltuntergang glaubten"
Juli 1804
Spitzenabflüsse in Kubikmeter pro Sekunde
Dernau 1.000 bis 1.300Flussabwärts im rund 10 Kilometer entfernten Dernau waren es im Juli 1804 sogar unglaubliche 1.000 bis 1.300 Kubikmeter pro Sekunde.
Ein trauriger Rekordwert, der in den folgenden zweihundert Jahren nicht ansatzweise erreicht werden sollte.
Juni 1910: Altenahr
Spitzenabflüsse in Kubikmeter pro Sekunde
Dernau 500 bis 650
Deutlich höhere Spitzenabflüsse (als am 2. Juni 2016) konnten Roggenkamp und Herget in Altenahr für den Juni 1910 rekonstruieren.
Ihren Berechnungen zu Folge strömten damals 450 bis 650 Kubikmeter pro Sekunde durch Altenahr.
2. Juni 2016: Ahr
Spitzenabflüsse in Kubikmeter pro Sekunde
Altenahr 236Beim bislang höchsten gemessenen Hochwasser flossen am 2. Juni 2016 236 Kubikmeter pro Sekunde durch die Ahr.
Juli 2021: Hochwasser
Spitzenabflüsse des Hochwassers vom 14. Juli, in Kubikmeter pro Sekunde
Schuld 500 bis 600
Dernau 1.000 bis 1.200
Walporzheim 1.200 bis 1.300"In der historischen Einordung zeigt sich, dass es sich bei dem Hochwasser vom Juli 2021 um eine Wiederholung des Hochwassers vom Juli 1804 handelt", erklärt Roggenkamp.
Damals wie heute war sommerlicher Starkregen der Auslöser des Hochwassers.
"Trotz vergleichbarer Abflussgrößen erreichte das Hochwasser vom Juli 2021 größere Wasserstände als 1804.
In Dernau lag der Wasserstand ca. 1,5 Meter oberhalb des Wasserstandes von 1804.
Die heute dichtere Bebauung des Hochwasserbetts verkleinert die durchströmte Fläche und ließ die Wasserstände lokal überproportional ansteigen."
"Exakte Berechnungen des Spitzenabflusses sind durch das Auftreten von pulsierendem Abfluss erschwert", erklärt Roggenkamp.
"Sogenannte Verklausungen an Brücken und anderen Querbauwerken - durch angespülte Bäume, Autos und andere Trümmerteile - erzeugten Barrieren und ließen den Wasserstand durch Rückstau steigen.
Nach dem Bruch, oder dem Überspülen der Barriere, sank der Wasserstand dann plötzlich."
Nicht nur die angeschwemmten Barrieren brachen unter dem Druck des anströmenden Wasser zusammen, auch wurden zahlreiche Brücken schwer beschädigt oder sogar vollkommen zerstört.
"Das Hochwasser vom Juli 2021 ist als extremes, aber nicht einmaliges Ereignis einzustufen.
Ähnliches hat sich bekanntermaßen bereits in vorindustrieller Zeit ereignet".
Thomas Roggenkamp
"Im Ahrtal wurde wie in vielen anderen Orten in ganz Deutschland in die natürlichen Überschwemmungsgebiete der Flüsse gebaut.
Es ist eine politische Abwägung,
welche Nutzungen innerhalb des Hochwasserbetts zukünftig ausgewiesen werden
und welche Schutzmaßnahmen für die bestehenden Ortslagen im Hochwasserbett getroffen werden sollen."
Obwohl die Unsicherheiten der Extremwertstatistik bei geringem Stichprobenumfang bekannt sind,
wurden die schweren Hochwasserereignisse von 1804 und 1910 in der Beurteilung der Gefährdungsabschätzung nicht berücksichtigt.
Dann kam es zur Flutkatastrophe am 14. Juli 2021.
↑ Organisationschaos im Krisengebiet? | Report Mainz
-
ARD
2021-08-04 de Organisationschaos im Krisengebiet? | Report Mainz
Organisationschaos im Krisengebiet? | Report Mainz
Seit zweieinhalb Wochen kämpfen die Menschen im Ahrtal gegen Schlamm und Chaos.
Unsere Reportage aus dem Flutgebiet zeigt, bei der Organisation der Hilfe läuft einiges schief.
↑ REPORT MAINZ vom 3. August 2021
-
ARD
2021-08-03 de REPORT MAINZ vom 3. August 2021
REPORT MAINZ vom 3. August 2021
↑ Wer zahlt? Und wer ist schuld? - Die Aufarbeitung der Flut
-
Spiegel TV
2021-08-03 de Wer zahlt? Und wer ist schuld? - Die Aufarbeitung der Flut
Wer zahlt? Und wer ist schuld? - Die Aufarbeitung der Flut
Knapp drei Wochen nach der Flut wird die Katastrophe aufgearbeitet.
Wer ist schuld?
Und warum wurden viele Menschen nicht rechtzeitig gewarnt?
Auch die Folgekosten des Hochwassers müssen beziffert werden.
Die Schadenregulierer der Versicherungen sind vor Ort.
SPIEGEL TV mit einer Reportage aus dem Ahrtal.
↑
Hitzewellen und Unwetter
"Das ist Wetter, das aus Klimaveränderungen resultiert"
 solche Wetterszenarien werden wir in den kommenden Jahren deutlich
häufiger erleben
solche Wetterszenarien werden wir in den kommenden Jahren deutlich
häufiger erleben
-
Deutschlandfunk
2021-08-03 de Hitzewellen und Unwetter "Das ist Wetter, das aus Klimaveränderungen resultiert"Wochenlange Hitze oder wochenlang Tiefdruckgebiete und Regen - solche Wetterszenarien werden wir in den kommenden Jahren deutlich häufiger erleben, sagte die ARD-Wetterexpertin Claudia Kleinert.
Im Gespräch mit dem Dlf erläuterte sie, warum festzementierte stabile Wetterlagen Folgen des Klimawandels sind.
Mit solchen Wetterszenarien sei in den kommenden Jahren deutlich häufiger zu rechnen.
"Weil das auch eine Folge des Klimawandels ist, eingefahrene Wetterlagen", so Kleinert.
Von Zufall oder einem Ausrutscher könne man aufgrund der - zum Teil extremen - Wetterereignisse der vergangenen sechs Jahre nicht mehr sprechen, betonte die Wetterxpertin.
↑ Einschläge des Klimawandels oder eher eklatantes Staats- und Behördenversagen?
-
EIKE Europäisches Institut für Klima und Energie
Helmut Kuntz
2021-07-30 de Einschläge des Klimawandels oder eher eklatantes Staats- und Behördenversagen?Im Folgenden geht es nochmals um die jüngste Flutwelle im mittelfränkischen Zenntal und die besonders extreme Flutkatastrophe im Ahrtal als Kommentierung zur "Berichterstattung" darüber in den Nordbayerischen Nachrichten.
Für Leser, welche das Thema laufend verfolgten, nichts Neues, für alle anderen eine Zusammenfassung mit Hintergrundinformation.
Wenn Leitkommentare die Unkenntnis, aber auch die Ideologiefestigkeit der Kommentierenden offenlegen
Oft nimmt die Berichterstattung der Lokalzeitung geradezu groteske Züge an und die Leitkommentare der Redaktion überschlagen sich geradezu mit der Bestätigung und Bekräftigung der "offiziell vorgegebenen" - GRÜNEN - Meinung.
Als Folge bekommt die Redaktion vom Autor ab und zu eine Stellungnahme, um zu zeigen, dass es noch Leser gibt, welche nicht wie die Redaktion, der dpa, unserer Obrigkeit und Annalena bis zur heiligen Greta alles blind glauben.
Diesmal bezieht sich die Stellungnahme auf zwei Leitkommentare in der Zeitung:
FN vom 16. Juli 2021, Kommentar
"Wenn Wetter lebensgefährlich wird"
und NN vom 17. Juli 2021
"Klima-Katastrophen zwingen uns zum Handeln",
darin Kommentar zu Wetter-Extremen:
"Es muss viel mehr passieren für den Klimaschutz"
Während (nicht nur) die NN-Redaktion die Ursachen der jüngsten Fluten vorwiegend dem angeblich alleine vom Menschen verursachten , sich stetig wandelndem Klima zuordnet, waren beide Fluten im klimahistorischen Kontext zwar seltene, aber trotzdem "erwartbare" Ereignisse.
Dazu kommt, dass beide Fluten mit ihren Schadenshöhen wieder eklatante Versäumnisse - eher Versagen - der Behörden im präventiven Hochwasserschutz offen legten.
↑ Winzer im Ahrtal schwer getroffen
-
Tagesschau
2021-07-30 de Winzer im Ahrtal schwer getroffenDer Bundesrat hat den Weg frei gemacht für die Milliardenhilfen zum Wiederaufbau in den Hochwasserregionen im Westen Deutschlands.
Die Hochwasserkatastrophe hat auch bei Weinbauern in Rheinland-Pfalz enorme Schäden verursacht. Viele Winzer aus dem Ahrtal stehen vor dem Aus - doch Hilfe kommt aus anderen Weinanbaugebieten.
Nach der Flutkatastrophe im rheinland-pfälzischen Ahrtal ist die bevorstehende Weinlese in großer Gefahr.
Von den insgesamt 50 Weinbetrieben an der Ahr seien lediglich vier nicht von der Flut betroffen, sagte der Vorsitzende des Vereins Ahrwein, Peter Kriechel, im Deutschlandfunk.
"Alle anderen sind geschädigt."
Zehn bis 20 Betriebe seien komplett zerstört.
Sehr viele Winzer hätten alles verloren.
Ähnlich hatte sich zuvor auch der Geschäftsführer des Weinbauverbands Ahr, Knut Schubert, im SWR geäußert.
Nach seinen Angaben hat die Katastrophe die meisten Haupterwerbswinzer in Existenznot gebracht.
Ebenso betroffen seien auch die rund 1000 Nebenerwerbswinzer, die ihre Trauben über die drei Winzergenossenschaften an der Ahr in die Kelter bringen.
"Die meisten Weingüter haben einen Totalverlust erlitten", so Schubert.
Keine Räume für Produktion und LagerungProblematisch ist laut Kriechel die bevorstehende Weinlese.
In sechs bis sieben Wochen müssten die ersten Trauben in die Keller gebracht werden.
"Das beschäftigt uns enorm, wie wir das schaffen können", sagte Kriechel.
Weil auch Pressen und andere Geräte zerstört wurden, sind die Winzer im Anbaugebiet auf Hilfe aus anderen Regionen angewiesen, um die Ernte zu sichern.
Laut Winzerin Julia Baltes haben Winzerkollegen von der Mosel Hilfe angeboten.
Baltes sagte im SWR, es gebe Hoffnung für den 2021er-Jahrgang, weil dieser in Betrieben dort produziert werden könne.
Viele Weinbauern an der Ahr haben nach der Flut weder Räume für die Produktion, noch für die Lagerung.
Auch hier hofft Baltes, die diesjährige Ernte bei den Mosel-Winzern im Keller unterbringen zu können.
Die Hilfsbereitschaft unter den Winzern sei riesig, bestätigte auch der Präsident des Deutschen Weinbauverbands, Klaus Schneider, im SWR.
Nicht nur bei Aufräumarbeiten, sondern auch bei nicht aufschiebbaren Arbeiten im Weinberg seien Helfer aus anderen Gebieten an die Ahr geeilt.
Nicht nur Wein wurde zerstört
Von der Flut seien nicht nur Geräte oder Gebäude weggerissen worden, sondern auch gelagerte Weinflaschen früherer Jahrgänge, erklärte Winzervertreter Kriechel.
Alleine dieser Verlust betrage rund 50 Millionen Euro.
Eine ähnliche Zahl nannte auch Verbandsvertreter Schubert:
Er bezifferte den Schaden allein an gelagertem Wein auf 48 bis 50 Millionen Euro.
Auch die Weinberge selbst wurden zerstört.
Mehrere tiefer gelegene Hänge in Ahrnähe wurden nach Angaben des rheinland-pfälzischen Weinbauministeriums völlig zerstört, teilweise auch durch Hangrutsch.
Kriechel bezeichnete den Verlust im Deutschlandfunk als "grausam".
Wenn die Arbeit eines kompletten Jahres verschwinde, sei das ein finanzieller und ein psychischer Verlust.
Er wisse von Kollegen, die nicht mehr weiter machen wollten.
Die Hilfe aus anderen Weinbaugebieten gebe den Winzern jedoch Hoffnung.
"Wir wissen gar nicht, wie wir uns im Nachgang dafür bedanken können", sagte Kriechel.
Der Region stehe ein langer Weg bevor, denn die Wiederherstellung der Infrastruktur, auch für den Weinbau, werde sehr lange dauern.
Der "Rotweinmetropole" soll per Crowdfunding geholfen werden.
Das Anbaugebiet im Ahrtal, das sich selbst "Rotweinmetropole" nennt, ist besonders für seine Spätburgunder bekannt.
Weil die Trauben dort im kostenintensiven Steillagenweinbau kultiviert werden, erzielt der Ahrwein höhere Durchschnittspreise je Liter Wein als andere Regionen.
Bei einer Jahresproduktion von durchschnittlich vier Millionen Litern erzielt das Anbaugebiet einen Umsatz von etwa 32 Millionen Euro im Jahr.
Entsprechend hoch fällt jetzt der Verlust aus.
Mit einer Spendenaktion will der Verein Ahrwein e.V. den Winzern helfen. Noch bis Anfang September können bei einer Crowdfunding-Aktion Flaschen mit Ahrwein im Internet erworben werden, die bei der Flut nicht zerstört wurden.
Die Flaschen der "Flutweine" sind bedeckt mit Schlamm und teilweise ohne Etikett, dadurch gelten sie als Rarität.
Die Einnahmen aus dem Verkauf der von der Katastrophe gezeichneten Weine sollen nach Vereinsangaben den Familienbetrieben im Weinbau und der Gastronomie im Ahrtal für den Wiederaufbau ihrer Existenzen zugute kommen.
↑ Kosten könnten zehn Milliarden Euro betragen
-
Tagesschau
2021-07-20 de Bund plant Hunderte Millionen an SoforthilfeDer Schaden durch die Hochwasserkatastrophe geht in die Milliardenhöhe.
Der Bund will voraussichtlich morgen erste Soforthilfen über 400 Millionen Euro beschließen.
Auch Bayern plant schnelle Unterstützung im eigenen Land.
↑ Warum kam die Warnung so spät?
-
Tagesschau
2021-07-29 de Warum kam die Warnung so spät?Zwei Wochen nach den verheerenden Überschwemmungen im Ahrtal fragen sich viele Menschen, wie es zu dieser Katastrophe kommen konnte.
Warum wurden die Anwohner nicht früher gewarnt?
Hätten Tote verhindert werden können?
Längst stellen sich viele Menschen auch die Frage:
Hätte die Katastrophe verhindert werden können, zumindest die Toten?
Allein in Rheinland-Pfalz sind 134 Menschen ums Leben gekommen,
766 Menschen wurden verletzt und 73 werden noch immer vermisst.
"Glauben sie mir, wie oft ich darüber nachdenke", wird der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz Tage nach dem Unglück immer wieder zitiert.
Natürlich hätte man evakuieren können, aber das sei nicht seine Entscheidung gewesen, sondern die des Kreises.
"Nur der Landrat und der zuständige Brand- und Katastrophenschutzinspekteur hätten das aus der Erfahrung von 2016 wissen können", so der Innenminister gegenüber der Presse.
Eine Katastrophe mit Ansage?
2016 war das letzte Hochwasser, aber nicht das einzige.
Damals stieg das Wasser der Ahr von normal 90 Zentimetern auf 3,79 Meter.
Zahlreiche Keller, Straßen und Brücken waren überschwemmt.
Die Folgen waren verheerend.
Doch sollte es dieses Mal schlimmer kommen.
Bereits am 8. Juli 2021 - sechs Tage vor der Katastrophe - hatte das Europäische Hochwasserwarnsystem eine hohe Wahrscheinlichkeit von Überschwemmungen vorausgesagt.
Am 12. Juli 2021 informiert der Deutsche Wetterdienst (DWD) mehr als 100 Kontakte in Rheinland-Pfalz, darunter Kreisverwaltungen und Feuerwehren.
Am nächsten Tag verstärkt der DWD seine Warnung:
"Die nächsten Tage haben es in sich.
"Am späten Nachmittag des 14. Juli gegen 17.17 Uhr misst der Pegel der Ahr 2,78 Meter.
Das Landesamt für Umwelt ruft die höchste Warnstufe aus.
Um 17.40 Uhr trifft sich der Krisenstab um den Landrat in der Kreisverwaltung in Bad Neuenahr-Ahrweiler.
Gegen 19.30 Uhr verlässt Innenminister Lewentz den Krisenstab.
Tage später wird er sagen, zu dem Zeitpunkt hatte er den Eindruck, alles sei vorbereitet.
Es seien dort erfahrene Leute, die auch das Hochwasser 2016 bewältigt hatten.
Schlüsselmoment um 19.09 Uhr
Um 19.09 Uhr sei für ihn ein Schlüsselmoment gewesen, erzählt Landrat Jürgen Pföhler später einer Zeitung.
Zu dem Zeitpunkt habe der DWD seine Prognose für den Pegel Altenahr kurzzeitig von fünf auf gut vier Meter herunterkorrigiert.
"Das muss man wissen", so der Landrat. Allerdings korrigierte der DWD die Ansage rasch wieder.
Eine Korrektur, die bei den Verantwortlichen des Krisenstabs offenbar nicht ankam.
Kurz nach 20 Uhr kündigt das Mainzer Landesamt für Umwelt (LfU) für die frühen Morgenstunden am nächsten Tag eine Flutwelle von sieben Metern an.
Um 20.56 Uhr twittert der Kreis Ahrweiler, dass es Hochwasser und Starkregen an der Ahr gebe.
Der aktuelle Pegelstand sei 5,09 Meter.
Mit weiteren Sturzfluten sei zu rechnen.
Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden.
Eine Leserin schreibt mit Verweis auf die Daten des LfU: " 575cm größer als ein Jahrhunderthochwasser!"
Wie hoch die Flutwelle tatsächlich kam, lässt sich später nur in Computermodellen nachzeichnen, denn gegen 20.45 Uhr wurde der Pegel beim Stand von 5,75 Meter aus den Fluten weggerissen.
Verzweifelte Hilferufe von Nachbarn
Dennoch vergehen mehr als zwei Stunden bis um 23.09 Uhr die Anwohner entlang der Ahr die Aufforderung bekommen, 50 Meter rechts und links des Flusses ihre Häuser zu räumen.
Viel zu spät, sagen die Bewohner von Bad Neuenahr-Ahrweiler.
Zu diesem Zeitpunkt hören sie schon längst die verzweifelten Hilferufe von Nachbarn.
Nicht alle werden sie später lebend wiedersehen.
Am Tag nach der Katastrophennacht spricht Landrat Pföhler von einer "absoluten Katastrophe".
Die Konzentration liege nun darauf, Menschen zu retten und Bergungen vorzunehmen.
Dann ist er für zehn Tage nicht zu sehen.
"Gegenseitige Schuldzuweisungen helfen nicht"
Die Landesbehörden übernehmen auf Bitten des Kreises die Einsatzleitung vor Ort.
Am 26. Juli 2021 äußert sich Pföhler in einem Interview mit der Rhein-Zeitung:
"In dieser Situation sage ich ganz klar:
Gegenseitige Schuldzuweisungen helfen uns überhaupt nicht weiter."
Und: "Nach meinem Eindruck reagierten alle zuständigen Behörden, der DWD, der Hochwassermeldedienst Rheinland-Pfalz, der Kreis Ahrweiler und alle Katastrophenschutzeinheiten unverzüglich und warnten die Bevölkerung zu unterschiedlichen Zeitpunkten."
Was sich dann entwickelt habe, sei eine Ausnahmesituation gewesen, so der Landrat.Bei der Frage, wer wann hätte wie agieren müssen, gehe es nicht um Schuldzuweisung, sagen auch viele Anwohner und Helfer an der Ahr.
Trotzdem sei der Wunsch da, zu erfahren, warum es so lange dauerte, bis der Evakuierungsaufruf kam.
Nur so lasse sich für mögliche künftige Katastrophen daraus lernen.
↑ Nach der Flutkatastrophe: Schweigemoment und Seuchengefahr
-
Tagesschau
2021-07-29 de Nach der Flutkatastrophe: Schweigemoment und SeuchengefahrMit Glockenschlägen und zehn Minuten Schweigen haben die Menschen im Kreis Ahrweiler der Opfer der Hochwasserkatastrophe gedacht.
Amtsärzte warnen vor Versorgungsmängeln und Seuchengefahr.
Das Hochwasser vom 14. Juli hatte das Ahrtal besonders schlimm getroffen.
Mindestens 134 Menschen starben, 73 gelten noch als vermisst.
Gesundheit der Bevölkerung "massiv bedroht"
Auch zwei Wochen nach den verheerenden Fluten in Rheinland-Pfalz kritisieren Amtsärzte erhebliche Mängel in der medizinischen Grundversorgung in den Hochwassergebieten.
Die Situation sei "nach wie vor erschreckend" und in den betroffenen Regionen herrsche Seuchengefahr, sagte die Vorsitzende des Bundesverbands der Ärztinnen und Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes, Ute Teichert, den Zeitungen der Funke Mediengruppe.
Die Gesundheit der Bevölkerung in den Katastrophengebieten sei "massiv bedroht, weil die Infrastruktur nicht funktioniert".
Unter anderem seien in einigen Orten Krankenhäuser und Praxen zerstört worden.
Teichert, die bis 2012 das Gesundheitsamt im flutbetroffenen Landkreis Ahrweiler leitete, erklärte, dass viele Menschen ohne dringend benötigte Medikamente auskommen müssten.
Das sei besonders für Menschen mit Krankheiten wie Diabetes oder Herzleiden ein großes Problem, hieß es in dem Zeitungsbericht.
Nun sei es wichtig, mobile Arzteinheiten zu organisieren und in die Orte zu bringen.
"Reichsbürger" und "Querdenker" behindern Hilfsarbeiten
Auch die Bundespolizei übermittelte der Regierung einen alarmierenden Bericht zur Lage in den Hochwassergebieten in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz.
Laut einem Bericht der "Bild"-Zeitung wird darin die "Versorgung der Bevölkerung insgesamt als problematisch" bewertet.
Viele Betroffene seien "stark traumatisiert" und "die Akzeptanz gegenüber den Einsatzkräften sinkt stetig".
In Rheinland-Pfalz behindern dem Bericht zufolge, "Reichsbürger in polizeiähnlicher Uniform" die Hilfsarbeiten, wie die "Bild"-Zeitung zitiert.
Die Leute versuchten demnach "Einsatzkräften Platzverweise zu erteilen" - und so die Aufräumarbeiten zu behindern.
Zuvor hatte es bereits Berichte gegeben, wonach in den Katastrophengebieten Helferinnen und Helfer beschimpft oder mit Müll beworfen wurden, unter anderem von sogenannten Querdenkern.
Mehr als 30 Schulen im Kreis beschädigt
Die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig traf sich in Burgbrohl im Kreis Ahrweiler mit Schulleitern, um einen ersten Eindruck von den Schäden zu bekommen.
Demnach seien mehr als 30 Schulen von den Unwettern beschädigt worden. "17 davon sind so schwer betroffen, dass wir nicht davon ausgehen, dass sie bis zum Anfang des neuen Schuljahres wieder starten können", sagte Hubig bei tagesschau24.
"Insgesamt gehen wir von einem Schaden im dreistelligen Millionenbereich aus."
Nun müsse unter anderem mit Schulträgern, Schulaufsicht sowie dem Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung geschaut werden, wie es nach den Sommerferien weitergehen könne, sagte Hubig.
Der derzeitige Plan sei, dass Klassen der zerstörten Schulen übergangsweise auf andere Schulen in benachbarten Orten gehen können.
Neben dem Wiederaufbau von Schulgebäuden müsse man sich auch um Schüler und Lehrer kümmern, die das Erlebte verarbeiten müssten, betonte Hubig.
Der Schulstart nach den Ferien werde daher begleitet von schulpsychologischen Angeboten.
Die Sommerferien enden dieses Jahr in Rheinland-Pfalz am 27. August.
Brücke des THW in Bad Neuenahr-Ahrweiler fast fertig
Die neue Behelfsbrücke des Technischen Hilfswerks (THW) im stark von der Flut betroffenen Bad Neuenahr-Ahrweiler ist inzwischen fast fertig:
Im Laufe des Tages sollte die über die Ahr gebaute Stahlkonstruktion die andere Uferseite erreichen, sagte ein Sprecher vom THW.
Voraussichtlich am Samstag werde die 52 Meter lange Brücke eröffnet.
Nach Asphaltarbeiten an beiden Seiten für die Zufahrten könne die Brücke dann wohl ab Anfang nächster Woche befahrbar sein.
Die zweispurige Brücke wird nach Angaben des THW auch für den Schwerverkehr geeignet sein.
Sie ist seit vergangenem Wochenende im Bau und nach Angaben des Sprechers die größte Brücke, die das THW bislang in Deutschland gebaut hat.
Wenn sie fertig ist, werde sie ein Gewicht von 150 Tonnen haben. Die geplante Standzeit betrage vier Jahre.
Bei der Hochwasserkatastrophe am 14./15. Juli waren im Ahrtal mehr als 60 Brücken zerstört worden.
In Bad Neuenahr-Ahrweiler sei nur eine Brücke intakt geblieben, sagte der Sprecher.
Die neue THW-Brücke wurde in Bad Neuenahr-Ahrweiler dort gebaut, wo vorher die Landgrafenbrücke gestanden hatte.
Nach Angaben des Sprechers sind derzeit fünf weitere Brücken des THW im Ahrtal geplant:
Drei Fußgängerbrücken mit einer Länge von je 40 Metern und zwei weitere Fahrbrücken à je 50 Meter.
↑ Nach dem Hochwasser: Schwere Vorwürfe gegen den Wupperverband
-
Die kalte Sonne (Fritz Vahrenholt & Sebastian Lüning)
2021-07-29 de Nach dem Hochwasser: Schwere Vorwürfe gegen den WupperverbandZunächst eine Nachlese zur westdeutschen Flutkatastrophe.
Bitte auf den Link klicken, um jeweils den kompletten Artikel zu lesen.
Der Deutsche Wetterdienst gab am 21. Juli 2021 eine Information zum Hochwasser heraus:
Dieser Text liefert eine Beschreibung der Wetter- und Ausgangslage, eine Zusammenstellung der beobachteten Niederschlagswerte und eine klimatologische Einordnung, sowie eine Übersicht über die Situation in den Nachbarländern.
Allgemein sind extreme Einzelereignisse zunächst kein direkter Beleg für den Klimawandel.
Nur langjährige Beobachtungen können zeigen, ob die Häufigkeit bestimmter Ereignisse zugenommen hat oder nicht.
↑ Warnungen vor Extremwetter - Klimawandel - Grüne Scheinheiligkeit
-
EIKE Europäisches Institut für Klima und Energie
Christian Freuer
2021-07-29 de Warnungen vor Extremwetter - Klimawandel - Grüne ScheinheiligkeitEinführung des Übersetzers:
In den folgenden beiden Beiträgen geht es um das Hochwasser in Europa Mitte Juli aus amerikanischer Sicht.
Im ersten Beitrag wirft Autor Ken Haapala einen Blick auf das Warnmanagement in Deutschland und spannt einen globalen Bogen, an welchem erkennbar ist, dass das Muster weltweit Anwendung findet.
Im zweiten Beitrag wird ebenfalls in größerem Maßstab am Beispiel des Hochwassers die Scheinheiligkeit der Grünen entlarvt.
Dass diese Herrschaften entsetzliches Leid vieler Menschen für eine politische Agenda missbrauchen, ist höchst verwerflich!
Überschwemmungen und Dürren
Ken Haapala, President, Science and Environmental Policy Project (SEPP)
Die Ahr ist ein relativ kurzer Fluss mit einer Länge von etwa 89 Kilometern, der im steilen Gelände des Rheinlandes an der Grenze zu Luxemburg und Belgien entspringt.
Sie bildet das steile, von West nach Osten verlaufende Ahrtal, das für den Anbau von Rotweinen aus den in den Hang terrassierten Weinbergen bekannt ist.
Bevor sie in den Rhein mündet, wird die Ahr breiter und bietet flacheres Land für den Anbau von Obst und Gemüse.
Wie alle steilen Flusstäler, z.B. in West Virginia, ist auch das Ahrtal von Sturzfluten betroffen.
Das letzte katastrophale Hochwasser ereignete sich im Jahre 1910.
Ab dem 13. Juli kam es zu großen Überschwemmungen in Deutschland und Belgien und in geringerem Ausmaß auch in Holland.
Laut Berichten, unter anderem in der Sunday Times, wussten die Behörden in "Deutschland, dass die Fluten kommen würden, aber die Warnungen haben nicht funktioniert. Wetterwissenschaftler sagen, dass ein 'monumentales Versagen des Systems' direkt für den Tod und die Verwüstung verantwortlich ist, ausgelöst durch den Regen eines ganzen Monats, der in dieser Woche an zwei Tagen fiel."
Aus einem Beitrag vom 23. Juli 2021 über das Europäische Hochwasser-Awareness-System (EFAS):
Welche Informationen hat EFAS in Bezug auf die jüngsten Hochwasserereignisse in den Flussgebieten von Rhein und Maas geliefert?
Am 9. und 10. Juli zeigten die Hochwasservorhersagen des European Flood Awareness System (EFAS) des Copernicus Emergency Management Service eine hohe Wahrscheinlichkeit von Überschwemmungen für das Rheineinzugsgebiet an, die die Schweiz und Deutschland betreffen.
Am darauffolgenden Tag zeigten die Vorhersagen auch eine hohe Hochwasserwahrscheinlichkeit für das Einzugsgebiet der Maas an, die Belgien betraf.
Das Ausmaß der prognostizierten Überschwemmungen für das Rheineinzugsgebiet nahm in diesem Zeitraum deutlich zu.
Die ersten EFAS-Meldungen für das Rheineinzugsgebiet wurden ab dem 10. Juli an die zuständigen nationalen Behörden versandt.
Die ersten EFAS-Meldungen für das Einzugsgebiet der Maas wurden ab dem 12. Juli an die zuständigen nationalen Behörden gesendet.
Mit den laufend aktualisierten Vorhersagen wurden in den folgenden Tagen bis zum 14. Juli mehr als 25 Meldungen für bestimmte Regionen des Rhein- und Maaseinzugsgebietes verschickt.
Nach der Flut wurde sofort der Klimawandel-Chor aktiv und machte den durch Kohlendioxid ausgelösten Klimawandel verantwortlich - ohne jeden Beweis.
Deutsche Beamte plapperten die gleiche Ausrede nach und behaupteten auch, dass die EFAS nur große Flüsse abdeckt.
Die Antwort der EFAS war:
"Sagt EFAS Hochwasser nur für große Flüsse voraus?
"EFAS zielt darauf ab, Hochwasser für große Flüsse und ihre Nebenflüsse vorherzusagen, bietet aber auch Sturzflutvorhersagen für kleinere Flüsse.
Im Fall der Hochwasserereignisse an Maas und Rhein zeigten sowohl die Vorhersagen für die großen Flussabschnitte von Rhein und Maas als auch die Sturzflutvorhersagen für viele der kleinräumigen Nebenflüsse dieser Flussgebiete eine hohe Wahrscheinlichkeit für Hochwasser bzw. Sturzflut an."
Warum haben die Beamten die Warnungen des European Flood Awareness System (EFAS) ignoriert?
Man kann nur spekulieren, aber es könnte das gleiche Problem sein, warum die Beamten von New Orleans keine Evakuierung der Stadt anordneten, bevor Hurrikan Katrina die Überflutung der Stadt durch den Pontchartrain-See verursachte.
Sie hatten Angst vor einem falschen Positiv - die Stadt zu evakuieren und keine Überschwemmung zu haben.
Die Beamten gaben dann dem Klimawandel und der Bush-Regierung die Schuld für ihr Versagen.
Es gibt ähnliche Probleme mit der Dürre in den westlichen US-Staaten.
Vor vier Jahren gab es in vielen westlichen Staaten starke Regenfälle.
Zum Beispiel floss Wasser über den Notüberlauf des Oroville-Damms in Kalifornien, selbst nachdem der Hauptüberlauf repariert und in Betrieb war.
Das Wasser führte zur Überflutung von Gemeinden flussabwärts.
Die Überschwemmung wurde dem vom Menschen verursachten Klimawandel zugeschrieben.
Jetzt wird die Dürre auf den vom Menschen verursachten Klimawandel geschoben.
Für Regierungsbeamte ist es viel einfacher, dem Klimawandel die Schuld zu geben, als die Verantwortung dafür zu übernehmen, dass sie nicht rechtzeitig oder unangemessen gehandelt haben.
Diese falschen Behauptungen führen zu dem Irrglauben, dass eine Reduzierung der Kohlendioxid (CO₂)-Emissionen extreme Wetterereignisse verhindern wird.
Dabei gibt es gar keinen kausalen Zusammenhang zwischen CO₂ und extremen Wetterereignissen.
Tatsächlich sind extreme Wetterereignisse ein Merkmal eines sich abkühlenden Klimas.
-
Watts UP With That? (Anthony Watts)
2021-07-26 en The Week That Was: 2021-07-24Floods and Droughts:
The Ahr River is a relatively short river roughly 89 kilometers (55 mi) arising in the steep terrain of Rhine Land, Germany, which borders Luxembourg and Belgium.
It forms the steep Ahr Valley running east, noted for producing red wines from vineyards terraced in the hillside.
Before emptying into the Rhine River, the Ahr broadens out providing flatter land for growing fruits and vegetables.
Like all steep river valleys, such as those in West Virginia, the Ahr Valley is subject to flash floods.
The last catastrophic one was in 1910.
Beginning July 13, major flooding occurred in Germany and Belgium and to a lesser degree in Holland.
According to reports, including The Sunday Times, officials in "Germany knew the floods were coming, but the warnings didn't work.
Weather scientists say a 'monumental failure of the system' is directly to blame for the death and devastation triggered by a month's worth of rain that fell in two days this week."
According to a July 23, 2021, post on the European Flood Awareness System (EFAS)
What information did EFAS provide in relation to the recent flood events affecting the Rhine and Meuse river basins?
On 9 and 10 July, flood forecasts by the European Flood Awareness System (EFAS) of the Copernicus Emergency Management Service indicated a high probability of flooding for the Rhine River basin, affecting Switzerland and Germany.
The following day, subsequent forecasts also indicated a high risk of flooding for the Meuse River basin, affecting Belgium.
The magnitude of the floods forecasted for the Rhine River basin increased significantly in this period.
The first EFAS notifications for the Rhine River basin were sent to the relevant national authorities starting on 10 July.
The first EFAS notifications for the Meuse River basin were sent to the relevant national authorities starting on 12 July.
With the continuously updated forecasts, more than 25 notifications were sent for specific regions of the Rhine and Meuse River basins in the following days until 14 July.
After the flood, the climate change chorus immediately sprang into action, blaming carbon dioxide-caused climate change, without evidence.
German officials parroted the same excuse, also claiming that EFAS covers only large rivers.
The response from EFAS was:
"Does EFAS forecast floods only for large rivers?
"EFAS aims at predicting floods for large rivers and their tributaries but provides as well flash flood predictions for smaller scale rivers.
In the case of the Meuse and Rhine river flood events both, predictions for the large-scale river sections of the Rhine and Meuse as well as the flash flood predictions for many of the small-scale tributaries of these river basins indicated a high probability of flooding or flash flooding, respectively."
Why did officials ignore warnings from the European Flood Awareness System (EFAS)?
One can only speculate, but it may be the same problem as to why New Orleans officials did not order evacuation of the city before hurricane Katrina caused flooding of the city through Lake Pontchartrain.
They were afraid of a false positive - evacuating the city and not having a flood.
The officials then blamed climate change and the Bush Administration for their failure.
We are seeing similar issues with the drought in the US western states.
Four years ago, many western states experienced heavy rains.
For example, water flowed over the emergency spillway Oroville Dam in California, even after the main spill was repaired and operating.
The water caused flooding of communities downstream.
The flooding was blamed on human-caused climate change. Now the drought is blamed on human-caused climate change.
For government officials, it is far easier to blame climate change than to accept responsibility for failure to act when appropriate or to acting inappropriately.
These false claims give rise to the false belief that cutting carbon dioxide (CO₂) emissions will prevent extreme weather events.
The deception is twofold.
First, there is no causal link between CO₂ and extreme weather events.
The second deception is that reducing CO₂ would result in cooling, with a subsequent reduction of extreme weather events.
In fact, extreme weather events are a characteristic of cooler climate.
Die Grünen drohen uns mit Überschwemmungen, versagen aber beim Schutz vor denselben
David Wojick
Die verheerenden Überschwemmungen in Europa offenbaren eine unglaubliche Heuchelei in der grünen Agenda.
Sie wollen unsägliche Summen ausgeben, angeblich um natürliche Überschwemmungen zu verhindern, indem sie die Emissionen reduzieren.
Aber sie geben nichts aus, um sich auf dieselben Überschwemmungen vorzubereiten, von denen sie prophezeien, dass sie noch schlimmer werden!
Dieser eklatante Punkt wird vom CLINTEL-Präsidenten Professor Guus Berkhout in einem Brief, der von der größten niederländischen Zeitung veröffentlicht wurde, ziemlich deutlich gemacht.
Der Hauptsitz von CLINTEL befindet sich in den Niederlanden, und Berkhout beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit dem Thema Überschwemmungen.
Hier ist ein Auszug, der die Sache auf den Punkt bringt:
"Die Situation flussabwärts entlang der Küste und der großen Flüsse meines Landes ist ziemlich in Ordnung und hat dafür gesorgt, dass es keine Verluste gab.
Stromaufwärts muss jedoch noch viel Arbeit an den Kanälen, Nebenflüssen und lokalen Bächen geleistet werden.
Diese Arbeiten wurden von grünen Politikern stark verzögert, die die Regierung zwingen, alle Ressourcen für die CO₂-Reduzierung auszugeben.
Das Ergebnis ist, dass das Leben im Südosten der Niederlande für einige Zeit völlig gestört ist.
Bereits bei den großen Überschwemmungen Anfang der 1990er Jahre haben wir die Mängel im Oberlauf zur Kenntnis genommen.
Wir haben auch schon damals gesehen, dass sich die verantwortlichen nationalen und lokalen grünen Politiker vor ihrer Verantwortung gedrückt haben, indem sie die Schuld auf die CO₂-Emissionen schoben.
Jetzt, nach 30 Jahren, hat sich nichts geändert.
Wieder behaupten die grünen Europapolitiker, sie seien nicht schuld an den Opfern und Schäden, sondern die Bürger und Unternehmer, die sich geweigert haben, das grüne Klimanotspiel mitzuspielen, seien die Schuldigen - eine dreiste Art, das eigene Versagen zu verschleiern."
Wenn Überschwemmungen zu erwarten sind, warum wird dann nicht darauf vorbereitet?
Der Trugschluss ist lächerlich offensichtlich.
Dennoch skandieren die Beamten, die eindeutig die Schuld tragen, gemeinsam "Klimawandel, Klimawandel, Klimawandel", als ob sie das irgendwie vom eklatanten Versagen entbinden würde.
Professor Berkhout beschreibt diesen Übelstand so:
"Wenn wir jedoch die kalten, harten Fakten betrachten, sehen wir, dass - im Gegensatz zur Klimamitigation (weniger CO₂) - die Klimaanpassung (Schutzmaßnahmen) in den letzten Jahrzehnten eine spektakuläre Reduzierung der Klimaopfer gebracht hat.
Warum haben die grünen Entscheidungsträger nichts aus diesem historischen Anpassungserfolg gelernt?
Sie sind so sehr mit Investitionen in die CO₂-Reduktion beschäftigt, dass erschreckend wenige Ressourcen für wirksame Schutzmaßnahmen bereitgestellt werden."
Wohlgemerkt, dieser kolossale Fehler gilt für die USA genauso wie für die EU.
Die Demokraten wollen Billionen für die Senkung der Emissionen ausgeben und nichts für die Vorbereitung auf die erwarteten Überschwemmungen und Dürren.
Die Entwicklungsländer sind nicht annähernd so dumm.
Sie haben darauf bestanden, dass der Grüne Klimafonds mindestens die Hälfte seiner Mittel in die Anpassung steckt.
Die USA und die EU sind wichtige Geber des GCF.
Sie finanzieren also faktisch überall Anpassung, nur nicht im eigenen Land.
Und natürlich emittieren auch die Entwicklungsländer wie verrückt.
Noch einmal Berkhout:
"Wir wissen auch sehr gut, dass Länder wie China und Indien für den größten Teil der weltweiten CO₂-Emissionen verantwortlich sind und dass sie ihre Emissionen mit Hunderten von neuen Kohlekraftwerken deutlich erhöhen werden.
Beachten Sie, dass der Beitrag der EU nur 6 % und der Beitrag der Niederlande weniger als 0,5 % (!) der weltweiten CO₂-Emissionen beträgt.
Was immer die EU also mit CO₂ macht, es macht wenig Unterschied und für die Niederlande macht es überhaupt keinen Unterschied.
Was jedoch einen entscheidenden Effekt haben wird, ist, das Wasserabflusssystem in Ordnung zu bringen.
Der Erfolg ist garantiert!"
Er fügt dieser Richtlinie einen weiteren Ratschlag hinzu:
"Hören Sie sofort mit der Verbrennung von Holz in Bio ,masse kraft werken auf.
Das unmittelbare Ergebnis ist, dass wir die Luftverschmutzung senken, die Wälder mit ihrer einzigartigen Ökologie retten und große Mengen Wasser in den vorgelagerten Gebieten zurückhalten."
Wir wissen, dass Anpassung kostengünstig und ertragreich ist, während jahrzehntelange Abmilderung nur riesige Kosten verursacht und kein einziges Klimaopfer gerettet hat.
Sind diese Naturkatastrophen in Europa ein Vorspiel für das, was wir erwarten können, wenn wir uns dem "Great Reset" der Klimaalarmisten ergeben?
Es ist an der Zeit umzukehren, bevor es zu spät ist.
-
CFACT Committee For A Constructive Tomorrow
2021-07-26 en The Greens threaten us with floods but fail to protect against themThe devastating European floods reveal an incredible hypocrisy in the green agenda.
They want to spend untold sums, supposedly to prevent natural floods by cutting emissions.
But they spend nothing to prepare for these same floods, which they predict will get worse!
This glaring point is made quite clearly by CLINTEL President, Professor Guus Berkhout, in a letter published by the Netherland's biggest newspaper.
The head office of CLINTEL is based in the Netherlands and Berkhout has been involved with flooding issues for decades.
Here is an excerpt that makes the telling point:
"The downstream situation along the coast and major rivers of my country is pretty much in order and ensured there were no casualties.
However, upstream still a lot of work need be done on the canals, tributaries and local streams.
This work has been seriously delayed by green politicians, who forces the government to spend all resources on CO₂-reduction.
As a result, in Southeast Netherlands life is totally disrupted for some time.
We already took note of the upstream shortcomings during the major floods in the early 1990s.
We also already saw at that time that responsible national and local green politicians were ducking their responsibility by blaming CO₂-emissions.
Now, after 30 years, nothing has changed.
Again, the green European politicians state that they are not to blame for the victims and damage, but claim that the citizens and entrepreneurs, who have refused to play the green climate emergency game, are the culprits - an impudent way to disguise their own failure."
If floods are to be expected, why are they not prepared for?
The fallacy is ridiculously obvious.
Yet the officials who are clearly to blame are chanting together "climate change, climate change, climate change" as though that somehow absolved them of glaring failure.
Here is how Professor Berkhout describes the foolish preoccupation with mitigation:
"However, if we look at the cold, hard facts, we see that - in contrast to climate mitigation (less CO₂) - climate adaptation (protection measures) has brought a spectacular reduction in climate casualties in recent decades.
Why haven't green decision-makers learned anything from this historical adaptation success?
They are so occupied with investments in CO₂-reduction that embarrassingly few resources are allocated to effective protection measures."
Mind you this colossal blunder is just as true of the US as of the EU.
The Democrats want to spend trillions on cutting emissions and nothing on preparing for the expected floods and droughts.
Developing countries are not nearly so stupid.
They insisted that the Green Climate Fund direct at least half its funding to adaptation.
The US and EU are major donors to the GCF.
So, they are in fact funding adaptation everywhere except at home.
And of course, the developing countries are also emitting like crazy.
As Berkhout puts it:
"We also know very well that countries like China and India are responsible for most of the global CO₂ emissions and that they are going to increase their emissions significantly with hundreds of new coal-fired power plants.
Note that the EU contribution is only 6 % and the Dutch contribution is less than 0.5 % (!) of the global CO₂ emissions.
So, whatever the EU is doing with CO₂ it makes little difference and for The Netherlands it makes no difference at all.
What will have a decisive effect, however, is to get the water drainage system in order.
Success is guaranteed!"
He adds another advice to this directive:
"Stop straight away with burning wood in biomass power plants.
The immediate result is that we lower air pollution, we save forests with their unique ecologies and we retain huge amounts of water in the upstream areas."
We know adaptation is low cost and high yield, while decennia of mitigation have only produced huge expenses and never saved a single climate victim.
Are these natural disasters in Europe a prelude to what we can expect if we surrender to the 'Great Reset' of the climate alarmists?
Time to turn around before it is too late.
↑ Kältewelle im August! Temperatursturz mitten in den Hundstagen. Keine Sommerhitze in Sicht!
-
Dominik Jung
2021-07-28 de Kältewelle im August!
Temperatursturz mitten in den Hundstagen.
Keine Sommerhitze in Sicht!
Kältewelle im August!
Temperatursturz mitten in den Hundstagen.
Keine Sommerhitze in Sicht!
Was ist denn nun los? Der August startet richtig frisch.
Nachts sinken die Temperaturen unter 10 Grad, in den Alpen deutet sich in den Tälern sogar Bodenfrost an.
Ist der Hochsommer vorbei, bevor er überhaupt angefangen hat?
↑ Der falsche Fokus auf den Klimawandel
-
Welt / Thomas Mayer
2021-07-28 de Der falsche Fokus auf den KlimawandelZerstörung in Ahrweiler:
Obwohl detaillierte Szenarien vorlagen, wurde Deutschland von dem jüngsten Hochwasser kalt erwischt
↑ Hochwasser: Die CO₂-Panikmache und die Wahrheit
-
Ruhrkultour / Fred F. Mueller
2021-07-27 de Hochwasser: Die CO₂-Panikmache und die WahrheitIn den letzten Wochen hat es in verschiedenen Bereichen Deutschlands und Europas und insbesondere im Bereich der Ahr Hochwasserkatastrophen gegeben, die nicht nur Milliardenschäden, sondern tragischerweise auch bis zu mehr als 200 Menschenleben gefordert haben.
Wenn man bedenkt, dass es schon Tage vorher präzise Warnungen gegeben hatte, fällt es schwer zu verstehen, dass die Wissenschaftler vom European Flood Awareness System (EFAS) mit ihren Vorhersagen kaum Gehör fanden.
Die deutschen Wetterdienste und damit auch die Öffentlich-Rechtlichen Medien warnten zunächst lediglich vor "Starkregen" und gaben - wenn überhaupt - oft viel zu spät Warnungen vor schnell steigendem Hochwasser heraus.
Die Menschen wurden deshalb vielfach unvorbereitet überrascht und konnten oft nicht einmal das Nötigste retten.
Neben zahlreichen Todesopfern wurde die Existenzgrundlage tausender weiterer Anwohner vernichtet.
Umso erbärmlicher ist es,
wenn jetzt in den Tagen nach der Katastrophe gerade diejenigen "Wetter- und Klimapropheten", die hier so offenkundig versagt haben, jetzt von einer "nie dagewesenen" Katastrophe sprechen und die Schuld daran dem angeblich durch CO₂-Emissionen verursachten Klimawandel geben.
Diese ewigen Weltuntergangswarner, die behaupten, sie könnten 50 und mehr Jahre in die Zukunft sehen, haben erst gewarnt, als die Fluten schon fast da waren.
Jetzt versucht man, diese Panne wegzudiskutieren.

Ein Paradebeispiel hierfür lieferte kürzlich
der seit vielen Jahren als Medienliebling überall herumgereichte Vorsitzende des Deutschen Klimakonsortiums Mojib Latif.
In einem Interview mit der FAZ (leider inzwischen hinter einer Bezahlschranke) wurde er direkt gefragt, ob dieses Ereignis eindeutig klima- oder wetterbedingt sei, und lieferte ein Paradebeispiel für Doppelzüngigkeit ab.
Seine Antwort begann er mit dem klassischen "Nein, aber",
um dann mit einem Wortschwall doch mehr oder weniger alles auf den Klimawandel zu schieben.
Da war die Rede von der durch den Klimawandel wärmeren Luft, die mehr Wasserdampf aufnehmen könne, und von dem klimabedingt ebenfalls wärmeren Mittelmeer, dessen Verdunstung für mehr Regen sorgen könne.
Ein wahres Meisterstück waren dann seine Formulierungen zum neuen Modethema der Klimawarner, dem angeblich schwächelnden Jetstream.
Diesen Punkt bezeichnete er als "umstritten, aber wissenschaftlich durchaus plausibel" und sprach von "könnte" und "würden", um dann jedoch zu sagen: "Dadurch kamen die ganzen Wassermassen in einer Region runter".
Man beachte: Beim letzten Satz verzichtete er auf den Konjunktiv.

Dann bewies Mojib Latif kurze Beine
Noch mutiger wurde Herr Latif dann bei der Frage, was denn das Ungewöhnliche an den Überschwemmungen der vergangenen Woche gewesen sei.
Im Einklang mit den Behauptungen zahlreicher Politiker, dass es bisher in der Region noch nie eine Katastrophe dieses Ausmaßes gegeben habe, sagte er laut FAZ: "Es gab bisher materielle Schäden.
Jetzt sterben viele Menschen.
Das war vorher nur in Entwicklungsländern so.
Wenn wir noch die anderen Extreme betrachten, wie zum Beispiel die Hitzewellen mit Rekordtemperaturen, verlassen wir als Menschheit gerade den Wohlfühlbereich.
So langsam wird es gefährlich und ich habe manchmal das Gefühl, die Politik begreift es nicht."
Damit hat er sich sehr weit aus dem Fenster gelehnt.
Schauen wir auf die Tatsachen zum Hochwasser der Ahr.
Es gibt zu seiner Aussage zuhauf Gegenbeweise in Form von historischen Hochwassermarken (Bild1),
Verwaltungsberichten sowie Aufzeichnungen von Heimatforschern.
Die Hochwasserkatastrophen von 1804 und 1910
Das vermutlich katastrophalste Hochwasserereignis der jüngeren Geschichte traf die Orte an der Ahr entgegen der Aussagen der Politik und des Herrn Latif nämlich bereits zu einer CO₂-freien Zeit im Jahr 1804.
Nach den Aufzeichnungen der - damals französischen - Verwaltung wurden 129 Wohnhäuser, 162 Scheunen oder Ställe, 18 Mühlen und acht Schmieden vollständig zerstört.
Darüber hinaus wurden hunderte Häuser, Scheunen und Ställe sowie zwei Mühlen und eine Schmiede schwer beschädigt.
Die Weinberge und Obstbäume im Ahrtal wurden weitgehend zerstört und fast 30 Brücken stürzten ein.
In den Fluten ertranken nicht nur zahlreiche Pferde und Rinder, auch 63 Menschen verloren ihr Leben.
Ein weiteres katastrophales Hochwasser traf die Ahr dann im Jahr 1910.
Obwohl es nicht ganz so schlimm war wie das von 1804, gab es doch immense Schäden an Häusern und staatlichen Bauten sowie Zerstörungen bei der gerade im Bau befindlichen Ahrtalbahn.
Interessanterweise liegen zwischen den beiden damaligen Katastrophen und der jetzigen jeweils etwas mehr als 100 Jahre.
Hat die Intensität dieser Hochwasserereignisse "durch das Klima" zugenommen?
Die Vertreter des "Klimakastrophismus" - von Merkel über Scholz, Schulze, Baerbock, Lindner und Wissler bis zu Mojib Latif und seinen Mitpropheten - treiben derzeit die klimapolitische Ausschlachtung der Katastrophe mit aller Kraft voran.
Es ist halt Wahlkampf, und man muss von den eigenen Versäumnissen ablenken.
Wer darauf nicht hereinfallen möchte,
sollte sich mit der Intensität des aktuellen Ereignisses im Vergleich mit den historischen Vorbildern befassen.
Hierbei helfen zum einen die Aufzeichnungen von Thomas Roggenkamp und Jürgen Herget im "Heimatjahrbuch Kreis Ahrweiler 2015", da sie dort die sogenannten Scheitelabflüsse verschiedener Ereignisse zwischen 1804 und 1920 rekonstruiert haben.
Für die letzten Jahrzehnte und auch für den Beginn der aktuellen Katastrophe stehen detaillierte Aufzeichnungen des Hochwassermeldedienstes des Landesamts für Umwelt Rheinland-Pfalz zur Verfügung.
Auf deren Homepage sind sowohl die Pegelstände als auch die sogenannten Scheitelabflüsse der zehn schlimmsten Hochwasserereignisse der Ahr in den Jahren von 1984 bis 2016 aufgeführt.
Zwar liegen diese Messstellen heute an anderen Stellen als bei den früheren Katastrophenhochwässern, doch sind die räumlichen Abstände gering genug, dass es zulässig erscheint, Vergleiche zu ziehen.
Wichtig ist hierbei weniger der jeweilige Pegelstand, der bekanntlich rein ortsabhängig ist, sondern der sogenannte Scheitelabfluss in Kubikmeter⁄Sekunde (m3⁄s).
Dies ist die beim Höhepunkt der Flutwelle aufgetretene Durchflussmenge und erlaubt Rückschlüsse auf die Wucht und Zerstörungskraft der Strömung.
Übersicht über die Region
Zunächst ist es sinnvoll, sich einen Überblick über die vom Unwetter betroffene Region zu verschaffen, Bild 2
Bild 2
Die Ahr ist ein nur rund 85 km langer Fluss, durch den in friedlichen Zeiten am Pegel Altenahr etwa 8 m3⁄s strömen.
Beim schlimmsten Hochwasser der letzten 40 Jahre im Jahr 2016 waren es bei einem Pegelstand von 371 cm dagegen 236 m3⁄s, also rund 30nbsp;mal soviel.
Zum jetzigen Hochwasser wurde der Pegelhöchststand mit zunächst 575, später mit vermuteten mehr als 700 cm angegeben.
Auf der Homepage des Hochwassermeldedienstes fand sich zur Situation historischer Hochwasserereignisse am Pegel Altenahr folgende Tabelle, Bild 3.
Bild 3. Tabellarische Aufzeichnung von Duchfluss- und Pegelmessdaten für Altenahr (Grafik: Hochwassermeldedienst)
Bild 3
Interessant ist zunächst festzustellen, dass an der Ahr in den letzten ca. 40 Jahren offenkundig weit mehr als zehn Hochwasserereignisse aufgetreten sind, im Schnitt also eines alle vier Jahre.
Die Tabelle erlaubt es, mithilfe von Excel für die vier Flutereignisse, für die sowohl Pegelstand als auch Scheiteldurchfluss aufgeführt wurden, eine recht gute Korrelation zwischen Pegelstand und Scheitelabfluss zu ermitteln, Bild 4.
Bild 4
Zum gleichen Zeitpunkt ließ sich aus der nachfolgend abgebildeten Grafik auf der Homepage des Hochwassermeldedienstes ein Pegelhöchststand von 575 cm ablesen, Bild 5.
Bild 5. Grafische Darstellung der Pegelmessdaten für Altenahr, Zeitangabe 20.7.2021, 13:36 Uhr (Grafik: Hochwassermeldedienst)
Bild 5
Setzt man den aus Bild 5 abgelesenen Pegelstand in die nach Bild 4 ermittelte Gleichung ein, so ergibt sich ein Scheitelabfluss von rund 480 m3⁄s.
Interessanterweise wurde diese Grafik jedoch noch am gleichen Nachmittag um 16:36 Uhr gegen eine andere ausgetauscht, Bild 6.
Bild 6
Über die Gründe für diesen Austausch kann hier nur spekuliert werden.
Nimmt man für die Gleichung jetzt einen spekulativen Pegelwert von 700 cm an, so ergäbe sich nach der obigen Gleichung ein Scheitelabfluss von 629 3⁄s.
Das ist fast das achtzigfache der normalen Wasserführung.
Welches Hochwasser war am schlimmsten?
Die Klimawarner liegen uns ständig in den Ohren, dass uns wegen des von Menschen erzeugten CO₂ in den nächsten Jahrzehnten immer stärkere und schlimmere Wetterkatastrophen bevorstehen.

Herr Latif, als einer der prominentesten unter ihnen, hat im FAZ-Interview unter Bezug auf die Katastrophe in Ahrweiler ausgesagt:
"Es gab bisher materielle Schäden.
Jetzt sterben viele Menschen.
Das war vorher nur in Entwicklungsländern so.
Wenn wir noch die anderen Extreme betrachten, wie zum Beispiel die Hitzewellen mit Rekordtemperaturen, verlassen wir als Menschheit gerade den Wohlfühlbereich.
So langsam wird es gefährlich und ich habe manchmal das Gefühl, die Politik begreift es nicht.
Tatsächlich?
Schauen wir einfach mal auf seinen "Wohlfühlbereich vor dem Anstieg des CO₂", auf die Hochwasserkatastrophen 1910 und 1804.
Dank der Akribie der bereits erwähnten Heimatforscher Thomas Roggenkamp und Jürgen Herget verfügen wir über rekonstruierte Zahlen der Scheitelabflüsse für beide Ereignisse.
Für die Flut von 1910 liegt der Scheitelwert bei 585 m3⁄s.
Dieses Hochwasser war somit in etwa vergleichbar mit dem, welches die Einwohner des Ahrtals jetzt durchmachen mussten.
Beide werden jedoch bei weitem in den Schatten gestellt durch die Katastrophe von 1804, deren Wassermassen mit einem Scheitelabfluss von rund 1.200 m3⁄s fast den doppelten Wert wie die des Jahres 1910 aufwiesen.
Dass der Schaden und der Verlust an Menschenleben diesmal so groß waren, liegt daran, dass in der betroffenen Region heute viel mehr Menschen leben als vor 100 oder gar 200 Jahren und unser Hab und Gut viel mehr Wert hat als damals.
Fakten gegen "follow the science"
Angesichts dieser Fakten zeigt sich, wie schnell die "Wissenschaftler", die uns ständig etwas von der "Klimakatastrophe durch vom Menschen erzeugtes CO₂" weismachen wollen, durch die simple, harte Realität widerlegt werden.
1804 hatte die Menschheit noch so gut wie gar kein "klimarelevantes" CO₂ erzeugt, und auch 1910 war der Anstieg noch vergleichsweise gering.
Diese Klimagurus mit ihren hochtönenden akademischen Titeln und ihrem Getue mit komplizierten Computerprogrammen tun so, als ob sie die Zukunft auf Jahrzehnte oder gar Jahrhunderte vorherberechnen könnten.
Dabei haben sie schon bei der rein praktischen Aufgabe versagt, die Bewohner vor der unmittelbar bevorstehenden Gefahr zu warnen.
Sie, die Politiker und die Journalisten, die ihre Botschaften verbreiten, als seien es endgültige Weisheiten, tragen Verantwortung:
Nicht für die Tatsache der Flut, aber für die fehlende Vorbereitung und die viel zu späte Warnung der Bevölkerung.
Und genau davon wollen sie mit der jetzt massiv einsetzenden Propagandaoffensive für "mehr Klimaschutz" ablenken.
↑ Zwischen Hoffnung, Wut und Trauer: Das Leben nach der Flut
-
Spiegel TV
2021-07-27 de Zwischen Hoffnung, Wut und Trauer: Das Leben nach der Flut
Zwischen Hoffnung, Wut und Trauer: Das Leben nach der Flut
Ein Mann verliert sein Hotel und die Versicherung will nicht zahlen.
Ein Pärchen hat nur noch einen Rucksack und weiß nicht, wie es weitergehen soll.
Und mittendrin: tausende freiwillige Helfer, die Schlamm schippen und Häuser entrümpeln.
Eine Reportage aus den Krisengebieten der Ahr.
↑ Nach der Flut: Sie haben alles verloren
-
WDR Doku
2021-07-27 de Nach der Flut: Sie haben alles verloren
Nach der Flut: Sie haben alles verloren
Über mehrere Tage hat der WDR für diese aktuelle Doku Menschen in drei Orten im Westen bei der Bewältigung der Hochwasserkatastrophe begleitet: in Erftstadt, im Winzerdorf Dernau und in Bad Münstereifel.
In Erftstadt-Blessem tut sich ein riesiger Krater auf, der mehrere Häuser und Straßen verschluckt hat.
Auch das Haus, in dem Sylvia und Christian Schauff bis vor kurzem gewohnt haben, ist darin verschwunden.
Aus ihrer Wohnung konnten sie sich nur noch durchs Hochwasser watend retten - mit ihren beiden Haustieren, einem Hund und einer Katze.
Blessem, das war bis vor kurzem "ihr kleines Paradies", in dem die Nachbarschaft stimmte, Gemüse und Obst angebaut wurde.
Jetzt stehen sie vor dem Nichts.
Und gleichzeitig erfahren sie Hilfe von vielen Seiten.
Viele, vor allem junge Helfer sind gekommen, um mit anzupacken, wo es geht.
Viele Keller in Blessem sind wieder leergepumpt, Häuser entrümpelt, langsam wird die Lage etwas übersichtlicher.
Und bei einigen hat sich die Betroffenheit in Wut verwandelt.
Wie konnte es sein, dass eine Kiesgrube ein derartiges Loch in ihren Ort reißt?
Darüber soll jetzt in einer Bürgerversammlung geredet werden.
Die Gemeinde Dernau am Rotweinwanderweg im Herzen des Ahrtals ist weltberühmt für ihre Weine.
Jetzt sieht es hier teilweise aus wie in einem Kriegsgebiet: Trümmerhaufen, zugeschüttete Gassen, fehlende Häuserfronten, überall Schlamm. Über 120 Tote meldet der Kreis Ahrweiler eine Woche nach der Flut, mehr als 150 Menschen werden noch vermisst.
Dernau hat keinen Strom, kein Trinkwasser, es wird Monate dauern, allein das Nötigste wiederherzustellen.
"Unser Haus ist komplett zerstört", sagt Wolfgang W., der wie viele andere jetzt damit beschäftigt ist, den Schlamm in Eimerketten aus den Häusern zu schippen.
Jeder, der hilft, ist von oben bis unten voll mit Schlamm.
Doch jeden Tag kommen unzählige Helfer:innen nach Dernau, manche aus 400 Kilometer Entfernung.
Im nahegelegenen Ort Gelsdorf liegt das Bauunternehmen von Tobias und David Lanzerath.
In den letzten Tagen haben die beiden Brüder ihre Firma gemeinsam mit Freund:innen und Kolleg:innen in ein Spenden- und Logistikzentrum verwandelt.
Sie alle packen ehrenamtlich mit an.
Sie halten zusammen, um in Dernau zu retten, was zu retten ist.
Als die Wassermengen den Hof von Christin Vongerichten und ihrem Mann in Bad Münstereifel fluten, stehen ihre 40 Pferde plötzlich im Wasser.
Unter Einsatz ihres Lebens holen sie die Pferde aus den Boxen und bringen sie den Berg hinauf, wo sie vor dem Wasser sicher sind.
Die Pferde konnten sie retten, aber die Ranch ist ein Totalschaden, die Halle einsturzgefährdet, die Ställe sind kaputt.
Im mittelalterlichen Bad Münstereifel selbst kämpfen Spezialist:innen zusammen mit den Menschen vor Ort auch um das Gedächtnis ihrer Stadt.
Schränke voller Urkunden, einige über ein halbes Jahrtausend alt, müssen aus dem überfluteten Stadtarchiv geborgen und schnellstmöglich gereinigt und schockgefroren werden.
Einen Steinwurf entfernt wurde der Haushaltswarenladen von Hubert Roth völlig zerstört, er hat rund eine halbe Million Euro Schaden, keinen Versicherungsschutz.
Dafür jede Menge Wut:
"Die versprochene Hilfe ist jetzt schon zu klein dimensioniert, und nach meinen Erfahrungen bleibt es eh bei Versprechungen - Wahlkampfgetöse, sonst nichts!".
Bücherladenbesitzer Josef Mütter ist bewegt von der Hilfe vor Ort:
"Diese Hilfsbereitschaft, diese gelebte Nächstenliebe, die man jetzt überall im Ort sieht, muss das Fundament des Neuanfangs werden."
Angela Merkel und Armin Laschet sprechen an diesem Tag direkt vor seinem Laden.
Von ihnen werden wohl nicht die entscheidenden Impulse kommen, sagt Josef Mütter.
"Mit uns Menschen fängt alles an."
↑ Das Totalversagen der Behörden! Wetterkarten beweisen: Extrem-Unwetter war seit Tagen bekannt!
Die Rheinzeitung aus Koblenz fasst heute das unfassbare Behördenversagen zusammen:
Zwischenzeitlich wurde auf dem Weg zur ganz großen Katastrophe sogar noch Entwarnung gegeben!
Katastrophe mit Ansage!
Ein aktueller Podcast mit unserem Wetterexperten Dominik Jung:
Das aktuelle Wetter für Deutschland vom 19. Juli 2021.
Man hat selten so ein Totalversagen der deutschen Behörden erlebt wie bei dieser Flut-Katastrophe.
Die Archivkarten zeigen eindeutig, dass seit Tagen klar war, was da auf Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz zukommt.
Selbst die Aussage das Wasser sei erst in der Nacht und bei Dunkelheit gekommen kann widerlegt werden.
Das macht einfach nur fassungslos.
Diplom-Meteorologe Dominik Jung fasst die Prognosen im Vorfeld zusammen.
Seit Sonntag war schon klar, dass extreme Regenmengen vom Himmel kommen.
↑ Bad Neuenahr-Ahrweiler: Landesamt sah den Pegelstand von sieben Metern um 20 Uhr voraus - Evakuierungsaufruf erfolgte um 23.09 Uhr
Mit folgendem Link wird von anderen Webseiten auf diese Seite verwiesen.
-
Rhein Zeitung / Dirk Eberz, Manfred Ruch, Angela Kauer-Schöneich und Anke Mersmann
2021-07-27 de Bad Neuenahr-Ahrweiler: Landesamt sah den Pegelstand von sieben Metern um 20 Uhr voraus - Evakuierungsaufruf erfolgte um 23.09 UhrDas Mainzer Landesamt für Umwelt hat am 14. Juli schon um kurz nach 20 Uhr eine Flutwelle von sieben Metern für die frühen Morgenstunden des 15. Juli im Ahrtal vorhergesagt.
Das geht aus einem Diagramm hervor, das unserer Zeitung vorliegt.
Wie der Abteilungsleiter Hydrologie, Thomas Bettmann, auf Anfrage unserer Zeitung bestätigte, ist die Prognose mithilfe von Computermodellen erstellt und dann automatisiert an Landkreise und Katwarn weitergegeben worden.
Gegen 20.45 Uhr wurde demnach der Pegel in Altenahr beim Stand von 5,75 Metern von den Fluten weggerissen.
Ein Vorfall, den der Diplom-Ingenieur noch nie erlebt hat.
Danach fiel die digitale Datenübermittlung aus.
Die Hydrologen des Landesamts mussten deshalb mit Simulationen arbeiten, in die vor allem die Niederschlagsmengen einflossen.
Und es schüttete bis tief in die Nacht hinein fast ohne Unterlass wie aus Eimern. 120 bis 140 Liter pro Quadratmeter, sagt Hydrologe Bettmann.
Nicht die befürchteten 200 - dafür aber flächendeckend und über rund zwölf Stunden.
Hinzu kam, dass der Starkregen auf gesättigte Böden traf, was die Lage zusätzlich verschärfte.
Das Wasser konnte nicht versickern, floss fast komplett ab und türmte sich zu einer gigantischen Flutwelle auf, die wie ein Tsunami durchs enge Tal rauschte.
Auf wie viele Meter die Ahr in dieser verheerenden Katstrophennacht tatsächlich anschwoll, muss das Landesamt noch exakt auswerten.
Denn Messungen ohne Pegel sind für die Wissenschaftler ein Stück weit wie ein Blindflug.
Aber man geht von rund acht Metern aus.
Die Folgen sind katastrophal.
Auch weil erst um 23.09 Uhr die Meldung rausging, einen jeweils 50 Meter breiten Streifen rechts und links des Flusses zu evakuieren.
Viel zu spät.
Und auch viel zu schmal.
Die Flutkatastrophe forderte am Ende mindestens 132 Todesopfer, 74 Menschen werden weiter vermisst.
Was sich da am 14. Juli zusammenbraute, war auf dem Diagramm des Landesamts für Umwelt auch für Laien sehr gut zu erkennen.
Schon am frühen Nachmittag machte die Kurve einen scharfen Knick nach oben.
In den folgenden Stunden verwandelte sich die Ahr von einem harmlosen Flüsschen in einen tödlichen Strom.
Innerhalb weniger Stunden schwoll der Pegelstand bei Altenahr von 90 Zentimetern auf fast sechs Meter an.
Zum Vergleich: Beim Hochwasser von 2016 wurden "nur" gut 3,70 Meter erreicht - mit schweren Folgen.
Um 17.17 Uhr rief das Landesamt für Umwelt schließlich die höchste Warnstufe "lila" aus.
Da stand der Pegel schon bei 2,78 Metern. Um 17.40 Uhr trat der Krisenstab in der Kreisverwaltung um Landrat Jürgen Pföhler und Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Michael Zimmermann zusammen.
Sie mussten hilflos mit ansehen, wie das Wasser stieg und stieg.
Bis sich am frühen Abend plötzlich eine allgemeine Erleichterung breit machte.
Landrat Pföhler sprach im Exklusivinterview mit unserer Zeitung am Sonntag von einem Schlüsselmoment: "Der prognostizierte Pegelstand von fünf Metern wurde um 19.09 Uhr vom Hochwassermeldedienst Rheinland-Pfalz auf gut vier Meter herunterkorrigiert.
Das muss man wissen", sagte er.
Tatsächlich hatte der Deutsche Wetterdienst (DWD) seine Prognosen für den Pegel Altenahr am frühen Abend kurzeitig gesenkt, dies aber rasch wieder revidiert, wie Recherchen unserer Zeitung ergaben.
Doch bei den Verantwortlichen vor Ort kam diese Korrektur offenbar nicht zeitnah an.
Sie gingen offenbar weiter von der trügerischen Annahme aus, dass sich die Lage entspannt hatte.
Das bestätigt auch das Telefonat eines Sinziger Feuerwehrmanns, das von Passanten am 14. Juli gegen 21.30 Uhr zufällig mitgehört wurde.
Demnach war die dortige Feuerwehr darüber informiert worden, dass sich der Scheitelpunkt zu diesem Zeitpunkt bereits in Ahrweiler befinde.
Man rechnete an der Ahrmündung noch mit einem Anstieg der Flut um eineinhalb bis zwei Meter.
Besorgniserregend, aber beherrschbar.
Nach 19.09 Uhr herrschte jedenfalls kollektives Aufatmen im Krisenstab.
"Wenn wir uns mal das sogenannte Jahrhunderthochwasser von 2016 im Ahrkreis anschauen, war damals der höchste Pegelstand 3,71 Meter", erinnert sich Pföhler.
"Da sage ich mal wertend für alle diese Einheiten:
Gut. Damals hatten wir 3,71, jetzt haben wir vier."
Etwa zu der Zeit stieß dann auch Innenminister Roger Lewentz (SPD) zur technischen Einsatzleitung hinzu.
Lewentz sprach von einem ruhig und konzentriert arbeitenden Krisenstab, den er gegen 19.30 Uhr wieder mit dem Gefühl verließ, dass die Lage im Griff sei.
Einen Anlass, die Bevölkerung aus dem Gebiet zu evakuieren, sah man jedenfalls nicht.
"Auch Minister Lewentz hatte keine andere Einschätzung", betonte Pföhler am Sonntag.
Die Folgen waren fatal, denn der Pegel in Altenahr sank nicht.
Ganz im Gegenteil:
Er überschritt sogar die zuvor prognostizierten fünf Meter und schnellte in nicht mal zwei Stunden auf 5,75 Meter hoch.
Danach riss der Pegel selbst ab, die Fluten hatten ihn mitgerissen.
Der Wasserstand veränderte sich somit nicht mehr.
Das fiel in der Einsatzzentrale aber erst später auf.
"Irgendwann gegen 22 Uhr war klar, der Pegel ändert sich nicht mehr, da ist irgendwas", sagte Fachbereichsleiter Erich Seul am Sonntag.
Die Vorhersage des Landesamts für Umwelt hatte allerdings schon zwei Stunden früher gezeigt, welche Wasserwand auf das Ahrtal zurollt.
Warum also sind wertvolle 120 Minuten verstrichen?
Klare Antworten gab es auch am Montag bei einer Pressekonferenz zur Lage im Katastrophengebiet nicht.
Auf dem Podium: Innenminister Lewentz und Landrat Pföhler.
Man wollte offenbar einen Schulterschluss demonstrieren nach Tagen, in denen sich die beiden nicht gemeinsam zur Katastrophe im Ahrtal geäußert hatten.
Noch einmal beschrieb der Landrat, dass alle Beteiligten im Krisenstab zunächst erleichtert waren, aufatmeten - und dann von der Realität überrollt wurden.
"Es war wie ein Tsunami, der alle überfordert hat", bekräftigt Pföhler.
Die Rettungskräfte seien ebenso von der Situation überfordert gewesen wie die Kräfte im Lagezentrum des Landes bei der ADD, "weil es so etwas noch nie in Deutschland gegeben hat".
Worte, die er im Gespräch mit unserer Zeitung später noch mal wiederholte.
An das Land gerichtet, forderte er, dass beim aktiven Hochwasserschutz jetzt endlich etwas getan werden müsse.
"Für mich stellt sich auch die Frage: Müssen wir die Ahr womöglich verlegen?"
↑ Hochwasser Juli 2021: Intensive Niederschläge führten verbreitet zu Überschwemmungen
-
Schweizerische Eidgenossenschaft
Bundesamt für Umwelt BAFU
2021-07-26 de Hochwasser Juli 2021: Intensive Niederschläge führten verbreitet zu ÜberschwemmungenUnwetter, Hochwasser an Flüssen und Überschwemmungen an Seen
Der Juli war in seiner ersten Hälfte nass und das Wetter instabil wie bereits im Juni.
Viele Gewässer erreichten die Gefahrenstufe 3,
mancherorts stiegen die Pegel in die Gefahrenstufe 4 oder gar 5.
Besonders stark betroffen waren der Thunersee, der Neuenburger- und Bielersee sowie der Vierwaldstättersee.
↑
Umweltbischof Lohmann fordert Hochwasser- und Umweltschutz:
 Regenfluten sind Zeichen für Klimawandel
Regenfluten sind Zeichen für Klimawandel
-
Domradio.de
2021-07-24 de Umweltbischof Lohmann fordert Hochwasser- und Umweltschutz:
Regenfluten sind Zeichen für KlimawandelUmweltbischof Rolf Lohmann sieht in extremen Wetterereignissen wie den jüngsten Regenfluten ein "Zeichen eines Wandels des Klimas und der Umwelt".
Beim Klimaschutz dürfe es "nicht länger bei der bloßen Ankündigung politischer Zielmarken bleiben".
Rolf Lohmann (Weihbischof des Bistums Münster und katholischer Umweltbischof)
Derzeit merken wir weltweit, dass sich das Klima grundlegend verändert.
Auch in Deutschland haben wir in den letzten Jahren zum Beispiel mit Hitze und Dürre zu kämpfen gehabt.
Die unfassbare Katastrophe des Starkregens und der Überschwemmungen, die aktuell viele Regionen bei uns so zerstörerisch trifft, sind ein weiterer Ausdruck davon.
Neben dem Klimawandel gehören zu den großen ökologischen Herausforderungen beispielsweise auch die Gefährdung von sauberem Wasser, fruchtbaren Böden und der Biodiversität.
Papst Franziskus hat in seiner Botschaft zum Weltgebetstag für die Schöpfung 2019 eindringlich an uns alle appelliert:
"Wir haben eine klimatische Notlage geschaffen, welche die Natur und das Leben, auch unser eigenes, stark bedroht."
Die Entwicklungen, wie wir sie sehen, sind Zeichen eines Wandels des Klimas und der Umwelt.
↑ Hochwasser-Katastrophe: Aktuelle Lage im Südwesten | SWR Extra 24.07.2021
Am Samstagnachmittag hat in den Krisengebieten in Rheinland-Pfalz erneut Regen eingesetzt.
Die Lage sei aber nicht so verschärft wie vergangene Woche, hieß es.
Freiwillige Helfer müssen die Region verlassen.
Im Laufe des Tages sei laut Deutschem Wetterdienst (DWD) mit örtlichen Niederschlägen im Bereich von maximal 30 bis 40 Litern pro Quadratmeter zu rechnen, teilte die Leiterin des Katastrophenschutzstabs, Begona Hermann, mit.
Stellenweise würden auch nur 10 Liter erwartet.
Ab Sonntagmorgen gegen 6 Uhr könne sich die Wetterlage aber noch verschärfen.
Den besonders betroffenen Kommunen sei daher ein Evakuierungsangebot gemacht worden, sagte Hermann.
In den gefährdeten Orten Schuld, Insul, Dümpelfeld und Bad Neuenahr-Ahrweiler sollen die Menschen demnach mit Shuttlebussen zu einer Notunterkunft in Leimersdorf gebracht werden können.
"Das entscheiden dann die Menschen selbst", so Hermann.
In diesem SWR Extra seht ihr den aktuellen Stand zum Hochwasser in Rheinland-Pfalz.
↑ DER ANDERE BLICK - Die billigste Ausrede nach dem Hochwasser: Der Klimawandel ist an allem schuld
Mit folgendem Link wird von anderen Webseiten auf diese Seite verwiesen.
▶DER ANDERE BLICK - Die billigste Ausrede nach dem Hochwasser: Der Klimawandel ist an allem schuld
-
NZZ / Eric Gujer, Chefredaktor der «Neuen Zürcher Zeitung».
2021-07-23 de DER ANDERE BLICK - Die billigste Ausrede nach dem Hochwasser: Der Klimawandel ist an allem schuldNach einer Flutkatastrophe ist die Versuchung gross, dafür die Erderwärmung verantwortlich zu machen.
Eindimensionale Erklärungen sind jedoch gefährlich.
So spricht einiges dafür, dass der Hochwasserschutz vernachlässigt wurde.
Kanzlerin Merkel tut es, Ministerpräsident Laschet tut es auch und die Grüne Baerbock sowieso.
Alle Parteien mit Ausnahme der AfD fordern als Reaktion auf das Hochwasser mehr Klimaschutz.
Wenn alle Politiker dasselbe sagen, sollten die Bürger misstrauisch werden.
Entweder sind die Forderungen tatsächlich alternativlos, dann fragt man sich allerdings, weshalb Bund und Länder sie nicht längst umgesetzt haben.
Oder die Politiker zeigen mit dem Finger so resolut in die eine Richtung, um von eigenen Versäumnissen abzulenken und in der Stunde der Not Entschlossenheit und Handlungsfähigkeit zu simulieren.
Die dritte Möglichkeit ist eine Mischung aus allem.
Die richtige Antwort auf die Flutkatastrophe fällt nicht so einfach aus, weil die Lage unübersichtlich ist und verschiedene Faktoren beim Entstehen des Hochwassers mitgewirkt haben.
Die Welt ist nun einmal komplizierter, als durch den Matsch stapfende Politiker ihre Wähler glauben machen wollen.
Die Parteien denken, sie hätten jeden Wahlkampf schon verloren, wenn sie komplexe Zusammenhänge zu erläutern versuchten.
Sie halten die Bürger für reichlich einfach gestrickt oder zumindest für unwillig, sich mit Sachverhalten zu beschäftigen, die sich nicht in der Schlagzeile einer Boulevardzeitung zusammenfassen lassen.
Claus Kleber ist ein Meister der Apokalypse
Der Klimawandel begünstigt ohne Zweifel Starkregen, weil warme Luft mehr Feuchtigkeit aufnehmen kann.
Allerdings haben in Deutschland solche sintflutartigen Niederschläge in den Sommermonaten nicht zugenommen.
Eine andere Theorie besagt, der in grosser Höhe von West nach Ost wehende Jetstream werde durch den Klimawandel so beeinflusst, dass er die Ausbreitung von stationären Wetterlagen wie das Tief «Bernd» fördere.
Der Erklärungsversuch ist allerdings unter Meteorologen umstritten.
Eine klare Evidenz gibt es nicht, was das «heute journal» nicht daran hinderte, die Behauptung mehr oder minder als Tatsache auszugeben.
Nicht nur die Politik, auch der öffentlichrechtliche Rundfunk verbreitet das Narrativ:
Der Klimawandel ist an allem schuld.
Ein Meister des Framings ist der ZDF-Moderator Claus Kleber.
Mit apokalyptischem Timbre raunt er von den Naturgewalten, welche den Menschen für den Raubbau an der Schöpfung bestrafen würden.
Kleber verbreitet seine kruden Theorien selbst dann, wenn eine Interviewpartnerin schüchtern darauf hinweist, der Klimawandel spiele sicher eine Rolle, sei allerdings gewiss nicht der einzige Grund für die Überschwemmungen.
Framing ist allemal wichtiger als Fakten.
Warum das so ist, darüber lässt sich nur spekulieren.
Will man in öffentlichrechtlichen Redaktionen den Grünen im Wahlkampf helfen?
Oder regt sich die deutsche Lust an der Romantik mit ihrer Neigung, den Menschen als Störfaktor für eine im Urzustand heile Natur zu betrachten?
Wie sehr sich die Romantik in der deutschen Politik manifestiert, zeigte sich früher in der Angst vor dem Waldsterben oder zeigt sich heute im irrationalen Umgang mit der Atomenergie, deren Beitrag zum Kampf gegen den Klimawandel man wider alles Wissen leugnet.
Von den Vermutungen zurück zu den Tatsachen.
Das besonders verwüstete Ahrtal wurde letztmals 1910 von einer vergleichbaren Flutwelle mit damals 57 Todesopfern heimgesucht.
Verheerende Überschwemmungen sind also im Wortsinn eine Jahrhundertkatastrophe - selten, aber eben doch wiederkehrend.
Helmut Lussi, der Bürgermeister der Gemeinde Schuld, berichtete in der «Welt», die Lage sei ausser Kontrolle geraten, als sich von der Ahr mitgerissene «Campingmobile und Öltanks, grosse Bäume und Autos» in einer Brücke verkeilt hätten.
Daraufhin habe sich das Wasser seinen Weg mitten durch die Ortschaft gesucht.
Haben die Behörden die Gefahrenstellen in den Flusstälern konsequent entschärft?
Die Schilderung erinnert an das Hochwasser in Brig im schweizerischen Bergkanton Wallis im Jahr 1993.
Damals löste Schwemmgut die Katastrophe aus.
Es verstopfte den Durchfluss unter einer Brücke in der Innenstadt, nachdem das Flüsschen Saltina wegen heftiger Regenfälle angeschwollen war.
Die Behörden zogen die Lehren aus der Überschwemmung mit zwei Todesopfern.
Sie bauten nicht nur Rückhaltebecken für das Schwemmgut, sondern auch eine hydraulische Brücke, die bei steigendem Pegel automatisch angehoben wird.
Das System bewährt sich.
Obwohl die Saltina im Oktober 2000 dreissig Prozent mehr Wasser führte als 1993, kam es zu keinen grösseren Problemen.
Ein ähnlicher Weckruf war in der Schweiz das Hochwasser 2005.
Danach investierten die Kantone an Bächen, Flüssen und Seen in den Hochwasserschutz.
So fielen in der letzten Woche die Schäden trotz regional höheren Pegelständen als 2005 deutlich geringer aus.
Es ist natürlich viel leichter, den Klimawandel verantwortlich zu machen, als der Frage nachzugehen, ob Versäumnisse beim Hochwasserschutz das Ausmass der Katastrophe mitverursacht haben.
In den Alpen gehören Schlammlawinen, sogenannte Murgänge, zum Alltag nach starken Regenfällen.
Hat man im Berchtesgadener Land die baulichen Schutzvorkehrungen in den letzten Jahrzehnten kontinuierlich modernisiert?
In engen Tälern wie an der Ahr entwickelt Wasser in Engstellen die reissende Kraft einer Turbine.
Die hydraulischen Effekte, die selbst unscheinbare Bäche innerhalb weniger Stunden zu Todesfallen werden lassen, sind gut erforscht.
Wurden sie in den Mittelgebirgen unterschätzt, weil man Murgänge und Überflutungen als ein Phänomen von Alpen und grossen Flüssen betrachtete?
An Rhein und Mosel hat man nach Hochwassern in den achtziger Jahren viel Geld für mobile Barrieren und andere Vorrichtungen ausgegeben.
Die nächsten Wochen werden zeigen, ob entlang von Ahr und Erft mit gleicher Sorgfalt vorgegangen wurde.
Wenn sich herausstellen sollte, dass die Behörden die letzten Jahre nur unzureichend zur Vorbereitung genutzt haben, werden sich die Landesregierungen der Debatte über die politische Verantwortung stellen müssen.
Verständlicherweise reden Markus Söder, Armin Laschet und Malu Dreyer lieber über die Erderwärmung.
Angesichts der ungewöhnlich vielen Toten wird auch zu klären sein, ob die Frühwarnsysteme funktionierten und ob die Behörden Warnungen rasch genug weitergaben.
Es wird sich zeigen, ob man sich mit Alarmplänen und der Aufklärung der Bevölkerung für den schlimmstmöglichen Fall gewappnet hat.
Erste Stimmen beklagen bereits, Warnungen seien zu spät verbreitet worden.
Mit Erstaunen vernimmt man die Äusserung von Innenminister Horst Seehofer, die Bundesrepublik habe in Gefahrenlagen kein flächendeckendes Sirenensystem, aber auch keine andere Warnvorrichtung.
In der Schweiz ist das in durch Hochwasser gefährdeten Zonen, etwa entlang der Sihl, Standard.
Galt in Deutschland einmal mehr die Devise «Geiz ist geil»?
Laut einer Faustformel verhindert jeder Euro für den Hochwasserschutz knapp drei Euro an Schäden.
Die Investitionen rechnen sich also.
Eine Doppelstrategie gegen die Erderwärmung
Fragen müssen beantwortet und Schwachstellen ausgemerzt werden:
Verbesserungen, die Menschenleben retten und Sachschäden vermeiden.
Was konkret getan werden kann, muss jetzt angepackt werden.
Daher ist es gefährlich, wenn Politiker die Flutkatastrophe vorrangig unter dem Gesichtspunkt der Erderwärmung diskutieren.
Im besten Fall dämpfen die Massnahmen zum Klimaschutz ohnehin nur den Temperaturanstieg der Atmosphäre.
Die Rückkehr zu einem wie auch immer gearteten Status quo ante ist illusorisch.
Mit anderen Worten:
Die bereits eingetretenen Wetterphänomene wie die Häufung von Extremereignissen lassen sich nicht rückgängig machen.
Die Anpassung an die Veränderungen ist unausweichlich.
Der Streit, ob der Klimawandel bekämpft werden muss oder ob die Adaption an die Verhältnisse genügt, ist eine Scheindebatte.
Es braucht beides.
Der Worst Case ist dabei noch gar nicht eingerechnet: dass die europäischen Anstrengungen für einen nachhaltigen Klimaschutz wirkungslos verpuffen, weil der Rest der Welt nicht im gleichen Ausmass mitzieht.
Hier wird ein gravierender Unterschied sichtbar, der in Zukunft noch Kopfzerbrechen bereiten könnte.
Selbst kleinere technische und bauliche Anpassungen an den Klimawandel zeigen im nationalen Rahmen unmittelbar Wirkung, umfangreiche Programme wie das der EU zur Dämpfung des Temperaturanstiegs womöglich nicht.
↑ Volle Talsperren vor Unwetter: Ministerium will Konsequenzen ziehen
-
WDR
2021-07-23 de Volle Talsperren vor Unwetter: Ministerium will Konsequenzen ziehenWeil sie zum Teil schon vorher fast komplett voll waren, konnten die Talsperren in NRW die Regenmassen beim Unwetter nicht auffangen.
Das Umweltministerium kündigt Konsequenzen an.
![]()
![]() Füllstände der Talsperren des Wupperverbandes am 11.07.2021
Füllstände der Talsperren des Wupperverbandes am 11.07.2021

Hochwasser statt Dürre
Zudem verweist Lieberoth-Leden darauf, dass die Talsperren in den Jahren 2018 bis 2020 aufgrund der Trockenheit "extrem niedrig gefüllt waren".
Dieses Jahr habe es stattdessen eine "Aufstauphase" gegeben, weshalb die Talsperren als "ausreichend gefüllt" angesehen worden seien, um mit einem trockenen Sommer klarzukommen.
Dass es nun stattdessen zu einem schweren Hochwasser gekommen ist, sei "völlig außergewöhnlich".
Auch der Wupperverband verteidigt sich.
Im Sommerhalbjahr sei in den Talsperren mit Brauchwasser kein Hochwasserschutzraum vorgesehen, heißt es in einer Erklärung.
Stattdessen solle wegen der zunehmenden Dürresommer möglichst viel Wasser vorgehalten werden.
Und: "Um die Wupper-Talsperre ab Vorliegen einer konkreten Vorhersage für das Wuppergebiet um mehr als die Hälfte zu entleeren, reichte die Zeit nicht aus."
Ein zu schnelles Ablassen des Wassers hätte zu einer Flutwelle noch vor dem eigentlichen Hochwasser geführt.
↑ Nach dem Hochwasser: Schwere Vorwürfe gegen den Wupperverband
-
WDR
2021-07-23 de Nach dem Hochwasser: Schwere Vorwürfe gegen den WupperverbandDie Flut entlang der Wupper hätte weniger dramatisch sein können, wenn die Talsperre besser reguliert gewesen wäre.
Das sagen Anwohner, die nun gegen den Wupperverband klagen.
Zu dem Horror völlig überfluteter Orte kam vergangene Woche zeitweise noch ein weiteres Schreckgespenst:
Einige große Talsperren, die voll gelaufen waren, drohten zu brechen.
Ein schnelles Ablassen des Wassers aber schien ebenso gefährlich, da es zu weiteren Überflutungen hätte führen können.
Auch an den Orten entlang der Wupper herrschte tagelang Zitterpartie:
Die Wuppertalsperre war durch den Regen übervoll, der Druck auf die Talsperrenmauer enorm.
Der Wupperverband entschied schließlich, das Wasser aus dem Stausee schrittweise abzulassen.
Im Unterlauf der Wupper strömte dadurch noch mehr Wasser durch die Orte.
Auch der See im idyllischen Stadtteil Beyenburg schwoll an und überflutete den historischen Ortskern.
Landtagsabgeordneter fordert personalle Konsequenzen
Andreas Bialas, SPD-Landtagsabgeordneter und Bezirksbürgermeister des Örtchens Langerfeld-Beyenburg, erhebt nun schwere Vorwürfe gegen den Betreiber der Wuppertalsperre.
Die Talsperre sei schon vor dem Unwetter viel zu voll gewesen.
"Wie soll sie im Notfall denn noch weiteres Wasser aufnehmen?"
Bialas fordert, dass jetzt eine Staatsanwaltschaft ermitteln müsse, welche Informationen es gegeben habe und wer wann welche Entscheidungen getroffen habe - sowohl zur maximalen Befüllung der Talsperre als auch in den Tagen ab Montag, als sie begann, überzulaufen.
Er forderte personelle Konsequenzen beim Wupperverband.
Im Sommer möglichst viel Wasser stauen
Im Sommerhalbjahr sei außerdem in den Brauchwassertalsperren kein Hochwasserschutzraum vorgesehen.
Im Gegenteil offenbar:
Wegen der zunehmenden Dürresommer soll möglichst viel Wasser vorgehalten werden.
Fakt ist wohl, dass es vergangene Woche innerhalb von 24 Stunden so viel regnete, wie sonst in gut einem Monat.
Dadurch seien den Talsperren so hohe Mengen an Wasser zugeflossen, wie noch nie zuvor.
↑ Ist der Klimawandel schuld an der Flutkatastrophe?
Mit folgendem Link wird von anderen Webseiten auf diese Seite verwiesen.
▶Ist der Klimawandel schuld an der Flutkatastrophe?
-
NZZ / Simon Haas
2021-07-22 de Ist der Klimawandel schuld an der Flutkatastrophe?Starkregen hat es schon immer gegeben, das zeigen historische Wetterdaten.
Durch die globale Erwärmung könnten solche Ereignisse zwar häufiger auftreten.
Die jüngste Hochwasserkatastrophe auf den Klimawandel zu schieben, greift aber zu kurz.
Klimaaktivisten sind sich ihrer Sache sicher:
Die Erderwärmung ist schuld an der Jahrhundertflut, Klimaschutz der beste Katastrophenschutz.
Auch viele Politiker und Medien verwiesen schnell auf den Klimawandel und schoben die Verantwortung für das Hochwasser in Deutschland auf einen fernen Höhenwind über dem Nordatlantik.
In ihren Wetterberichten am Vorabend der Katastrophe hatten dieselben Medien noch über eine verregnete Tomatenernte berichtet (SWR Rheinland-Pfalz) und von «kräftigem Dauerregen» gesprochen (ZDF).
Zu diesem Zeitpunkt lag seit zehn Stunden eine konkrete Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) vor, vom europäischen Hochwasser-Warnsystem Efas bereits seit drei Tagen.
Politik und Medien hätten es besser wissen können.
Denn Hochwasserkatastrophen nach langanhaltendem Starkregen gab es schon immer.
Schon vor dem Klimawandel. Auch im Ahrtal.
Noch kein Trend zu mehr Regen im Sommer
Fakt ist aber:
Die globale Erwärmung führt zu mehr Niederschlag, weil warme Luft mehr Feuchtigkeit aufnehmen kann.
Tatsächlich haben auch in Deutschland die Niederschlagsmengen seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1881 zugenommen.
Nur für den Sommer zeigt sich kein eindeutiger Trend.
Beim Starkregen hingegen ist die Datenlage noch vergleichsweise dünn.
Zwar beobachten die DWD-Klimatologen seit Beginn der Radarmessungen im Jahr 2001 einen Anstieg von langanhaltendem, starkem Niederschlag.
Noch sei der Beobachtungszeitraum aber zu kurz, um Aussagen über das Klima zu treffen.
«Für den Sommer lassen sich derzeit mit den vorhandenen Beobachtungsdaten und den bekannten Methoden keine Trends der Anzahl von Tagen mit hohen Niederschlagsmengen identifizieren», schreibt der DWD in seinem Klimareport.
Für andere Regionen, etwa die Schweiz, ist die Zunahme besser dokumentiert.
Hochwasser im Einzugsgebiet grosser deutscher Flüsse kommen laut einem Bericht des Umweltbundesamts ebenfalls nicht häufiger vor als früher.
Die Daten zeigen allerdings nicht, wie gross das Ausmass des jeweiligen Hochwassers war.
Bild: Hochwasser an deutschen Flüssen haben nicht zugenommen
«Einzelereignisse wie das Hochwasser in Westdeutschland ursächlich auf den Klimawandel zurückzuführen, ist nach wie vor sehr schwierig», betont der Klimaforscher Sebastian Sippel von der ETH Zürich.
Der Einfluss der globalen Erwärmung lässt sich allerdings mit sogenannten Attributionsstudien beziffern.
So konnten Wissenschafter zeigen, dass Starkregenereignisse an der Seine und der Loire im Jahr 2016 durch den Klimawandel etwa doppelt so häufig auftreten.
Für den Starkregen an der Elbe und der Donau im Jahr 2013 gelang ihnen ein solcher Nachweis hingegen nicht.
Für die Flut im Jahr 2021 steht eine solche Studie noch aus.
Mehr Hochwasser - aber nicht zwangsläufig gefährlicher
In Zukunft dürften sich Extremwetter-Ereignisse wie langanhaltender Starkniederschlag aber auch in Deutschland häufen.
Das zeigen Szenarien der Klimaforscher.
Um zukünftige Entwicklungen besser voraussagen zu können, lohnt sich auch der Blick in die Vergangenheit:
Laut einem internationalen Forscherteam um Günter Blöschl von der TU Wien befindet sich Mitteleuropa inmitten einer Hochwasserphase.
Von diesen Phasen gab es in den letzten 500 Jahren insgesamt neun, jeweils in unterschiedlichen Regionen Europas.
Die gegenwärtige Flutphase unterscheidet sich laut der Studie allerdings von ihren Vorgängern:
Früher kam es in Kältephasen zu Überschwemmungen, heute treten sie eher im Sommer auf.
Selbst wenn Hochwasser im Sommer künftig zunehmen, müssen diese nicht zwangsläufig zu mehr Todesopfern und grösseren Sachschäden führen - trotz wachsender Bevölkerung.
Laut einer Studie der Gemeinsamen Forschungsstelle der EU-Kommission sind Sturzfluten und Flusshochwasser global gesehen weniger gefährlich als früher.
Als Grund nennen die Forscher einen funktionierenden Katastrophenschutz wie moderne Frühwarnsysteme.
Anders als beim Klimawandel blieb die deutsche Politik in dieser Frage bisher auffallend wortkarg.
↑ Welche Bedingungen spielen für Starkregen eine Rolle?
-
Kachelmann Wetterkanal
2021-07-27 de Welche Bedingungen spielen für Starkregen eine Rolle?Die beiden kürzlich aufgetretenen Flutereignisse in NRW und Zhenghzou/China wurden durch Starkregen verursacht, das ist bei nahezu jeder Flut der Fall (Schneeschmelze oder Sturmfluten mal ausgenommen).
Allerdings führt nicht jeder Starkregen sofort zu Überflutungen und darüberhinaus gibt es verschiedene Ursachen für Starkregen.
Auf letztere gehe ich hier näher ein.
Um Niederschlag zu bilden braucht es feuchte Luft, die über ihr Kondensationsniveau (Wolkenuntergrenze) und darüber hinaus gehoben wird.
Beim Aufstieg kühlt sie sich ab, zunächst mit rund 1 Kelvin (Grad) pro 100 Höhenmeter, sobald Wolkenbildung auftritt dann noch mit rund 0.4 bis 0.9 K/100m, je nach Temperatur.
Diese Abkühlungsrate nennt man feucht-adiabatischen Temperaturgradient, den brauchen wir gleich nochmal bei der Betrachtung des Temperatureinflusses.
Mit der Abkühlung wird schrittweise Wasserdampf in Form von Wolkentröpfchen (oder -eis) frei, die dann durch verschiedenste Umwandlungsprozesse zu Regentropfen/Schneeflocken/Graupel werden können und umgekehrt.
Wenn sie schwer genug sind, um gegen den Auftrieb in der Wolke nach unten zu fallen, erreichen sie irgendwann den Boden als Niederschlag.
↑ Klimawandel: Ausrede für politisches Totalversagen in der Flutkatastrophe! Neue heftige Gewitter!
-
Dominik Jung
2021-07-22 de Klimawandel: Ausrede für politisches Totalversagen in
der Flutkatastrophe! Neue heftige Gewitter!
Klimawandel: Ausrede für politisches Totalversagen in
der Flutkatastrophe! Neue heftige Gewitter!
Das aktuelle Wetter für Deutschland vom 21. Juli 2021.
Der Klimawandel muss nach der Flut-Katastrophe als Ausrede für ein unfassbares politisches und behördliches Versagen herhalten.
Einfach kaum zu fassen.
Beim Wetter ist zunächst noch Ruhe angesagt, doch ab dem Wochenende geht es schon wieder los.
Neue Unwetter ziehen auf.
Es wird aber nicht flächendeckend Starkregen geben wie am vergangenen Mittwoch.
↑
"Klimawandel" als Ausrede für tödliches Versagen
von Regierung und Behörden?
 Volle Wasserbecken in Erwartung der Dürre?
Volle Wasserbecken in Erwartung der Dürre?
-
EIKE Europäisches Institut für Klima und Energie
Axel Robert Göhring
2021-07-21 de "Klimawandel" als Ausrede für tödliches Versagen von Regierung und Behörden? Volle Wasserbecken in Erwartung der Dürre?Wir stellen drei Fragen:
Sind die mittlerweile über 150 Toten der Rheinlandflut auf krasses Politiker-und Amtsversagen zurückzuführen?
Warum versagten sie?
Wurden Staubecken wochenlang nicht geleert, weil Klima-Alarmisten die Sommerdürre seit Jahren als Standard-Argument verwenden?
↑
 Deutschland wurde präzise gewarnt -
Deutschland wurde präzise gewarnt -
 die Bürger aber nicht
die Bürger aber nicht
-
Der Tagesspiegel
2021-07-21 de Deutschland wurde präzise gewarnt - die Bürger aber nichtEine britische Forscherin erhebt schwere Vorwürfe:
Die Flut sei präzise vorhergesagt worden - doch die Reaktion blieb aus.
Wer ist politisch verantwortlich?
Die ersten Zeichen der Hochwasserkatastrophe in Deutschland wurden bereits neun Tage zuvor von Satelliten erfasst.
Vier Tage vor den Fluten warnte das Europäische Hochwasser-Warnsystem (Efas) die Regierungen der Bundesrepublik und Belgiens vor Hochwasser an Rhein und Meuse.
24 Stunden vorher wurde den deutschen Stellen nahezu präzise vorhergesagt, welche Distrikte von Hochwasser betroffen sein würden, darunter Gebiete an der Ahr, wo später mehr als 93 Menschen starben.
↑ Hydro-klimatologische Einordnung der Stark- und Dauerniederschläge in Teilen Deutschlands im Zusammenhang mit dem Tiefdruckgebiet "Bernd"
-
Deutscher Wetterdienst
2021-07-21 de Hydro-klimatologische Einordnung der Stark- und Dauerniederschläge in Teilen Deutschlands im Zusammenhang mit dem Tiefdruckgebiet "Bernd"Zusammenfassung
Im Zusammenhang mit dem Tief "Bernd" traten in Deutschland und den Nachbarländern insbesondere im Zeitraum 12. bis 15.07.21 regional sehr ausgeprägte Starkregenereignisse auf.
Diese führten insbesondere in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz zu ausgeprägten Überschwemmungen, die Ursache für eine hohe Zahl von Todesfällen und erhebliche Schäden an der Infrastruktur waren.
Dieser Text liefert eine Beschreibung der Wetter- und Ausgangslage, eine Zusammenstellung der beobachteten Niederschlagswerte und eine klimatologische Einordnung, sowie eine Übersicht über die Situation in den Nachbarländern.
↑ Monumentales Staatsversagen: Die Flutkatastrophe hätte verhindert werden können
-
ScienceFiles
2021-07-21 de Monumentales Staatsversagen: Die Flutkatastrophe hätte verhindert werden könnenWar es nicht erstaunlich,
wie schnell die Klima-Krieger versucht haben, das Hochwasser, das entlang von Ahr und Erft gewütet hat, für ihren Klimawandel-Kampf zu instrumentalisieren
und noch bevor die derzeit mehr als 150 Opfer beerdigt sind, politisches Kapital daraus zu schlagen?
Wer bislang nur geahnt hat,
dass Klimawandel-Hysteriker eine Art von Mensch sind, die im moralischen Vakuum lebt, die keinerlei Beziehung zu anderen Menschen herzustellen in der Lage ist, der Empathie nicht einmal als Wort verständlich ist, der weiß es spätestens, seit Klima-Aktivisten gegen die Flutkatastrophe streiken, während Freiwillige vor Ort im Schlamm wühlen.
Die völlige Lebensunfähigkeit und völlige Unfähigkeit, soziale Beziehungen überhaupt aufzunehmen, geschweige denn zu leben, sie war nie so deutlich wie derzeit.
Und nun wirft ein Beitrag, der heute in der Sunday Times erschienen ist,
ein ganz neues Licht auf die Katastrophe, die u.a. die Eifel heimgesucht hat.
Die Katastrophe war vermeidbar.
Die Regierungen von Bund und Ländern und die Verantwortlichen vor Ort, sie haben Warnungen ignoriert,
die schon NEUN Tage vor der Katastrophe ausgesprochen wurden.
↑
"Der wirkliche Grund für die Flutkatastrophe in Deutschland:
Ein "monumentales Scheitern des Warnsystems"
en
The real reason for Germany's flood disaster:
A 'monumental failure of the warning system'
-
EIKE Europäisches Institut für Klima und Energie
The Sunday Times / Christian Freuer
2021-07-20 de Der wirkliche Grund für die Flutkatastrophe in Deutschland: Ein "monumentales Scheitern des Warnsystems"Wetterwissenschaftler sagen, dass ein "monumentales Versagen des Systems" direkt für den Tod und die Verwüstung verantwortlich ist, ausgelöst durch den Regen eines ganzen Monats, der in dieser Woche an zwei Tagen fiel.
-
GWPF The Global Warming Policy Forum / The Sunday Times
2021-07-18 en The real reason for Germany's flood disaster: A 'monumental failure of the warning system'Weather scientists say a 'monumental failure of the system' is directly to blame for the death and devastation triggered by a month's worth of rain that fell in two days this week
↑ Die Flut: Exklusive Reportage aus einem Krisengebiet
-
Der Spiegel
2021-07-20 de Die Flut: Exklusive Reportage aus einem Krisengebiet
Die Flut: Exklusive Reportage aus einem Krisengebiet
Plötzlich kommt das Wasser.
Und es reißt alles mit sich:
Häuser, Autos, Menschen.
Innerhalb weniger Stunden bricht über viele Städte und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz eine Sintflut herein.
Die Bewohner stehen vor den Trümmern ihrer Existenz.
Weil staatliche Hilfe anfangs fehlt, helfen sich die Menschen selbst.
↑ Das Totalversagen der Behörden! Wetterkarten beweisen: Extrem‑Unwetter war seit Tagen bekannt!
-
Dominik Jung
2021-07-20 de Das Totalversagen der Behörden! Wetterkarten beweisen:
Extrem‑Unwetter war seit Tagen bekannt!
Das Totalversagen der Behörden! Wetterkarten beweisen:
Extrem‑Unwetter war seit Tagen bekannt!
Katastrophe mit Ansage! Ein aktueller Podcast mit unserem Wetterexperten Dominik Jung.
↑ Hochwasser in Deutschland: Der Klimawandel als Ausrede für das Versagen beim Katastrophenschutz
Mit folgendem Link wird von anderen Webseiten auf diese Seite verwiesen.
▶Der Klimawandel als Ausrede für das Versagen beim Katastrophenschutz
![]()
![]() Riesige Zerstörungen im Landkreis Rhein-Erft.
Riesige Zerstörungen im Landkreis Rhein-Erft.

-
Nebelspalter / Alex Reichmuth
2021-07-20 de Hochwasser in Deutschland: Der Klimawandel als Ausrede für das Versagen beim KatastrophenschutzDer Klimawandel sei schuld an den vielen Unwetter-Toten, beteuern deutsche Politiker.
Doch jetzt mehren sich Stimmen, die das Versagen der Behörden bei der Katastrophenvorsorge anprangern.
Statt auf die Erderwärmung zu verweisen, hätte man gescheiter Hochwasserschutz betrieben.
Als die Menschen noch als Naturvölker lebten, glaubten sie, die Götter würden sie bestrafen,
wenn Naturgewalten über sie hereinbrachen.
Heute scheint es ähnlich zu sein:
Wenn immer sich Unwetter und Katastrophen ereignen, sind viele Menschen überzeugt, sie hätten sich an der Natur versündigt, und diese würde sich in Form des Klimawandels rächen.
Als Malu Dreyer (SPD), Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Ende letzte Woche in ihr vom Unwetter schwer getroffenes Bundesland geeilt war, sagte sie, eine solche Katastrophe habe die Region noch nie gesehen.
Es gebe nun «keine Zeit mehr zu verlieren beim Klimaschutz», lautete ihre Losung.
Auch Armin Laschet, Ministerpräsident des ebenfalls schwer gezeichneten Bundeslandes Nordrhein-Westfalen und Kanzlerkandidat der CDU/CSU, machte den Klimawandel verantwortlich für die Zerstörungen.
«Das bedeutet, dass wir bei den Massnahmen zum Klimaschutz mehr Tempo brauchen - europäisch, bundesweit, weltweit.» (siehe Artikel hier).
Von Katastrophenschutz sprach er nicht.
«Klimaschutz schneller vorantreiben»
Kanzlerin Angela Merkel (CDU), am Sonntag eilig ins Katastrophengebiet in der Eifel gereist, kam ebenfalls sogleich auf den Klimawandel zu sprechen.
Man müsse künftig den Klimaschutz schneller vorantreiben, «als wir das in den letzten Jahren gemacht haben», mahnte sie.
Immerhin fügte sie an, dass es auch einen besseren Katastrophen- und Hochwasserschutz brauche.
Die Unwetter in Deutschland haben bis jetzt rund 160 Todesopfer gefordert.
Es mehren sich nun die Stimmen, laut denen diese Opfer weniger dem Klimawandel anzurechnen seien, sondern ganz konkret der mangelhaften Katastrophenvorsorge.
Die Behörden werden kritisiert. Scharf kritisiert.
«Auf dem Stand eines Entwicklungslandes»
«Unfassbare Ignoranz ermöglichte erst die Katastrophe», titelte die «Welt» - und schrieb, der Katastrophenschutz in Deutschland sei auf dem Stand eines Entwicklungslandes.
«Ein unglaublicher Skandal.»
Entwicklungsländern wie Bangladesch und Mosambik sei es gelungen, die Zahl der Opfer binnen weniger Jahrzehnte drastisch zu reduzieren, teils mit deutscher Entwicklungshilfe, schrieb die Zeitung.
«Deutschland selbst aber scheitert daran, seine Bürger vor den im globalen Vergleich eher harmlosen Naturereignissen im eigenen Land zu schützen.»
Zu suggerieren, das Unwetter wäre ohne Klimawandel wesentlich anders verlaufen, oder Klimaschutz würde solche Katastrophen verhindern, sei falsch.
«Die Ausrede dient Politikern zur Entlastung von eigener Verantwortung und nützt den Trittbrettfahrern der Klimakrise.»
Bevölkerung nicht rechtzeitig gewarnt
Die Kritik an der Katastrophenvorsorge besteht vor allem darin, dass es solche Hochwasser-Ereignisse in Deutschland in der Vergangenheit immer wieder gegeben habe, die Vorkehrungen dagegen aber ungenügend gewesen seien.
Insbesondere sei die Bevölkerung nicht rechtzeitig und ausreichend vor den anstehenden Wassermassen gewarnt worden.
Schon am Freitag hatte die «Bild»-Zeitung das Versagen des Katastrophenschutzes angeprangert.
«Sirenen blieben vielerorts stumm.
Warndurchsagen gab es kaum.
Lautsprecherwagen blieben zu oft in den Depots.
Und der öffentlich-rechtliche Rundfunk spielte Pop-Musik, als Hunderte Menschen von Fluten hinweggerissen wurden, als Häuser einstürzten, Dörfer niedergewalzt wurden.»
Deutschland könne die einfachsten Dinge nicht mehr, so «Bild».
«Alarmketten sind zerrissen.»
«Erhebliches Systemversagen»
Auch Michael Theurer, Fraktions-Vizevorsitzender der FDP, machte schwere Versäumnisse beim Bevölkerungsschutz geltend.
«Die rechtzeitigen Warnungen der Meteorologen sind weder von den Behörden noch vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk hinreichend an die Bürgerinnen und Bürger kommuniziert worden», sagte er der Deutschen Presse-Agentur.
«Es bietet sich das Bild eines erheblichen Systemversagens.»
Kritik kommt auch aus dem Ausland.
Schon mehrere Tage vor der Katastrophe sei den deutschen Behörden eine Serie von präzisen Prognosen aufgrund von Satellitendaten übermittelt worden, schrieb die britische «Sunday Times».
«Aber obwohl 24-Stunden-Warnungen ziemlich genau voraussagten, welche Landkreise am schlimmsten betroffen werden, wenn der Regen kommt», so die Zeitung, «erwischte die Flut viele ihrer Opfer völlig unvorbereitet».
«Monumentales Versagen»
Von einem «monumentalen Versagen» der Behörden sprach Hannah Cloke, Professorin für Hydrologie an der britischen Reading University.
Sie hätte erwartet, dass Anwohner in Sicherheit gebracht worden wären.
Aber die Bürger hätten die Warnung anscheinend gar nicht erhalten.
«Das ist sehr, sehr ernst», sagte Cloke.
Armin Schuster, Leiter des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, verteidigte das Handeln der Behörden, so gut es ging.
«Unsere Warninfrastruktur hat geklappt im Bund.
Der Deutsche Wetterdienst hat relativ gut gewarnt», sagte er gegenüber ZDF.
«Wir haben 150 Warnmeldungen über unsere Apps, über die Medien ausgesendet.»
Klar sei aber, so Schuster weiter, dass nur ein Teil der Bevölkerung mit Sirenengeheul alarmiert wurde.
«Wer differenziert, wird als Klimaleugner diskreditiert»
Die «Welt» ging im erwähnten Artikel auf einen «Nationalen Warntag» im letzten September ein, an dem die Reaktion von Behörden auf eine simulierte Naturgefahr getestet werden sollte.
Diese Übung habe im Desaster geendet.
«Das Schutzsystem versagte, nicht mal Handy-Meldungen wurden pünktlich verschickt.»
Jetzt räche sich, dass Sirenen abmontiert wurden, deren Heulen früher unmissverständlich auf Gefahren hingewiesen habe.
Doch die Klimadebatte in Deutschland ersticke jeden konstruktiven Diskurs über Umweltgefahren, so die «Welt» weiter.
«Die globale Erwärmung ist hierzulande kein wissenschaftlich-technisches Thema mehr, sondern Teil eines gesellschaftlichen Kulturkampfes.»
Die Warnung vor dem Klimawandel diene der politischen Einordnung, «wer differenziert, wird als Klimaleugner diskreditiert».
↑ Bund plant Hunderte Millionen an Soforthilfe
Mit folgendem Link wird von anderen Webseiten auf diese Seite verwiesen.
▶Bund plant Hunderte Millionen an Soforthilfe
![]()
![]() Nach Unwettern: Bund plant Hunderte Millionen an Soforthilfe
Nach Unwettern: Bund plant Hunderte Millionen an Soforthilfe

-
Tagesschau
2021-07-30 de Kosten könnten zehn Milliarden Euro betragenErste Hilfen für die Flutopfer fließen bereits..
Über die großen Summen muss die Politik aber noch entscheiden.
Ein Hochwasser-Experte rechnet mit einem Bedarf von zehn Milliarden Euro.
Der Bund plant ein Soforthilfe-Paket über 400 Millionen Euro für die Hochwassergebiete in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen.
Das geht aus einem Entwurf des Finanz- und des Innenministeriums hervor, der dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt.
Voraussichtlich soll schon am Mittwoch das Bundeskabinett über die Pläne abstimmen.
Das Geld soll demnach "zur unmittelbaren Beseitigung von Schäden an Gebäuden und der Infrastruktur vor Ort sowie zur Überbrückung von Notlagen" eingesetzt werden, heißt es in dem Papier.
Dabei solle die Summe je zur Hälfte vom Bund und von den Ländern finanziert werden.
Zudem wolle Deutschland Mittel aus dem EU-Solidaritätsfonds beantragen.
In Anbetracht der riesigen Zerstörung fällt die Soforthilfe zunächst recht bescheiden aus.
Während Unternehmen 5000 Euro bekommen, sind die Summen für Privatleute deutlich geringer.
Für die erste Person im Haushalt gibt es 1500 Euro, für jede weitere Person nochmal je 500 Euro.
Die Maximalsumme pro Haushalt liegt bei 3500 Euro.
Diese Regelungen sind in Rheinland-Pfalz und in Nordrhein-Westfalen ähnlich ausgestaltet.
↑ Klimaforscher Mojib Latif: "Jetzt sterben viele Menschen"
-
FAZ Frankfurter Allgemeine Zeitung
2021-07-20 de Klimaforscher Mojib Latif: "Jetzt sterben viele Menschen"Starkregen und Überschwemmungen sind keine neuen Phänomene. Also alles nur ganz normal?
Nicht ganz, erklärt der Meteorologe und Klimaforscher Mojib Latif.
Herr Latif, lässt sich die Frage, ob der extreme Stark- und Dauerregen, den wir derzeit in mehreren Teilen Deutschlands erleben, klima- oder wetterbedingt ist, eindeutig beantworten?
Nein, aber der Klimawandel ist sicherlich ein Faktor von mehreren.
Es muss ja erstmal eine bestimmte Wettersituation vorhanden sein, und die war mit dem Tiefdruckgebiet gegeben.
Es gibt drei Faktoren, die mit der Erderwärmung zusammenhängen und hier eine Rolle gespielt haben.
Zum einen kann durch die höheren Temperaturen mehr Wasserdampf in der Luft gespeichert werden.
Dementsprechend kann auch mehr Niederschlag fallen.
Der zweite Punkt, der bei dieser Lage besonders wichtig war, ist die starke Erwärmung des Mittelmeers.
Das heißt dieses Tief konnte die feuchtwarmen Luftmassen vom Mittelmeer anzapfen.
Das ist eine Folge der globalen Erderwärmung.
Wir haben auch in Studien gezeigt, dass sich die Wetterphänomene gar nicht ändern müssen.
Allein das wärmere Mittelmeer sorgt bei dieser Wetterlage für stärkere Niederschläge.
Der dritte Faktor ist umstritten, aber wissenschaftlich durchaus plausibel.
Wir haben gerade in der Arktis eine ganz besonders starke Erwärmung.
Der Temperaturgegensatz zwischen der Arktis und den Breiten weiter südlich ist geringer geworden.
Dadurch könnte der Jetstream ins Stottern geraten und unsere Wetterphänomene würden nicht mehr so schnell durchziehen und länger an einem Ort verharren.
Dadurch kamen die ganzen Wassermassen in einer Region runter.
↑ Schuld an der Katastrophe war nicht der Klimawandel - sondern Starkregen!
-
Die kalte Sonne (Fritz Vahrenholt & Sebastian Lüning)
2021-07-19 de Schuld an der Katastrophe war nicht der Klimawandel - sondern Starkregen!Die schlimme Flutkatastrophe in Westdeutschland rüttelt weiter auf.
Nachdem die Überschwemmungen zunächst von Aktivisten und Politikern reflexhaft als Produkt des Klimawandels interpretiert wurde, hat sich nun das Blatt gewendet.
Immer mehr Medien hinterfragen nun die Instrumentalisierung der Flut und fordern eine ganz andere Diskussion:
Weshalb haben die Bundesregierung und Regionalverwaltungen trotz Starkregenwarnung bis zu 4 Tage vor der Katastrophe nicht entschiedener reagiert?
Weshalb wurde nicht früher und großmaßstäblicher evakuiert.
Eine britische Expertin für Hochwasserwarnungen zeigt sich enttäuscht, dass die deutschen Behörden hier offenbar gepennt haben.
Die Politik war mehr am aktuellen Wahlkampf interessiert, und kümmerte sich zu spät um das praktische Management vor Ort.
Es ist einfach nicht genug, fragwürdige Thesen von Klimaalarmisten zu verkünden, anstatt rechtzeitig und umsichtig zu handeln.
Wenn vermeintliche Gefahren im Jahr 2100 wichtiger sind, als Katastrophenvorsorge echter Gefahren 2021, dann sagt das viel über die Entscheidungsträger.
Vielleicht rütteln die schlimmen Vorkommnisse die Planer nun endlich wach:
Kümmert Euch um die wahren Probleme, anstatt über eine schönschaurige Klima-Horror-Picture Show der weit entfernten Zukunft zu theoretisieren.
Hier einige wichtige Artikel zum Thema der letzten Tage.
↑
Füllstände
 Hochwasserrückhaltebecken mit mehr als 1,00 Million
m3 Stauraum
Hochwasserrückhaltebecken mit mehr als 1,00 Million
m3 Stauraum
Mit folgendem Link wird von anderen Webseiten auf diese Seite verwiesen.
-
Talsperren Net
de Füllstände von Talsperren in DeutschlandDiese Webseite soll eine Übersicht der Talsperren in Deutschland geben.
Diese wird in Abständen erweitert und aktualisiert.
Es werden alle Talsperren und Hochwasserrückhaltebecken mit mehr als 1,00 Million m3 Stauraum aufgelistet.
↑ Flutkatastrophe 2021: Die wahren Gründe für die Flut
-
Akademie Raddy
2021-07-19 de Flutkatastrophe 2021: Die wahren Gründe für die Flut
Flutkatastrophe 2021: Die wahren Gründe für die Flut
Nachtrag:
Aufgrund der Kritik hat der Wupperverband jetzt gesagt, warum er die Talsperren voll befüllt hat und der Hochwasserschutz daher nicht funktionieren konnte:
"Wir hatten Angst vor Dürren durch Klimawandel, und daher haben wir alle Talsperren gefüllt."
Musste Wuppertal in den Fluten versinken, weil man sich im Klimawahn befindet?
Oder ist dies eine Ausrede, damit Tourismus und Ökostrom funktionieren?
Die Schweiz hat übrigens eine Richtlinie für Talsperren: Talsperren dürfen höchstens zu 80% befüllt sein.
Lokalnachrichten aus Remscheid
Ein Lokalsender aus dem Überschwemmungsgebiet Remscheid führte kurz vor dem Hochwasser ein Interview mit einem GRÜNEN Politiker (Sportdezernent Thomas Neuhaus) und einem Mitarbeiter von "Arbeit Remscheid" am Rande der Wupper-Talsperre.
Dort freut man sich, dass der Wasserstand der Wuppertalsperre extrem hoch ist, was toll für das Tourismusprojekt ist.
Dummerweise scheinen die beiden Jungs nicht zu begreifen, dass eine volle Talsperre keinen Schutz gegen Hochwasser mehr bietet.
↑ Der Druck wächst beim Thema Klimaschutz
-
Tagesschau
2021-07-19 de Der Druck wächst beim Thema KlimaschutzCSU-Chef Söder fordert einen "Klima-Ruck",
Grünen-Kanzlerkandidatin Baerbock einen schnelleren Kohleausstieg
und Umweltministerin Schulze mehr erneuerbare Energien.
Angesichts des Hochwassers ist klar: Klimaschutz muss Priorität haben.
Angesichts der Hochwasserkatastrophe in mehreren Bundesländern steht der Klimaschutz ganz oben auf der Tagesordnung.
Die Politik dringt mehrheitlich auf verstärkte Maßnahmen.
Bayerns Ministerpräsident Markus Söder forderte im ARD-morgenmagazin einen "Klima-Ruck" für Deutschland.
Das Unwetter mit verheerenden Folgen vor allem in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen, aber auch im Südosten Bayerns nannte er einen Weckruf.
↑ TALSPERRE GEÖFFNET ODER NICHT? Flutwelle in Stolberg: Ein Konditor hat alles verloren und klagt an
-
Tichys Einblick
2021-07-19 de TALSPERRE GEÖFFNET ODER NICHT? Flutwelle in Stolberg: Ein Konditor hat alles verloren und klagt an
In Stolberg hat die Flutwelle die Innenstadt verheert.
Ein Konditor, dessen Café zerstört ist, sagt:
Die Betreiber der örtlichen Talsperre haben den größten Schaden zu verantworten, weil sie eine Staumauer zur Unzeit geöffnet hätten.
Die weisen den Vorwurf von sich. Zweifel bleiben.
↑ Keine Krise ungenutzt lassen. Geschichten von der Flut.
-
ZETTELS KLEINES ZIMMER
2021-07-19 de Keine Krise ungenutzt lassen. Geschichten von der Flut.
Die Talsperren sind nicht abgelassen worden, damit sie als Rückhaltebecken dienen konnten - was eigentlich ihr Zweck ist.
↑ Das Versagen beim Hochwasserschutz
-
Klimareporter
2021-07-19 de Das Versagen beim HochwasserschutzNach dem Elbe-Hochwasser 2002 reagierte die rot-grüne Bundesregierung mit einem wirksamen Gesetz zum Hochwasserschutz.
Nicht nur die damalige Opposition aus Union und FDP lehnte die Vorschläge ab, sondern auch die Mehrheit der Bundesländer.
Dieses politische Versagen darf sich nicht wiederholen.
↑ FALSCHE PROPHETEN Faktencheck: Was das Hochwasser wirklich mit "Klima" zu tun hat
-
EIKE Europäisches Institut für Klima und Energie
Dr. Sebastian Lüning
2021-07-18 de FALSCHE PROPHETEN Faktencheck: Was das Hochwasser wirklich mit "Klima" zu tun hatIn mittelalterlichen Zeiten hätte der Priester erklärt, es wäre eine Strafe Gottes gewesen, für das frevelhafte Verhalten der Sünder.
Die heutige Erklärung ist leider nicht weit davon entfernt.
↑ Hat die Warnung vor der Flut nicht funktioniert?
-
Hadmut Danisch / Ansichten eines Informatikers
2021-07-18 de Hat die Warnung vor der Flut nicht funktioniert?Ich halte es für überaus wichtig, nun herauszufinden, warum es hier keine ordentliche Warnung und auch vorher keine Vorbereitung gegeben hat.
Oder man da überhaupt gebaut hat.
Und ob beispielsweise Brücken die Überschwemmungen verursacht haben, wie damals in Dresden.
Und dabei sollte man sich auf keinen Fall vom Klimageschwätz ablenken lassen.
Ich will das wissen, ob das vorher bekannt war, dass das Wasser kommt, und in unfähigen Behörden versackt ist.
Und wenn das so ist, dann würde ich gerne wissen, warum.
Ob man sich mehr um Gender und Quoten als um seine Aufgaben gekümmert hat.
Das wäre mal etwas für Landes- oder Bundestagsanfragen, aber ich weiß noch nicht, in welche Zuständigkeiten das fällt.
Man sollte aber unbedingt nachbohren, auf wessen Konto weit über 100 Tote, Milliardenschäden und ruinierte Existenzen gehen.
Außerdem liegen mir mehrere Hinweise vor, wonach sich keine Sau um die Talsperren und Stauseen gekümmert hat und die alle schon seit Wochen randvoll waren, also nichts mehr aufnehmen konnten.
Vielleicht wollte man auch einfach für die große Greta-Dürre vorsorgen.
Warum können Talsperren und Stausehen überhaupt zu 100 % voll werden und damit keine Notfallreserve mehr haben?
Und warum muss die Feuerwehr aus der bruchgefährdeten Talsperre bei Euskirchen Wasser abpumpen, um Druck von der Mauer zu nehmen?
Stellt Euch mal vor, man hätte 8, 24, 48 Stunden vorher eine konkrete und ernste Warnung bekommen.
Was dann an Menschenleben, Gegenständen, Hab und Gut, Fahrzeugen
hätte gerettet werden können.
In wievielen Häusern es schon gereicht hätte, die wertvollsten Dinge in das erste Obergeschoss zu bringen und die Fahrzeuge auf den Berg zu fahren.
Oder einfach von vornherein die Häuser so zu bauen, dass der Rohbau bis 1. OG sowas aushält?
Hat man die Warnungen ignoriert,
um den Grünen und Fridays for Future im Wahlkampf keinen Ansatzpunkt zu liefern
und kein Affentheater von Greta, Luisa & Co. zu provozieren?
↑ Bürgermeister von Schuld gibt Merkel Kontra
-
Crazy Krauthead
2021-07-18 de Bürgermeister von Schuld gibt Merkel Kontra
Bürgermeister von Schuld gibt Merkel Kontra
Frau Merkel reiste wegen den Hochwasserschäden nach Schuld in der Eifel und gab da natürlich eine Pressekonferenz….
↑ Hochwasser-Katastrophe im Südwesten - Aktuelle Lage | SWR Extra 18.07.2021
Die aktuelle Lage im Südwesten ist weiterhin angespannt.
Im Großraum Ahrweiler in Rheinland-Pfalz ist die Zahl der Todesopfer laut Angaben der Polizei auf mindestens 110 gestiegen.
Zudem gebe es mehr als 670 Verletzte.
Während die Pegelstände mancherorts zurückgehen und die Aufräum-Arbeiten voranschreiten, wird das ganze Ausmaß der Hochwasserkatastrophe vor allem im Nordes des Landes deutlich.
↑ "Die Überflutungen sind eine Hochwasser-Katastrophe mit Ansage gewesen"
-
reitschuster.de
2021-07-17 de "Die Überflutungen sind eine Hochwasser-Katastrophe mit Ansage gewesen"Ich bin betroffen von der Katastrophe in Euskirchen.
Meine Familie hat in Odendorf alles verloren,
wir sind ohne Strom, warmes Wasser, Internet, Telefon oder Mobilfunk, alles an Hab und Gut ist weg.
Ich bin weniger materiell betroffen, aber meine Familie hat es schlimm erwischt.
Ich fange von vorne an:
Die Überflutungen sind eine Hochwasser-Katastrophe mit Ansage gewesen.
Bereits Wochen vor dem Unglück waren die Talsperren randvoll und die Böden so durchnässt, dass kein weiteres Wasser aufgenommen werden konnte.
Die Informationen kann man bei den Talsperren-Ständen überprüfen.
Die Wetterlage mit Dauerregen und Starkregen kann man ebenfalls online überprüfen.
Schon vorher hätte der Katastrophenschutz Wasser abpumpen müssen, um der angekündigten Wetterlage entgegenzuwirken.
Am 14.7. wandelte sich der Dauerregen in Starkregen.
Gullys und Kanäle waren bereits um 18:00 Uhr überflutet und Fontänen schossen, inklusive Teichfischen, aus den Straßen.
Um 19:00 Uhr erreichten mich die ersten Bilder von Odendorf,
das Auto meiner Schwiegertochter und das von deren Mutter schwammen bereits, der kleine Bach hatte sich in ein tosendes, reißendes Gewässer verwandelt, Straßen überflutet, Schienen unterspült.
Das Untergeschoss war geflutet und man flüchtete ins Obergeschoss.
Inzwischen war bereits Euskirchen überschwemmt, Stromausfälle und Kommunikation lagen bereits lahm.
Das Wasser war überall.
Die Fußgängerzone, Parkhäuser, Wohnhäuser, Geschäfte - alles unter Wasser.
In Odendorf drückte das Wasser mit aller Gewalt durch die Decke des Obergeschosses.
Möbel und Elektrogeräte schwammen gegen die Wände, schlugen an die Decke.
Meine Familie flüchtete über den Speicher aus dem inzwischen gefluteten Haus, mit einer 4-Jährigen!
Zu dem Zeitpunkt hing alles an der freiwilligen Feuerwehr.
Kein Katastrophenschutz, keine Bundeswehr.
Das THW und anliegende Bauern mit Güllepumpen waren die einzige Unterstützung.
Der Nachbar meiner Familie ertrank im eigenen Haus.
Am nächsten Tag war das Ausmaß in Euskirchen katastrophal.
Wir waren komplett von der Außenwelt abgeschnitten und Nachbarn halfen sich gegenseitig.
Das schrottreife Inventar wurde aus den Häusern geräumt.
Die Grundversorgung ist tot.
Man brauchte Lebensmittel, aber Geschäfte waren bis auf wenige geschlossen und man konnte nur mit Bargeld bezahlen.
Hat man uns doch während Corona eingetrichtert, dies zu vermeiden.
In der wenig betroffenen Filiale einer Sparkasse war Bargeld-Auszahlung auch 2 Tage nach dem Hochwasser nicht möglich.
So sprangen wieder Nachbarn ein, damit wenigstens Wasser gekauft werden konnte.
Wir haben 500 Meter in 45 Minuten geschafft mit dem Auto, sind dann umgedreht.
Man konnte niemanden erreichen, das Handy-Netz ist bis heute tot.
Odendorf ist nicht betretbar, wir waren nicht informiert, da ja weder Radio noch Fernseher Empfang hatten.
Wenn man denn überhaupt noch ein Gerät hat … in der Zwischenzeit kommt es zu Plünderungen in der Innenstadt.
Ohne Strom keine Sicherheit - diejenigen, die mit leerem Blick Schutt, Schlamm und Müll kehren, sind nicht mehr in der Lage, sich zu wehren.
Das war ein Augenzeugen-Bericht meines Schwagers.
Das Haus ist eine Ruine
Alles liegt in Trümmern, Pflastersteine weggerissen, alle Geschäfte zerstört.
24/7-Sirenen, Rettungskräfte, Hubschrauber, man fühlt sich wie im Krieg.
Man schläft nicht.
Um 4.00 Uhr nachts der erste Empfangsbalken auf dem Handy.
Verzweifelte Versuche, die Familie in Odendorf zu erreichen. Zwecklos.
Kein Empfang.
Endlich die Vermisstenstelle erreicht.
Odendorf wurde evakuiert, aber man hatte keine Listen, wer evakuiert worden ist.
Diese Liste wird aufgenommen aufgrund der Anrufe, die Vermisste melden.
Zwei Tage verzweifelte Suche nach dem Sohn, seiner Frau, ihrer Mutter und meiner Enkeltochter.
Am 16.7. dann endlich gefunden, in einem 15 km entfernten Ort.
Sie haben alles verloren.
Inzwischen ist deren Auto kopfüber auf den Bahnschienen in Odendorf gefunden worden.
Das Haus ist eine Ruine.
Unser "öffentlich-rechtliches Fernsehen" sind Nachbarn und Bekannte, die sich austauschen.
Aber wir haben gehört, wie traurig unsere Kanzlerin ist, wie betroffene Politiker unsere Orte aufsuchen.
Ernsthaft?
Wir wurden nicht geschützt, Hilfe kommt von Anwohnern!
Wir bieten Schlafplätze, organisieren Kleidung und Essen, bereitgestellt von Privatunternehmen, Nachbarn und Freunden.
Wir brauchen kein Mitleid!
Wir brauchen dringend und unbürokratisch Hilfe in Form von Geld!
Man hat hier alles verloren:
Häuser, Autos, Hab und Gut, Fotos, Spielzeug.
Alles!
Wir in den betroffenen Gebieten sind gemeldet, haben eine Steuernummer, über die Soforthilfe verteilt werden kann!
Wir brauchen eine Grundversorgung!
Wie sollen wir Wasser abkochen ohne Strom?
Luisa Neubauer streikt für uns und das Klima?
Bitte lass es sein!
Mach Geld locker, Deine Familie hat genug!
Das Letzte, was wir brauchen, sind springende, unfähige Aktivisten!
Wären wir mit E-Autos hier weggekommen?
Wo hätten wir die laden sollen?
Macht Euch mit Schaufel, Werkzeug und Notstromaggregaten auf zu uns und helft aktiv!
Ich gebe der Politik die Schuld an der Misere.
Wir waren schutzlos und mutwillig der Katastrophe ausgeliefert.
Alle waren vorgewarnt, aber man hat abgewartet und geguckt, wie schlimm es wird.
Jetzt nehmt gefälligst Geld in die Hand und helft den Menschen, die alles verloren haben.
Geld aus Maskendeals, Kindergeld ins Ausland, Geld für ein nutzloses Europa, Geld für China, Indien etc. brauchen jetzt wir!
Mitleid und Diskussionen könnt Ihr Euch schenken.
Sichert unsere Grundversorgung!
Packt mit an!
Wir können jede helfende Hand gebrauchen.
Wir sind traumatisiert.
Jeder hat irgendwen verloren, den er kennt.
Und es ist noch nicht vorbei.
Danke für nichts, gar nichts.
Man kann sich unsere Situation nicht im Entferntesten vorstellen!
Aber ich bin dankbar für den unermüdlichen Einsatz der Helfer!
Ich bin traurig mit den Menschen, die ihre Angehörigen und Freunde verloren haben.
Und ich bin wütend, weil man es vielleicht nicht vermeiden, aber mildern hätte können.
↑ Jesuit Alt ruft zur Bekämpfung des Klimawandels auf: "Das Schlimmste noch verhindern"
-
Domradio
2021-07-17 de Jesuit Alt ruft zur Bekämpfung des Klimawandels auf: "Das Schlimmste noch verhindern"Angesichts der aktuellen Unwetterkatastrophe blickt Jesuitenpater Jörg Alt erschüttert auf den Zusammenhang zum Klimawandel.
Warum er trotz allem glaubt, dass es für einen Systemwechsel noch nicht zu spät ist, erklärt er im Interview.
Die Kipppunkte kommen schneller als vorhergesagt,
aber dennoch müssen wir das Vertrauen haben, dass das, was wir tun, in Gemeinschaft mit anderen und Gottes Hilfe
das Schlimmste noch verhindern kann.
Aber das reicht alleine noch nicht.
Selbst wenn jemand heute vegan wird, kein Flugzeug und kein Auto mehr benutzt.
Es sind nur 25 Prozent, was jeder als Einzelner an seinem ökologischen Fußabdruck reduzieren kann, weil ja letzten Endes Straßen, Infrastruktur, Krankenhäuser und andere Dinge trotzdemwegen uns vorgehalten werden.
Aber was jeder wirklich tun kann, ist, mit seinem Nachbarn zu reden.
Wenn dieser ein Klimaskeptiker ist, kann man ihn davon überzeugen, dass der Klimawandel real ist und dass es gravierende Folgen haben wird, wenn wir nichts tun.
↑ Wuppertalsperre läuft über: Maximale Stauhöhe um Mitternacht überschritten: 14. Juli 2021 23:00
-
NWR Paddlier
2021-07-17 de Wuppertalsperre läuft über:
Maximale Stauhöhe um Mitternacht überschritten:
14. Juli 2021 23:00
Wuppertalsperre läuft über:
Maximale Stauhöhe um Mitternacht überschritten:
14. Juli 2021 23:00
Durch anhaltenden Starkregen erreichte der Stauinhalt der Wuppertalsperre am 14. Juli 2021 um 23:00 das Vollstauziel.
Weshalb der Hochwasserschutzraum binnen kurzer Zeit aufgebraucht war und das Wasser ungehindert über den Überlauf ins Tal stürzte, wo die ersten Wupperorte rasch vom Wasser erreicht wurden.
Zwischen 23:00 und 6:00 strömten jedoch noch über eine Million Kubikmeter Wasser in das Staubecken.
↑ Überlauf Rursee Talsperre in Heimbach in der Eifel am 16.07.2021 inklusive Öffnung des Grundablass
Video über den Überlauf der Rursee Talsperre am 16.07.2021.
Auch eines von zwei Rohren des Grundablasses wurde geöffnet.
↑ Schweiz: Das Unwetter sorgt für das schlimmste Schadensjahr seit 2005
-
Tages-Anzeiger
2021-07-16 de Schweiz: Das Unwetter sorgt für das schlimmste Schadensjahr seit 2005"Die Versicherer ziehen derweil eine erste Bilanz:.
Sie fällt düster aus; Wasser und Schlamm haben ganze Gemeinden verwüstet.
So zeichnet sich schon jetzt ab, dass dieses Jahr für die 18 kantonalen Gebäudeversicherungen ein besonders kostspieliges Jahr wird.
Dem Verband wurden bislang Schäden von rund 450 Millionen Franken gemeldet.
Teurer war es in den letzten zwanzig Jahren nur im Katastrophenjahr 2005.
20'000 beschädigte Fahrzeuge an einem Tag
Laut Hochrechnungen des Versicherers Mobiliar haben die Unwetter seit dem 20. Juni Schäden in der Höhe von 280 Millionen Franken verursacht.
Allein der Hagelzug vom 28. Juni habe zu 20'000 Fahrzeugschäden in der Höhe von 90 Millionen Franken geführt.
Zum Vergleich: Das August-Hochwasser von 2005 sorgte bei der Mobiliar für Schäden von insgesamt 450 Millionen Franken.
↑ Deutschland sollte auch über Dämme und Frühwarnsysteme und nicht nur über Windräder und Elektroautos reden
Mit folgendem Link wird von anderen Webseiten auf diese Seite verwiesen.
-
NZZ
2021-07-16 de Deutschland sollte auch über Dämme und Frühwarnsysteme und nicht nur über Windräder und Elektroautos redenDie politische Aufarbeitung der Unwetterkatastrophe in Deutschland konzentriert sich auf den Streit über die Energiewende.
Fragen zum besseren Schutz der Bevölkerung vor Unwetterkatastrophen wären mindestens so wichtig.
Die gewaltigen Schäden durch die Unwetter in Deutschland und Belgien werfen Fragen auf, wie die Bevölkerung besser davor geschützt werden kann.
Die schweren Unwetter in Westdeutschland und ihre erschreckende Zahl von Todesopfern sind eine unglaubliche Tragödie.
Blickt man auf die politischen Debatten der letzten zwei Tage, entsteht allerdings der Eindruck, als wäre das Ereignis für viele Personen eher ein Glücksfall.
Sie sehen sich in ihrer Weltanschauung bestätigt
und ziehen in politischen Statements, in Medienkommentaren oder auf den sozialen Netzwerken blitzschnell die
mal hämisch, mal warnend gemeinte Schlussfolgerung:
Das sind die Folgen des Klimawandels.
Diese Gewissheit löst dann häufig, zumal im Kontext des Bundestagswahlkampfs, zweierlei Reaktionen aus.
Erstens: Schuld an der Tragödie sind jene Politiker und Lobbyisten, die eine forschere Gangart bei der deutschen Energiewende verzögern.
Zweitens: Jetzt müssen wir erst recht loslegen mit dem Bau von Windrädern, Solarpanels und Elektroautos.
Das Klimaproblem geht nicht mehr weg
Dass der Klimawandel einen Einfluss auf die Häufigkeit und die Heftigkeit schwerer Unwetter in der Art des jüngsten Starkregens in Westeuropa hat, ist zwar weniger einfach zu belegen, als viele meinen.
Aber es ist nach allem bekannten Wissen wahrscheinlich.
Zahlreich sind auch die wissenschaftlichen Studien mit der Erkenntnis, dass es weltweit kostengünstiger ist, in Vorkehrungen zur Reduktion der Klimaerwärmung zu investieren, als nichts zu tun und bloss in die Beseitigung der langfristigen Folgeerscheinungen Geld zu stecken.
Das ist eines der zentralen Argumente dafür, dass hohe Investitionen in den Klimaschutz wichtig sind und dass die Klimapolitik zu Recht ein zentrales Thema unser Zeit ist.
Wenn aber der Schutz der Bevölkerung vor solchen Unwetterkatastrophen primär im beschleunigten Ausbau erneuerbarer Energieträger oder von Ladestationen an Autobahnen gesehen wird, dann werden zwei grundlegende Wesensmerkmale des Klimawandels übersehen.
Erstens ist die Klimaerwärmung ein globales Phänomen.
Deutschland trägt bloss knapp 2 Prozent zum weltweiten Ausstoss an Treibhausgasen bei.
Wenn Deutschland diese Emissionen nun mit verstärkten Anstrengungen ein paar Jahre früher als geplant auf null senken würde, würde der Klimawandel dadurch bestenfalls marginal abgeschwächt.
Es steht nicht in der Macht deutscher Politiker oder Konsumenten, wesentlichen Einfluss auf das Klima zu nehmen.

 Each Country's Share of CO₂ Emissions
Each Country's Share of CO₂ Emissions
Published Jul 16, 2008 Updated Aug 12, 2020

Zweitens ist der Klimawandel ein sehr langfristiges Phänomen.
Selbst wenn jetzt die ganze Welt auf einen Schlag aufhörte, fossile Energieträger zu verbrennen, ginge der Klimawandel zunächst weiter.
Die Erwärmung wäre langsamer und weniger weitgehend, als derzeit erwartet wird, aber sie würde nicht rückgängig gemacht.
Der Klimawandel ist ein Faktum und wird bleiben.
Wenn er katastrophale Wetterphänomene wie Starkregen oder Dürreperioden begünstigt, dann reicht eine Reduktion der CO₂-Emissionen nicht.
Die Gesellschaft muss sich auch besser vor den Folgen der Klimaerwärmung schützen.
Besserer Schutz vor Unwettern
Die Fragen nach der Verantwortung, die deutschen Politikern jetzt gestellt werden sollten, sind deshalb nicht nur die nach der Stilllegung von Kohlekraftwerken oder dem Bau zusätzlicher Windparks.
Es sind auch Fragen nach geeigneten Warnsystemen vor Sturzfluten für die Bevölkerung gefährdeter Gebiete.
Es sind Fragen nach nötigen baulichen Massnahmen zum Ableiten grosser Regenmengen und zum Schutz von Siedlungsgebieten vor Überschwemmungen.
Und es sind Fragen der Raumplanung, welche die Siedlungsentwicklung in hochwassergefährdeten Regionen sinnvoll steuern sollte.
Solche Fragen nach dem Management der negativen Folgen des Klimawandels werden im klimapolitischen Diskurs zumeist tabuisiert.
Klimaschützer befürchten, dass sie als Ausrede für Nichtstun missbraucht werden.
Doch wer diese Fragen vermeidet, verschliesst die Augen vor der Realität und bringt damit die Bevölkerung in Gefahr.
Der Klimawandel ist da.
Er führt zu häufigeren Gefahrenlagen.
Politik und Gesellschaft müssen sich darauf einstellen und geeignete Vorsorgemassnahmen treffen.
Das ändert nichts daran, dass die ganze Welt ihre Treibhausgasemissionen reduzieren muss, um in Zukunft nicht noch mehr Gefahrenlagen entstehen zu lassen.
Das ist kein Gegensatz, sondern eine sich ergänzende Strategie der Risikovorsorge.
↑ Hochwasser: Die aktuelle Lage im Südwesten - SWR Extra am 16.07.2021
-
SWR
2021-07-16 de Hochwasser: Die aktuelle Lage im Südwesten
| SWR Extra am 16.07.2021
Hochwasser: Die aktuelle Lage im Südwesten
| SWR Extra am 16.07.2021
Die Hochwasser-Situation in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen ist immer noch katastrophal.
Starke Regenfälle hatten besonders im Norden von Rheinland-Pfalz für Hochwasser und Überflutungen gesorgt.
Baden-Württemberg hilft mit Rettungskräften und Material.
In den Katastrophengebieten von Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen ist die Lage nach wie vor schwierig.
Immer noch herrscht Hochwasser und es werden viele Menschen vermisst, Gebäude müssen evakuiert und Straßen von Schutt und Schlamm geräumt werden.
Das Land Baden-Württemberg hat die Unterstützung für das Nachbarland Rheinland-Pfalz inzwischen deutlich ausgeweitet, teilte der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl (CDU) am Freitag mit.
Weitere 600 Einsatzkräfte von Sanitätsdienst, Feuerwehr und Technischem Hilfswerk seien am Donnerstagabend und in der Nacht in die Hochwassergebiete in Rheinland-Pfalz entsandt worden.
Höhenretter, Hochwasserspezialisten und Hubschrauber seien dabei.
↑ 1300 Menschen werden im Kreis Bad Neuenahr-Ahrweiler vermisst - Hoffnung an der Steinbachtalsperre
-
Stern
2021-07-15 de 1300 Menschen werden im Kreis Bad Neuenahr-Ahrweiler vermisst - Hoffnung an der SteinbachtalsperreDie Entwicklung während des Katastrophentages in Deutschland in der Ticker-Nachlese.
Inhaltsverzeichnis
22.40 Uhr: Wasserstand an der Steinbachtalsperre sinkt.
20.02 Uhr: Lewentz: Neun weitere Tote durch Hochwasser-Katastrophe.
16.38 Uhr: Merkel sagt Menschen in Hochwassergebieten Unterstützung zu.
16.04 Uhr: Bahnverkehr in NRW und Rheinland-Pfalz weiterhin stark eingeschränkt.
14.46 Uhr: Zahl der Unwettertoten in NRW und Rheinland-Pfalz auf mindestens 42 gestiegen.
13.38 Uhr: Lage unübersichtlich - Zahl der Vermissten sinkt.
12.47 Uhr: Laschet zu Hochwasser: Klimaschutz muss jetzt forciert werden.
↑ "Es ist wirklich verheerend"
-
Tagesschau
2021-07-15 de "Es ist wirklich verheerend"
"Es ist wirklich verheerend"
Nach dem schweren Unwetter gehen die Einsatzkräfte von mindestens 38 Toten in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen aus.
Zahlreiche Menschen werden noch vermisst, viele warten auf Rettung.
Ministerpräsidentin Dreyer zeigte sich schockiert.
Ganze Orte sind überflutet, Häuser einfach weggeschwommen.
Polizeihubschrauber sind unterwegs, um Menschen von Hausdächern zu retten.
Wie viele Menschen im Zusammenhang mit der Katastrophe starben, ist noch unklar - auch, weil noch immer Dutzende Menschen vermisst werden.
Allein im besonders schwer betroffenen Kreis Ahrweiler geht die Polizei von 18 Toten aus.
Aus dem Kreis Euskirchen im ebenfalls betroffenen Bundesland Nordrhein-Westfalen werden 15 Tote gemeldet.
Weitere Tote gibt es in Rheinbach, Köln, Solingen und im Kreis Unna - Menschen, die von den Fluten weggerissen wurden oder in ihren gefluteten Kellern starben.
-
Tagesschau
2021-07-15 de Besonders dramatisch ist die Unwetterlage in Rheinland-Pfalz und NRW
Besonders dramatisch ist die Unwetterlage in Rheinland-Pfalz und NRW
-
Tagesschau
2021-07-15 de Jan Schulte, WDR, über die aktuelle Situation in Hagen
Jan Schulte, WDR, über die aktuelle Situation in Hagen
-
Tagesschau
2021-07-15 de Bahnverkehr massiv beeinträchtigt
Bahnverkehr massiv beeinträchtigt
↑ Talsperre läuft unkontrolliert über
-
hessenschau
2021-07-15 de Talsperre läuft unkontrolliert über
Talsperre läuft unkontrolliert über
Hessenschau vom 15.07.2021
Diemelsee läuft über
↑ Historisches Unwetter: Flutkatastrophe an der Ahr (15.07.2021)
-
WetterOnline
2021-07-15 de Historisches Unwetter: Flutkatastrophe an der Ahr (15.07.2021)
Historisches Unwetter: Flutkatastrophe an der Ahr (15.07.2021)
Eine Katastrophe historischen Ausmaßes hat die Eifel getroffen.
In vielen Landkreisen wurde der Katastrophenalarm ausgerufen.
Besonders schlimm ist die Lage an der Ahr im nordwestlichen Rheinland-Pfalz.
Nach Angaben der Polizei sind im Ort Schuld am Oberlauf der Ahr mehrere Häuser eingestürzt und zahlreiche Personen werden vermisst.
↑ Warnung vor extremen Dauerregen für Wuppertal - Überflutungen möglich
-
Westdeutsche Zeitung
2021-07-14 07:39 h de Warnung vor extremen Dauerregen für Wuppertal - Überflutungen möglich
Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt für Mittwochmorgen 7.14 Uhr bis voraussichtlich Donnerstag 6 Uhr vor ergiebigem Dauerregen (Warnstufe 4 von 4).
Die amtliche Warnung hat der Dienst am Mittwochmorgen (14. Juli 2021) ausgegeben.
Auf der A 46 Höhe des Sonnborner Kreuzes ist es am Mittwochmorgen zu Problemen gekommen:
Die Fahrbahn wurde wegen des Dauerregens überschwemmt.
Auch die Stadtwerke Wuppertal (WSW) teilten aufgrund der Wetterlage mit, dass die Gefahr von Überschwemmungen steigt - und die WSW erklärten, was es nun zu beachten gilt.
Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes strömt am Rande eines sich über Frankreich etablierenden Tiefdruckgebiets warme bis sehr warme Luft aus dem Mittelmeerraum heran.
Im Warnzeitraum zieht teilweise extremer Dauerregen über die Stadt.
Die Regenmengen können zwischen 70 und 120 Liter pro Quadratmeter innerhalb weniger Stunden erreichen.
Akkumuliert sind bis Donnerstagfrüh strichweise deutlich höhere Regenmengen zwischen 100 und 150 Liter pro Quadratmeter möglich.
↑ Die Wuppertalsperre ist mehr als randvoll...
-
Twitter
2021-07-14 21:30 h de Die Wuppertalsperre ist mehr als randvoll...
![]()
![]() Wuppertalsperre am 14.07.2021 um 21:30 Uhr
Wuppertalsperre am 14.07.2021 um 21:30 Uhr
"Zufluss": 111,14 m3/s
(= 100 % rechts oben)
"Abfluss": 145,65 m3/s
(= 131,1 % links unten)

↑ Stadt Wuppertal warnt vor Überschwemmungen in der Nacht
-
Westdeutsche Zeitung
2021-07-14 22:55 h de Stadt Wuppertal warnt vor Überschwemmungen in der Nacht
Zwar hat der Regen gegen 22 Uhr in Wuppertal nachgelassen, doch die Gefahr von Überflütungen ist weiterhin groß.
Die Stadt warnt vor weiteren Wupper-Übertritten im gesamten Gebiet der Talachse.
Grund dafür sind die massiven Zuläufe in die Wuppertalsperre, die zu einem Überlauf der Talsperre führen könnten.
Die Wassermengen, die dadurch zusätzlich zum kontrollierten Ablauf in die Wupper kommen können, sind nicht absehbar.
Der Überlauf könnte binnen der nächsten Stunde passieren, so die Stadt (Stand 14. Juli 2021 um 22.30 Uhr).
Der Scheitelpunkt des Hochwassers wird gegen 1 Uhr erwartet.
Der Wupperverband sei dabei, an der Wuppertalsperre "die Kontrolle zu verlieren", so Informationen der WZ.
Die Stadt sperrt derzeit alle Unterführungen auf der Talsohle.
Die Unterführungen dürfen bis auf Weiteres nicht mehr genutzt werden.
Das gilt auch für die Unterführung B 7/ Döppersberg für den Fall, dass die Wuppertalsperre überläuft.
Weiterhin gilt der dringende Appell, die Bereiche der Talsohle in der Nähe der Wupper zu meiden.
Bürger sollen außerdem nicht versuchen, Hab und Gut aus Kellerräumen zu bergen oder aktuell abzupumpen.
Die Stadt sagt: "Die Gefahr ist noch nicht vorbei!"
Alle sensiblen Einrichtungen, die das Hochwasser erreichen könnten, seien informiert - sie verlegen, wo nötig, ihre Bewohner vorsorglich nach oben.
Außerdem wurden Obdachlose an den bekannten Schlafplätzen aufgesucht und gewarnt.
Personen sollten sich in der Nacht nicht in der Nähe der Wupper, insbesondere nicht in Muldenlagen aufhalten, Anwohner sollten in diesen Lagen die Situation beobachten oder wenn möglich Souterrain- und Erdgeschosse verlassen und das 1. Obergeschoss aufsuchen.
Eventuell müssen Trafostationen in diesen Bereichen zeitweilig abgeschaltet werden.
↑ Starkregen und Sturzfluten
-
Arte
2021-06-02 de Starkregen und Sturzfluten
Starkregen und Sturzfluten
2016: Starkregen und Sturzfluten in Simbach in Niederbayern
Am 1. Juni 2021 begeht Simbach am Inn in Niederbayern ein trauriges Jubiläum.
Sieben Menschen kamen vor fünf Jahren bei einem Jahrhundert-Hochwasser ums Leben.
Die Katastrophe hat sich den Einwohnern tief ins Gedächtnis gebrannt.
Die Angst, dass sich die Katastrophe wiederholen könnte, lässt die Bürger nicht los.
Was muss für nachhaltigen Hochwasserschutz getan werden?
Der Simbach, der der Gemeinde seinen Namen gegeben hat, ist eigentlich nur ein kleines Gewässer, doch der Starkregen hatte es im Nu anschwellen lassen.
Der Ort war von den Wassermassen, dem Treibholz und dem Schlamm, die diese mit sich brachten, regelrecht verwüstet worden.
Die Katastrophe hat sich den Einwohnern tief ins Gedächtnis gebrannt.
Inzwischen wurde zwar viel Aufbauarbeit geleistet,
wichtige Schutz-Maßnahmen wurden angestoßen.
Doch die Mühlen der Bürokratie mahlen langsam und vieles steht bisher nur auf dem Papier.
Unterdessen lässt die Angst, dass sich die Katastrophe wiederholen könnte, die Bürger nicht los.
Und die Angst ist berechtigt.
Experten sagen: Starkregen und Sturzfluten, wie sie Simbach 2016 erlebt hat, werden zunehmen - eine von vielen Folgen des Klimawandels.
Der Film begleitet die Anstrengungen in Simbach und andernorts, solchen Unwetter-Katastrophen vorzubeugen.
Und er hinterfragt: Sind wir gerüstet?
Oder muss mehr für nachhaltigen Hochwasserschutz getan werden?
Wie schützt man sich zum Beispiel im benachbarten Österreich, wo man aufgrund von Gletscherschmelze und Wildbächen von jeher Erfahrungen im Umgang mit solchen akuten Wetterereignissen hat?
↑ Fluss-Hochwässer haben in den letzten 50 Jahren global abgenommen
-
2021-05-09de
 Fluss-Hochwässer haben in den letzten 50 Jahren global abgenommen
(K35)
Fluss-Hochwässer haben in den letzten 50 Jahren global abgenommen
(K35)
▶Klimaschau Wird demnächst gelöscht, da die Kalte Sonne nicht mehr publiziert wird!
-
Geophisical Research Letter / Slater et al. 2021
Global Changes in 20-Year, 50-Year, and 100-Year River Floods -
University of Oxford
Major floods increased in temperate climates but decreased elsewhere: Oxford study -
NoTricksZone / Kenneth Richard
New Study: 100-Year Flood Events Are Globally Decreasing In Frequency And Probability Since 1970
↑ Die Flut kommt - todsicher
-
[W] wie Wissen
2021-03-28 de Die Flut kommt - todsicher
Die Flut kommt - todsicher
Wie die deutschen Küsten gegen die steigenden Fluten aufgerüstet werden
Hochwasserschutz in der Großstadt
Meeresspiegel - Wie wird er gemessen und was lässt ihn künftig wie stark steigen?
Sperrwerke und Mega-Dämme.
↑ LINTHFLUT / Bunkerbau im WW2
-
Tschanz
2021-02-19 de LINTHFLUT / Bunkerbau im WW2
LINTHFLUT / Bunkerbau im WW2
Im Zweiten Weltkrieg wurde die Linthebene nicht nur zu einem Vorzeigemodell der Anbauschlacht, sondern auch zu einem gewaltigen militärischen Abwehr-Mechanismus gegen die Nazis ausgebaut.
Mit Hilfe von Fachmännern von der Stiftung Schwyzer Festunsgwerke, Bauplänen aus dem Zweiten Weltkrieg, aber auch Bildmaterial aus dem Bundesarchiv holen wir ein unglaubliches Stück Schweizer Geschichte aus vergessenen Stollen.
↑ Talsperren sind wieder gut gefüllt
-
WDR
2021-01-21 de Talsperren sind wieder gut gefüllt
Talsperren sind wieder gut gefüllt
Viel Regen, viel Schnee
Das sorgt zwar nicht für gute Laune, tut aber der Natur und den
Talsperren gut.
Nach dem trockenen Sommer erholt sich die Natur langsam wieder und die Talsperren laufen wieder voll.
⇧ 2019
↑ Dank Regen: Talsperren wieder mehr gefüllt
-
Antenne Unna
2019-01-03 de Dank Regen: Talsperren wieder mehr gefüllt
Das Regenwetter der letzten Wochen hat Wirkung gezeigt.
Die für das Trinkwasser im Kreis Unna wichtigen Talsperren sind wieder mit mehr Wasser gefüllt.
⇧ 2018
↑ Unwetter und Überschwemmungen: Der Wetter-Wahnsinn - stürmisch und teuer
-
BR Doku
2019-10-26 de Unwetter und Überschwemmungen: Der Wetter-Wahnsinn - stürmisch und teuer
Unwetter und Überschwemmungen: Der Wetter-Wahnsinn - stürmisch und teuer
In dieser Dokumentation aus dem Jahr 2018
geht es um die Änderungen beim Wetter und die katastrophalen Auswirkungen auf uns und unsere Umwelt.
Der ARD-Wetterexperte Sven Plöger verdeutlicht, welche Rolle bei den zunehmenden Unwettern der Klimawandel spielt und Versicherungsexperten erklären, welche Folgen das für Hausbesitzer hat.
↑ San Joaquin River Flood Risk Management System
-
Sacramento District
2018-08-03 en San Joaquin River Flood Risk Management System
San Joaquin River Flood Risk Management System
The U.S. Army Corps of Engineers,
San Joaquin Area Flood Control Agency and State of California's Central Valley Flood Protection Board work together to reduce flood risk for the City of Stockton and surrounding area.
Learn about the complex system that helps reduce risk for over 160,000 people and one of the most productive agricultural areas in the United States.
▶Hochwasserschutz in Kalifornien
↑ Öffnung der beiden Grundablass Rohre an der Rursee Talsperre
-
Photo Lurch
2018-07-30 de Öffnung der beiden Grundablass Rohre an der Rursee Talsperre
Öffnung der beiden Grundablass Rohre an der Rursee Talsperre
2018: 80 jähriges Jubiläum der Talsperre
Video über den Überlauf der Rursee Talsperre am 28.07.2018
anläßlich des 80jährigen Jubiläum der Talsperre.
Im Video werden der Ablass von 15.000 Liter pro Sekunde gezeigt.
Im absoluten Notfall wäre sogar eine Entleerung von bis zu 60.000 Liter pro Sekunde möglich.
↑ Sonne steuert Überschwemmungen in Zentralchina: Forscher entdecken 500-Jahreszyklus in Höhlentropfsteinen
-
Die kalte Sonne (Fritz Vahrenholt & Sebastian Lüning)
2018-01-01 de Sonne steuert Überschwemmungen in Zentralchina: Forscher entdecken 500-Jahreszyklus in HöhlentropfsteinenAus China berichteten Liu et al. 2014 und Chen et al. 2015 über vorindustrielle Überflutungsphasen.
Zhu und Kollegen publizierten im Januar 2017 in PNAS eine Überflutungsstudie auf Basis von Höhlentropfsteinen aus Zentralchina.
Die Forscher fanden einen 500 Jahreszyklus, der eng an die El Nino/La Nina-Oszillation und solare Schwankungen gekoppelt ist.
⇧ 2017
↑ Spanien: Überschwemmungen im Takte von Sonne und Ozeanzyklen
-
Die kalte Sonne (Fritz Vahrenholt & Sebastian Lüning)
2017-09-15 de Spanien: Überschwemmungen im Takte von Sonne und OzeanzyklenAuch in Spanien treten die Flüsse ab und an über die Ufer.
Neue Studien haben die Hochwasserereignisse feinsäuberlich rekonstruiert.
Wer bei der nächsten Überflutung reflexhaft den Klimawandel als Ursache bemüht, sollte sich zunächst mit der Klimageschichte beschäftigen und sich die Frage stellen:
Ist dieses aktuelle Hochwasserereignis wirklich so grundlegend verschieden von den früheren?
↑ Ein unerwartetes Ergebnis: Sonnenaktivität steuert Überflutungen in den Alpen
-
Die kalte Sonne (Fritz Vahrenholt & Sebastian Lüning)
2017-09-09 de Ein unerwartetes Ergebnis: Sonnenaktivität steuert Überflutungen in den AlpenKlimaextreme können nur in ihrem langfristigen Kontext korrekt bewertet werden.
Studie aus den französischen Alpen.
Flutgeschichte der letzten 1000 Jahre: Eine Häufung der Flutereignisse während der kalten Kleinen Eiszeit.
Flutereignisse von hoher Intensität wurden sowohl in der Kleinen Eiszeit als auch in der Mittelalterlichen Wärmeperiode gefunden.
Interessanterweise konnte für das 20. Jahrhundert trotz Erwärmung kein Trend in Häufigkeit und Intensität der Fluten ausgemacht werden.
Studie am schweizerischen Oeschinensee
Allgemein ereigneten sich die stärksten Flutereignisse während Kältephasen.
↑ Verschiebt der Klimawandel Europas Hochwässer dramatisch?
-
EIKE Europäisches Institut für Klima und Energie
Helmut Kuntz
2017-08-22 de Verschiebt der Klimawandel Europas Hochwässer dramatisch?Das Ergebnis:
Der Klimawandel hat tatsächlich einen deutlichen Einfluss auf Hochwasserereignisse.
Erkennen lässt sich das am besten daran, dass sich das Auftreten der Hochwässer über die Jahre zeitlich verschiebt.
Je nach Ursache der Hochwasserereignisse treten sie in manchen Regionen immer früher auf, in anderen immer später ….
Es lohnt sich, die Studie zu sichten,
da sie (wieder) eines der typischen Beispiele ist, wie aus im Kern unbrauchbaren Daten durch statistische Kunstkniffe Abweichungen "generiert" werden und das unspektakuläre Ergebnis dann medial aufgebauscht vermittelt wird.
Die Hochwasserpegel wurden bisher nicht höher und die Starkniederschläge ebenfalls nicht schlimmer
Wie unlängst in einer kleinen Sichtung anhand 100-jähriger Niederschlagsreihen gezeigt wurde, sind die Starkniederschlags-Streuungen unglaublich hoch.
Es ist so "schlimm", dass ist nicht einmal nach 100 Jahren sichere Trends belegbar sind.
Vor allem jedoch:
Eine Korrelation mit der steigenden Temperatur oder dem CO₂-Eintrag zeigt sich definitiv nicht.
⇧ 2016
↑ Überflutungen 2016 in Europa
-
Wikipedia
de
Unwetter in Europa im Frühjahr 2016
en 2016 European floods
fr Inondations européennes de 2016
↑ Starkregen, Sturzflut, Sintflut - sieht so der Sommer der Zukunft aus?
-
WDR
2021-11-08 de Starkregen, Sturzflut, Sintflut -
sieht so der Sommer der Zukunft aus?
Starkregen, Sturzflut, Sintflut -
sieht so der Sommer der Zukunft aus?
Der Frühsommer 2016 brachte Regen nach Deutschland.
Zu viel Regen.
Braunsbach, Simbach, Wachtberg - etliche Orte wurden von den Wassermassen überrascht, es gab Verletzte und Tote.
Aber warum konnte man die Unwetter nicht früher vorhersagen?
Welche Kraft hat Wasser wirklich - und ist der Klimawandel wirklich schuld?
↑ Rekordhochwasser in Frankreich: Die Seine und weitere Flüsse steigen - zwei Tote
-
NZZ
2016-06-02 de Rekordhochwasser in Frankreich: Die Seine und weitere Flüsse steigen - zwei ToteSüdlich von Paris und auch im Loire-Tal hat das Wasser nach tagelangen Regenfällen Felder und Ortschaften überflutet.
Besonders betroffen ist Nemours, wo die Hälfte der Bewohner evakuiert wurden.
Ein Mann bringt am Dienstag, 1. Juni 2016, ein Baguette nach Hause, dabei muss er sich durch Hochwasser kämpfen in Chalette-sur-Loing Montargis nahe Orléans. (Bild: Reuters)
Das Schloss von Chambord bei Blois im Loire-Tal gleicht heute einer Wasserburg.
Vom Schlossgraben und den Grünflächen ist nicht mehr zu sehen, die Kellergewölbe dieses Prachtbaus aus dem 16. Jahrhundert sind bereits überschwemmt.
Das ist nur ein besonders eindrückliches Beispiel für die Überschwemmungen, die Mittelfrankreich nach tagelangen Regenfällen heimsuchen.
↑ en Climate Blamed for Worst Paris Floods since 1910
-
Watts Up With That? (Anthony Watts)
2016-06-11 en Climate Blamed for Worst Paris Floods since 1910Paris, France recently suffered severe flooding.
Naturally Climate Scientists have blamed the May 2016 Paris floods on Climate, though it was admitted the floods fell well short of the Great Flood of 1910.
Flooding began first on smaller rivers including the Yvette and Loing - south of Paris.
The Loing River, a tributary of the Seine, rose to levels not seen since 1982 but still short of the catastrophic January 1910 Paris floods when the Seine reached 8.0 meters (26.2 feet).
The Seine - which runs directly through the heart of Paris - peaked at 6.1 meters (20 feet ) above its normal height during the night of June 3rd - a 34-year high.
Farther south, in the heart of the Loire basin, tributaries of the Loire River, including the Retreve and the Sauldre Rivers, reached 50-year highs between May 31st and June 1st, flooding highways and the historic 16th-century Chambord castle.
The timing of this flood was quite unusual as virtually all previous floods along the Seine and Loire River basins have occurred during winter (as opposed to spring) due to buildup of excess water over several months during the winter.
Only two instances in the historical record - July 1659 and June 1856 - show flooding in months other than December, January, February or March.
Clearly, this event appears to be a combination of a very wet month of May in general, coupled with very high 3-day rainfall totals in particular.
Managing resulting flood risk is particularly challenging at this time of year because many reservoirs are already close to full to prepare for a typically dry summer season.
This year's May rainfall amounts were exceptional at some stations in France.
The Paris-Montsouris station, recording 179 mm (7 inches), received roughly 3 months worth of rain in one month.
The previous record of 133 mm (5.2 inches) was set in 1992. Orleans saw 181 mm (7.1 inches), also about 3 months of precipitation in one month.
The old record was 148 mm (5.8 inches) set back in 1985.
Quellen / Sources:
-
World Weather Attribution
2016-06-09 en European Rainstorms, May 2016 < ?php include "$punkte/include/aufruf/wayback_archiv.php"; ?>
-
OECD Reviews of Risk Management Policies
2014 en Seine Basin, Île-de-France: Resilience to Major Floods
↑ Unwetter verursachen Schäden in Millionenhöhe
-
Basler Zeitung
2016-06-10 de Unwetter verursachen Schäden in MillionenhöheMehrere Regionen der Schweiz haben durch das Unwetter Schäden in Millionenhöhe erlitten.
Besonders hart traf es den Kanton Aargau und die Nordwestschweiz.
Im Osten ging es auch am Donnerstag mit kräftigem Regen weiter.
↑ en European Rainstorms, May 2016
-
World Weather Attribution
2016-06-09 en European Rainstorms, May 2016 (Wayback‑Archiv)
Torrential rainfall ravaged parts of central and northeastern France and southern Germany last week forcing the evacuation of thousands - some in kayaks and canoes.
The River Seine burst its banks as waters reached their highest levels in over 30 years.
In Bavaria, floodwaters surged so fast they crushed houses and cars, forcing some residents to scramble to safety on their rooftops.
The floods closed the famed Louvre museum, left tens of thousands without power, and is reported to have killed at least 18 people in Germany, France, Romania, and Belgium.
Damages are estimated at over a billion Euros in France alone.
The extreme nature of this event left many asking whether climate change may have played a role.
↑ fr Le coût des crues pourrait excéder le milliard d'euros
-
Le Monde
2016-06-06 fr Le coût des crues pourrait excéder le milliard d'euros
↑ fr Inondations : un mort en Seine-et-Marne, 12 départements toujours en vigilance orange
-
Le Monde
2016-06-02 fr Inondations : un mort en Seine-et-Marne, 12 départements toujours en vigilance orangeUn peu plus de 19 000 foyers étaient privés d'électricité jeudi soir dans le Loiret et l'Ile-de-France en raison des inondations, contre 21 700 en fin de matinée, selon Enedis (anciennement ERDF), le gestionnaire du réseau français de distribution d'électricité.
En Allemagne, des pluies diluviennes ont fait au moins neuf morts depuis dimanche et trois personnes sont portées disparues en Bavière, selon un porte-parole de la police locale.
Epicentre des inondations mercredi, Simbach am Inn a commencé à voir le niveau de l'eau baisser dans les rues de la ville, qui montait parfois jusqu'aux toitures.
↑ Ile-de-France: La région sous l'eau du 7 au 18 mars pour un exercice inédit
-
20 Minutes
2016-03-01 fr Ile-de-France: La région sous l'eau du 7 au 18 mars pour un exercice inéditDu 7 au 18 mars l'Ile-de-France aura les pieds dans l'eau:
la préfecture de police organise en effet un exercice inédit de gestion de crise appelé Sequana, simulant une crue majeure, avec des exercices de terrain.
La référence en terme de crue centennale reste celle de en 1910.
↑ Simulation d'une crue centennale de la Seine en amont de Paris (Val-de-Marne)
-
L'Institut Paris Region
2016-02-18 fr Simulation d'une crue centennale de la Seine en amont de Paris
(Val-de-Marne)
Simulation d'une crue centennale de la Seine en amont de Paris
(Val-de-Marne)
Cette animation illustre les conséquences d'une inondation sur le territoire des bords de Seine en amont de Paris.
Un tel scénario pourrait se produire lors d'une crue centennale, rendant insuffisantes les retenues des grands lacs de Seine.
Les systèmes de protection le longs des berges seraient submergés.
↑ Dass draußen ganz normales Wetter herrscht, zeigten unsere Simulationen nicht an, deshalb konnten wir uns darauf auch nicht vorbereiten
-
EIKE Europäisches Institut für Klima und Energie
Helmut Kuntz
2016-02-18 de Dass draußen ganz normales Wetter herrscht, zeigten unsere Simulationen nicht an, deshalb konnten wir uns darauf auch nicht vorbereitenWann Starkregenereignisse wirklich stattfanden, lässt sich viel aussagekräftiger anhand von Flusspegelgrafiken zeigen.
Diese belegen, dass solche Ereignisse bei Kälte (zumindest soll es früher kälter gewesen sein) - und nicht bei Wärme - zunehmen,
da sie in unseren Breiten vom Wetter und nicht vom Klima abhängen (das diesjährige Unwetter in Simbach geschah ja ebenfalls bei eher niedrigen Temperaturen).
In der sehnlichst ersehnten, angeblich "wetterschadenfreien" vorindustriellen Zeit kamen die Flüsse ziemlich oft in die die Stadtzentren der anliegenden Flußstädte und -Dörfer.
Hochwasserverlauf des Main bei Würzburg von 1340 - 2014

 Mainpegel in cm (1030 cm im Jahr 1342)
Mainpegel in cm (1030 cm im Jahr 1342)
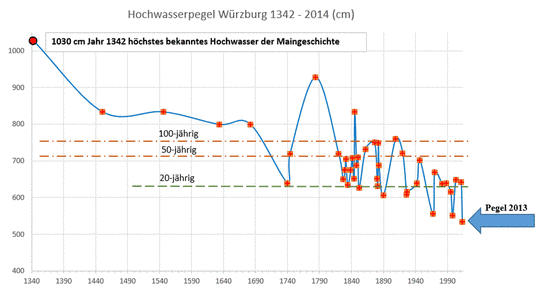
Hochwasserpegel Köln 1784 - 2013
↑ Simulation von Überflutungen in Paris
⇧ 2015
↑ 2015: The EU is to Blame for Britain's Flood Disaster
-
Breitbart
2015-12-28 en The EU is to Blame for Britain's Flood DisasterNorthern Britain has spent Christmas being inundated with floods of "biblical proportions".
Yes, they are indeed a man-made creation - but the people mainly
responsible are the bureaucrats and green activists at the European Union
whose legislation has made it illegal for Britain to take the measures necessary to reduce the risk of flooding.
British rivers have always been prone to flooding because Britain is a kingdom of rains (where royalty comes in gangs).
But traditionally, those living in flood-threatened areas have been able to mitigate the problem by making sure that their rivers are well dredged - and thus able to flow freely.
Historical perspective
...For all of recorded history, it almost went without saying that a watercourse needed to be big enough to take any water that flowed into it, otherwise it would overflow and inundate the surrounding land and houses.
Every civilisation has known that, except apparently ours.
It is just common sense.
City authorities and, before them, manors and towns and villages, organised themselves to make sure their watercourses were cleansed, deepened and sometimes embanked to hold whatever water they had to carry away.
In nineteenth century Cockermouth they came up with an ingenious way of doing this. Any able-bodied man seeking bed and board for the night in the workhouse was required to take a shovel and wheelbarrow down to the River Derwent and fetch back two barrow-loads of gravel for mending the roads.
This had the triple benefit of dredging the river, maintaining the roads and making indigent men useful.
In Cumbria they knew they had to keep the river clear of the huge quantities of gravel that were washed down from the fells, especially in times of flood.
For Cumbrian rivers are notoriously quick to rise as the heavy rain that falls copiously on the High Fells rapidly runs off the thin soils and large surface area over which it falls.
Cumbrian people have always known that their rivers would be subject to such sudden and often violent inundations and prepared for them by deepening and embanking their channels. Such work was taken very seriously.
So what changed? EU Regulation, that's what.
Thanks to the European Water Framework Directive - which passed into UK law in 2000 and which is enforced by the Environment Agency - the emphasis has shifted from preventing flooding to encouraging it.
Instead, the emphasis shifted, in an astonishing reversal of policy, to a primary obligation to achieve 'good ecological status' for our national rivers.
This is defined as being as close as possible to 'undisturbed natural conditions'.
"Heavily modified waters", which include rivers dredged or embanked to prevent flooding, cannot, by definition, ever satisfy the terms of the directive.
So, in order to comply with the obligations imposed on us by the EU we had to stop dredging and embanking and allow rivers to 're-connect with their floodplains', as the currently fashionable jargon has it.
And to ensure this is done, the obligation to dredge has been shifted from the relevant statutory authority (now the Environment Agency) onto each individual landowner, at the same time making sure there are no funds for dredging.
And any sand and gravel that might be removed is now classed as 'hazardous waste' and cannot be deposited to raise the river banks, as it used to be, but has to be carted away.
On the other hand there is an apparently inexhaustible supply of grant money available for all manner of conservation and river 'restoration' schemes carried out by various bodies, all of which aim to put into effect the utopian requirements of the E W F Directive to make rivers as 'natural' as possible.
For example, 47 rivers trusts have sprung up over the last decade, charities heavily encouraged and grant-aided by the EU, Natural England, the Environment Agency, and also by specific grants from various well-meaning bodies such as the National Lottery, water companies and county councils.
The West Cumbria Rivers Trust, which is involved in the River Derwent catchment, and includes many rivers that have flooded, is a good example.
But they all have the same aim, entirely consonant with EU policy, to return rivers to their 'natural healthy' state, reversing any 'straightening and modifying' which was done in 'a misguided attempt to get water off the land quicker'.
They only think it 'misguided' because fast flowing water contained within its banks can scour out its bed and maybe wash out some rare crayfish or freshwater mussel, and that conflicts with their (and the EU's) ideal of a 'natural' river.
↑ Pentagon Says Europe Will Drown In The Next Four Years
-
Real Science (Steven Goddard)
2015-09-27 en Pentagon Says Europe Will Drown In The Next Four YearsWe give the Pentagon hundreds of billions of dollars a year, but they didn't have enough money to find out that sea level isn't actually rising in much of Europe.
↑ 2014
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz-
OECD Reviews of Risk Management Policies
2014 en Seine Basin, Île-de-France: Resilience to Major Floods
↑ Hessischer Starkregen aus dem Juli 2014 eine Folge des Klimawandels? Eher unwahrscheinlich. Statistiken zeigen eine Abnahme schwerer sommerlicher Regengüsse während der letzten 100 Jahre
-
Die kalte Sonne (Fritz Vahrenholt & Sebastian Lüning)
2014-08-21 de Hessischer Starkregen aus dem Juli 2014 eine Folge des Klimawandels? Eher unwahrscheinlich. Statistiken zeigen eine Abnahme schwerer sommerlicher Regengüsse während der letzten 100 JahreEndlich mal wieder schlechtes Wetter, darauf hatte man beim Potsdaminstitut für Klimafolgenforschung (PIK) schon gehofft:
Ein Gewitter in Hessen musste jetzt als Kronzeuge für den Klimawandel herhalten.
Die Welt bot dem PIK am 16. Juli 2014 die entsprechende Bühne:
↑ 2013
↑ Neue Studie des Geoforschungszentrums Potsdam: In den letzten 7000 Jahren gab es in Oberösterreich 18 hochwasserreiche Phasen
-
Die kalte Sonne (Fritz Vahrenholt & Sebastian Lüning)
2013-12-21 de Neue Studie des Geoforschungszentrums Potsdam: In den letzten 7000 Jahren gab es in Oberösterreich 18 hochwasserreiche PhasenEs ist ein einfach durchschaubares Muster.
Immer wenn ein Sturm über die Lande fegt, Überschwemmungen eine Flusslandschaft unter Wasser setzen oder eine Dürre die Ernte zerstört, ist der Schuldige schnell gefunden:
Es muss wohl der Mensch gewesen sein, der mit seiner ausschweifenden Lebensweise zu viel CO₂ in die Luft pustet und das Klima in katastrophaler Weise durcheinander bringt.
Früher machte man für derlei meteorologische Extreme Hexen verantwortlich, die man schnellstmöglich auf den Marktplätzen verbrannte um schlimmeres Unwetter in Zukunft zu verhindern.
An wissenschaftlichen Argumenten war man früher ebenso wie heute eher weniger interessiert.
↑ Was waren die wahren Hintergründe der mitteleuropäischen Flut 2013?
-
Die kalte Sonne (Fritz Vahrenholt & Sebastian Lüning)
2013-07-03 de Was waren die wahren Hintergründe der mitteleuropäischen Flut 2013?Das Wasser kam, das Wasser ging.
Zurück blieb die Ungewissheit:
War es ein ganz normales Hochwasser, wie es seit Jahrtausenden in Deutschland und anderswo immer vorgekommen ist, oder geht die Überschwemmung vielmehr auf das Konto der berüchtigten Klimakatastrophe?
Von letzterem scheint das klimatologische Fachblatt "Bildzeitung" überzeugt zu sein,
welche am 12. Juni 2013 in Zusammenarbeit mit Klimaprediger Mojib Latif lauthals verkündete:
Jahrhundertfluten - Klimawandel schlägt voll zu
Meteorologe Prof. Mojib Latif (58) von der Uni Kiel: "Die Häufung der Wetter-Extreme ist ein eindeutiges Indiz für den Klimawandel."
Grund: der Treibhauseffekt!
Latif: "Weil wir ungehemmt CO₂ in die Luft pumpen, heizt sich die Atmosphäre auf."
Die Folge: Immer mehr Wasser verdunstet in den Meeren.
Die Luftfeuchtigkeit steigt, Wolken saugen sich mit Wasser voll und regnen sich über dem Festland ab.
Es kommt zu Starkniederschlägen, zu immer heftigeren Überflutungen […].
Auch der Deutsche Wetterdienst (DWD) führt die heftigen Wetter-Phänomene auf die Erderwärmung zurück.
DWD-Wettermann Gerhard Lux (59): "Durch die Erwärmung werden wir in Zukunft immer mehr Extremwetter-Situationen haben."
Starke Sommerstürme, Hagel-Attacken, Überflutungen und heftige Gewitter häufen sich.
Auch im Spiegel tobten die Fluten,
wobei Jakob Augstein in einer Kolumne wild über Schuld und Sühne fabulierte:
Im Zweifel links: Wir sind schuldig!
Die Katastrophe klärt den Blick.
Unsere Art zu leben kommt nicht ohne Kosten aus.
Daran erinnert dieses Hochwasser - erneut.
Es ist die zweite "Jahrhundertflut" in gut zehn Jahren.
Ob dieses eine Hochwasser auf die von Menschen gemachte Erderwärmung zurückgeht, wird sich nicht beweisen lassen.
Die Frage ist: Welchen Beweis brauchen die Klimawandelleugner, bevor ihnen die Augen aufgehen?
Was muss geschehen, damit die Wachstumsprediger dazulernen?
Keiner von ihnen wird später sagen können, er habe nichts gewusst.
Auch das Potsdam-Institut zur Förderung der Klimakatastrophe (PIK) nutzte seine Chance und verbreitete via Berliner Zeitung munter Weltuntergangszenarien:
Klimawandel verstärkt Hochwasser
Potsdamer Forscher haben keinen Zweifel:
Die Erderwärmung führt zu einer größeren Zahl an Überschwemmungen in Ostdeutschland.
Dabei regnet es nicht etwa häufiger - sondern seltener.
Wenn Klimaforscher nach Ursachen von Wetterkatastrophen suchen, dann vertiefen sie sich in Zahlen.
So spüren die Experten des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung (PIK) auch den derzeitigen Hochwassern in Ostdeutschland nach, indem sie Daten von Wettermessungen, zur Landschaft und zur Geografie analysieren.
Im Trend zeigt sich dabei:
Mehr als die Landnutzung an den Ufern und die Begradigung oder Vertiefung der Flüsse dürfte der Klimawandel hinter der Zunahme von starken Hochwassern stecken.
Da konnten die Potsdamer Neuesten Nachrichten nicht nachstehen und titelten verschwörerisch:
Ein interessanter Verdächtiger Der Klimawandel könnte Hochwasser hervorrufen
Die zweite Hochwasserkatastrophe in Deutschland in diesem Jahrhundert hat auch die Forschung auf den Plan gebracht.
Die Frage, ob es durch den Klimawandel eine Häufung solcher Extremereignisse gibt, liegt auf der Hand.
Am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) vermutet man zumindest einen Zusammenhang.
Und auch die Zeit durfte da nicht fehlen:
Analyse: Klimawandel unter Verdacht
Ursache für das Hochwasser in Bayern und Ostdeutschland ist eine ungewöhnliche Großwetterlage - und der Klimawandel könnte eine Rolle dabei gespielt haben.
Latif auf allen Kanälen.
Kaum ein Medium, das auf ihn in dieser wetterkatastrophalen Zeit verzichten wollte.
Selbst der Focus mischte kräftig mit:
FOCUS Online:
Inwiefern bedingt die Klimaerwärmung das Hochwasser?
Latif:
Die Erderwärmung ist trotz kalter Winter global messbar.
In einer wärmeren Welt verdunstet mehr Wasser.
Das ist ein ganz einfaches Naturgesetz:
Höhere Temperaturen führen zu dauerhaft mehr Wasserdampf in der Luft und deshalb auch zu mehr Niederschlägen.
Da ist es dann egal, dass die Erderwärmung in den letzten 15 Jahren gar nicht stattgefunden hat.
Merkt eh keiner, hat sich Latif sicher gedacht.
Ziemlich egal dürfte Latif auch die Ansicht seines Fachkollegen Eduardo Zoritas sein, der zu recht Plausibilitätsprobleme bemängelte.
Auf der Klimazwiebel kommentierte Zorita, dass Europa gerade erst wieder einen der kältesten und längsten Winter der letzten Jahrzehnte erlebt hat und dass es daher schwer vorstellbar sei, die Klimaerwärmung in Deutschland habe jetzt plötzlich zu mehr Wasserdampf in der Atmosphäre geführt.
Fakten, Fakten, Fakten
Was war eigentlich passiert?
Auf Spiegel Online fasste Axel Bojanowski die wichtigsten Fakten zum deutsch-österreichisch-tschechischen Hochwasser 2013 gut zusammen:

Weiterlesen
↑ Flutkatastrophen am bayerischen Ammersee vor allem während solarer Schwächephasen?
-
Die kalte Sonne (Fritz Vahrenholt & Sebastian Lüning)
2013-06-23 de Flutkatastrophen am bayerischen Ammersee vor allem während solarer SchwächephasenDie simplistische Verkürzung auf "mehr CO₂ gibt mehr Hochwasser" wird der Komplexität der Materie sicher nicht gerecht.
Immer wenn die Sonne schwach war, kam es zu vermehrten Fluten am Ammersee.
↑ Neue begutachtete Studie in Nature Climate Change: Klimawandel lässt Hochwasser in Europa wohl in Zukunft seltener werden?
-
Die kalte Sonne (Fritz Vahrenholt & Sebastian Lüning)
2013-06-11 de Neue begutachtete Studie in Nature Climate Change: Klimawandel lässt Hochwasser in Europa wohl in Zukunft seltener werdenDie Hochwasser-Häufigkeitsentwicklung am Ammersee für die vergangenen 450 Jahre.
Es ergab sich eine ausgezeichnete Korrelation mit der Sonnenaktivität.
Immer wenn die Sonne schwach war, kam es zu vermehrten Fluten am Ammersee.
Auch in einem neueren Paper vom Februar 2013 in den Quaternary Science Reviews wiesen die Forscher erneut auf diesen erstaunlichen Zusammenhang hin.
↑ 2012
↑
Mehr Überflutungen in Kälteperioden als in Wärmeperioden
en A 1600 yr seasonally resolved record of
decadal-scale flood variability from the Austrian Pre-Alps
-
Die kalte Sonne (Fritz Vahrenholt & Sebastian Lüning)
2012-10-23 de Flüsse im Alpenvorland halten sich nicht an die IPCC-Vorgaben: Mehr Überflutungen in Kälteperioden als in WärmeperiodenHäufungen von Überflutungen
fanden die Forscher für die Zeit der Kälteperiode der Völkerwanderungszeit (450-480, 590-640 und 700-750 n. Chr.), im Mittelalter (1140-1170 n. Chr.), sowie während der Kleinen Eiszeit (1300-1330 und 1480-1520 n. Chr.).
Episoden mit geringer im Frühlings- bzw. Sommer-Überflutungsneigung
ereigneten sich hingegen während der Mittelalterlichen Wärmeperiode ( 1180-1300 n. Chr.) sowie während der kältesten Phase der Kleinen Eiszeit (1600-1700 n. Chr.).
Das rekonstruierte Muster ist also deutlich komplexer als von vielen angenommen.
Vielleicht sollten die Klimamodellierer einmal diese neuen Daten nehmen und versuchen, die ermittelte Entwicklung numerisch nachzuvollziehen.
Quelle / Source:
-
Geology
Tina Swierczynski, Achim Brauer, Stefan Lauterbach, Celia Martín-Puertas, Peter Dulski, Ulrich von Grafenstein, Christian Rohr
2012-11 en A 1600 yr seasonally resolved record of decadal-scale flood variability from the Austrian Pre-Alps
↑
Zehn Jahre nach dem Elbe-Hochwasser:
Aus der Flut gelernt?
-
Tagesspiegel
2012-08-12 de Zehn Jahre nach dem Elbe-Hochwasser: Aus der Flut gelernt?Im August 2002 standen große Teile Sachsens, Sachsen-Anhalts und schließlich Niedersachsens unter Wasser,
in Prag und Bayern wurde gegen die Fluten gekämpft.
Die Flüsse sollten mehr Raum bekommen, schworen danach alle.
Viel ist daraus nicht geworden.
Am 12. und 13. August 2002 regnete es über den Ostalpen, dem Erzgebirge und den Karpaten praktisch ohne Pause.
Schon vom 7. bis 11. August hatten Starkregenereignisse in Österreich, Tschechien und Sachsen die Wasseraufnahmefähigkeit der Böden teilweise überschritten.
Und dann kam das Tiefdruckgebiet "Ilse".
Die Regenwolken der sogenannten Fünf-b-Wetterlage (Vb) - blieben an den Mittelgebirgen hängen, bis die gewaltigen über dem Mittelmeer aufgenommenen feuchten Luftmassen sich komplett entladen hatten.
Am 12. August verwüstete das Flüsschen Müglitz die Erzgebirgsorte Glashütte und Weesenstein.
Oberhalb von Glashütte war der Damm eines in den 50er Jahren errichteten Rückhaltebeckens gebrochen.
Eine Flutwelle mit 50 000 Kubikmeter Wasser ergoss sich in die sonst durch teure Uhren bekannte Kleinstadt.
In Weesenstein riss die Müglitz zehn Häuser komplett mit sich, verwüstete Teile des Schlosses und vor allem dessen Gärten.
Das Bild einer Familie, die 13 Stunden auf der letzten Mauer ihres Hauses, die gerade mal 36 Zentimeter maß, umtost von den Wassermassen ausharrte, ging um die Welt.
Am gleichen Tag verwüstet die Mulde die sächsische Stadt Döbeln, deren Innenstadt auf einer Insel liegt.
Am 13. August setzt die Mulde ihr Zerstörungswerk in Grimma fort.
Dresden wird gleich zwei Mal getroffen.
Am 12. und 13. August fließt die Weißeritz in ihrem alten Flussbett durch die Innenstadt.
Am 16. und 17. August erreicht die Elbe mit sagenhaften 9,40 Metern ihren historischen Höchststand.
Die weltbekannten Kunstsammlungen der Stadt mussten in höhere Stockwerke geschleppt werden - 11 000 Skulpturen und 700 Gemälde wurden gerettet.
Wenige Tage vorher am 14. August hatte die Katastrophe bereits die tschechische Hauptstadt Prag erreicht.
220 000 Menschen mussten ihre Wohnungen verlassen, 17 Menschen starben allein dort.
Die Moldau stieg auf 7,82 Meter an und flutete die U-Bahn- Stationen der Innenstadt.
Mehr als 15 Kilometer Tunnel standen unter Wasser.
"Es hat acht Monate gedauert, bis auch die letzte Metro-Station wieder in Betrieb war", sagte Jan Cibulka, der damals in Prag für den öffentlichen Nahverkehr zuständig war, der Nachrichtenagentur dpa.
Von Sachsen aus wälzte sich das Elbhochwasser dann in Richtung Norden.
Entlang der Elbe und ihres Nebenflusses Mulde brachen mehrere Deiche.
Erst Ende August normalisierte sich die Lage entlang der Flüsse.
Die Bilanz der Katastrophe in Deutschland:
370 000 Menschen waren unmittelbar vom Hochwasser betroffen.
21 Menschen starben.
Die volkswirtschaftlichen Schäden, zunächst mit 9,2 Milliarden Euro angegeben, stiegen nach einer Nacherhebung in Sachsen 2003 auf mehr als elf Milliarden Euro.
Neben Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Niedersachsen gab es auch in Bayern, vor allem in Regensburg, hohe Schäden.
In ganz Europa betrugen die volkswirtschaftlichen Schäden der Augustflut 2002 mehr als 15 Milliarden Euro.
Allein in Deutschland sind 350 Millionen Euro privater Spenden eingegangen.
Es dauerte sechs Jahre, bis die Hilfsorganisationen das Geld an die Flutopfer verteilt hatten.
Noch immer sind 300 Millionen Euro aus dem sächsischen Fluthilfetopf nicht ausgegeben.
Bis 2020 sollen davon weitere Deiche ertüchtigt werden.
Dennoch ist der Wiederaufbau fast überall abgeschlossen.
Der Oberbürgermeister von Grimma, Matthias Berger (CDU), sagt in jedes Mikrofon:
"Heute ist Grimma schöner als je zuvor."
Ziemlich schnell war vergessen, dass 2002 alle Politiker geschworen hatten, den Flüssen mehr Platz geben zu wollen.
Der sächsische Umweltminister Frank Kupfer (CDU) erinnerte in seiner Regierungserklärung vor wenigen Tagen daran, dass "der Mensch dem Fluss im Wege ist, nicht umgekehrt".
Doch Lehren sind daraus nur teilweise gezogen worden.
↑ Mehr Überschwemmungen? Vermutlich eher nicht
-
Die kalte Sonne (Fritz Vahrenholt & Sebastian Lüning)
2012-03-13 de Mehr Überschwemmungen? Vermutlich eher nichtDie im 20. Jahrhundert erkennbare Zunahme der Pegeldurchflüsse sind in ähnlicher Form seit 1500 bereits mehrfach aufgetreten.
Phasen von Hochwasser-Häufungen wurden in den letzten 500 Jahren regelmäßig wieder durch Phasen deutlich reduzierten Hochwasserauftretens abgelöst.
Zu den Hochwasserereignissen sagt der Deutsche Wetterdienst:
"Bei extremen Wetterereignissen sind in Deutschland hingegen bisher keine signifikanten Trends zu beobachten gewesen.
Auch solche Ereignisse wie die Hochwassersituation 2002 gehören zum normalen Repertoire unseres Klimas."
⇧ 2011
↑ en California: Central Valley Flood Risk
-
Sacramento District
2011-07-20 en Central Valley Flood Risk
Central Valley Flood Risk
It will happen again: the ARkStorm Scenario
The ARkStorm scenario was prepared by the US Geological Survey, who gathered a team of 117 scientists and engineers - with contributions from 42 Federal, California, and local agencies and universities.
▶Hochwasserschutz in Kalifornien
⇧ 2010
↑ en California: This is ARkStorm
-
USGS Multi Hazards
2010-12-13 en This is ARkStorm
This is ARkStorm
This is a short film describing the ARkStorm Scenario
by director, Theo Alexopolous, and DesignMatters, Art Center College of Design in Pasadena.
The ARkStorm Scenario, led by the USGS and more than 100 scientists and experts from varied disciplines, details impacts of a scientifically plausible storm similar to the Great California Storm of 1861-62 in the modern day.
The scenario led to several important scientific advancements and will be used by emergency and resource managers to improve partnerships and emergency preparedness.
▶Hochwasserschutz in Kalifornien
⇧ 2009
↑ Obama flunks Global Warming 101 on Fargo
-
SOTT / Dr. Tim Ball Canada Free Press
2009-04-20 en Obama flunks Global Warming 101 on FargoPresident Obama used recent flooding in Fargo, North Dakota to push his misguided belief in global warming.
His comment, "If you look at the flooding that's going on right now in North Dakota and you say to yourself, 'If you see an increase of two degrees, what does that do, in terms of the situation there?'" is speculative and completely wrong.
A two-degree warmer North Dakota would mean less snowfall, therefore less flooding.
Spring flooding along the Red River of the north is due to snow melt and the geography of the region.
This year the cold winter caused heavy snow in the south basin and all across the northern continental US.
Obama's comments do what the focus on global warming does; diverts us from real issues.
In this case it is flooding and people living in naturally high-risk areas.
⇧ 2007
↑ Doku 2007: Stürme, Fluten Hitzewellen: Deutschland im Klimawandel
-
meinereiner2011
2019-09-30 de Stürme, Fluten Hitzewellen:
Deutschland im Klimawandel (Doku, 2007)
Stürme, Fluten Hitzewellen:
Deutschland im Klimawandel (Doku, 2007)
Eine Doku, die ich seinerzeit auf DVD gebannt habe.
Beim "Ausmisten" habe ich die heute gefunden und ich finde es Interessant und Erschreckend mit den jetzt vergangenen 12 Jahren diese zu sehen und mit den aktuellen Werten abzugleichen.
Es hat sich nicht viel geändert, bzw. es fängt nun an sich vielleicht was zu ändern.
↑ Fünf Jahre nach der Elbeflut
-
WWF
2007-06 de Fünf Jahre nach der ElbeflutWurden und werden öffentliche Finanzhilfen im Sinne eines nachhaltigen Hochwasserschutzes verwendet?
Wie aus dem Ruf nach mehr Raum für die Flüsse und Rückbau in den Flussräumen die Finanzierung von Deichbauten, Stauwehren und Straßen wurde.
Nach der Oder-Flut 1997 wurde der Ruf laut,
den Flüssen wieder mehr Raum zurückzugeben.
Hochwasserschutz sollte künftig nicht mehr in Katastrophenbewältigung bestehen, sondern in einer nachhaltigen Hochwasservorsorge.
Die Politik, bis hin zu Bundeskanzler Helmut Kohl, griff diese Forderung wortstark auf.
Begründet war die Forderung in der Feststellung, dass die Flüsse in der Vergangenheit den Großteil ihrer natürlichen Überschwemmungsflächen durch Besiedelung, Flussbegradigungen und Eindeichungen verloren hatten.
So ist diese Fläche beispielsweise an der Elbe auf kümmerliche vierzehn Prozent geschrumpft worden.
Vor allem dadurch, dass natürliche Hochwässer seither in künstlich verschmälerten und begradigten Rinnen abfließen müssen, erreichen die Fluten die aktuellen Höhen und Geschwindigkeiten.
Erst dadurch, dass direkt am Flussufer und flächenhaft hinter den Deichen in den historischen Überflutungsräumen Wohnhäuser, Gewerbe und öffentliche Infrastruktur errichtet wurden, gefährden die Fluten die Menschen und die von ihnen geschaffenen Werte.
Nach der Jahrhundertflut 2002 an der Elbe und deren Zuflüssen, stellte man fest, dass der Forderung von 1997 keine Taten gefolgt waren.
Die neuen Schäden in Milliardenhöhe, die neben mehreren Menschenleben zu beklagen waren, wurden zum Anlass genommen, nun doch endlich die Weichen hin zu einem nachhaltigeren vorbeugenden Hochwasserschutz umzulegen.
Nun sollte tatsächlich den Flüssen mehr Raum gegeben werden, was letztlich auf großzügige Rückdeichungen hinauslaufen sollte.
Zugleich sollte bereits der Entstehung von Hochwassern entgegengewirkt werden, indem insbesondere bei Starkregenereignissen der Wasserrückhalt in der Fläche erhöht werden sollte.
Dazu sollten der Boden verbessert, umfangreiche Aufforstungsprogramme in Hochwasserentstehungsgebieten (Gebirgsregionen) vorgenommen und vor allem die Neuversiegelung von Flächen gestoppt werden.
Nicht zuletzt sollten Hochwasserschutzmaßnahmen mit den ohnehin erforderlichen Maßnahmen zur ökologischen Aufwertung der Gewässer verbunden werden, die die Wasserrahmenrichtlinie der EU bis 2015 fordert.
Einige Zitate
Seite 45
Beurteilung der Nachhaltigkeit Das Vorgehen im Verfahren ist als besonders deutlicher Fall von Nichtbeachtung nachhaltiger Planungsgrundlagen einzustufen: Das Vorhaben ist hochwasserschutztechnisch nicht notwendig.
Sonstige Zwecke könnten deutlich geringerem Aufwand realisiert werden.
Weiter entsteht durch die erweiterte Wehranlage selbst ein neues, unnötiges Schadenspotential im Hochwasserfall.
Seite 46
Sachverhalt
Das als Regenrückhaltebecken in Rossau angelegte Gewässer wird ständig als Wasserskianlage genutzt.
Durch den erhöhten Wasserstand im Regenrückhaltebecken, der notwendig zum Betrieb der Wasserskianlage ist, steht nicht mehr genügend Rückhaltevermögen zur Verfügung.
Ihren eigentlichen Zweck zum Regenrückhalt kann die Anlage dadurch nicht mehr wie vorgesehen erfüllen.
Seite 46
Insgesamt ist daher festzustellen:
Öffentliche Mittel für den Hochwasserschutz wurden zweckentfremdet.
Durch den künstlichen, zentral gesammelten Anstau des Regenwassers entsteht eine zusätzliche Gefahrenquelle bei Starkregen.
Das Gefahrenpotential wird hier vermutlich durch die Nutzung und die Ausführung des Regenrückhaltebeckens künstlich geschaffen.
Seite 47
Die Funktionen der Polizeidirektion Westsachen und des Polizeireviers Grimma können im Falle eines Extremhochwasserereignisses nicht sicher aufrechterhalten werden.
Dieses Risiko sollte nicht eingegangen werden, da gerade diese Institutionen maßgeblich in die Koordinierung extremen Hochwasserereignissen und bei Katastrophenfällen eingebunden sind.
Zusätzlich stellt das neu errichtete Quergebäude zwischen den beiden Hauptgebäuden ein bedeutendes Abflusshindernis in der Muldenaue dar.
Durch die neue Gebäudeverbindung entsteht ein geschlossener Querriegel von ca. 100 m Länge.
Nach der aktuell gültigen Rechtslage (vom 1. September 2003) wäre das Projekt nach § 100 Absatz 2 Nr. 4 SächsWG nicht genehmigungsfähig.
Außerdem werden durch die Neubauten ca. 0,2 ha Flussaue im Überschwemmungsgebiet neu versiegelt.
Insgesamt entsteht auch ein erhöhtes Schadenspotential durch die Lage der wichtigen Verwaltungsgebäude in der Flussaue.
Seite 49
Durch die ungerechtfertigte Finanzierung der Baumaßnahmen werden der wirklichen Zielsetzung des Fördermittelprogramms wichtige Finanzmittel entzogen.
Diese Summen fehlen dann an anderer Stelle.
Unter den Aspekten einer zukünftigen Unterhaltungslast werden die Straßen ein erhebliches Finanzierungsproblem für die verschiedenen Träger darstellen.
Bisher konnten notwendige Gelder zum Erhalt dieser Infrastruktur gerade nicht beschafft werden.
Ausgerechnet mit Hochwassergeldern erfolgten Neuversiegelungen von Flächen, die bisher der Retention zur Verfügung standen.
Seite 86
Nachhaltigkeitsprüfung
Festzuhalten ist, dass es in Niedersachsen keine ausdrückliche Hochwasserschutzstrategie auf Landesebene gibt.
Die Zuständigkeit liegt hier bei den Gemeinden.
Damit entspricht der Hochwasserschutz in Niedersachsen im Wesentlichen schlicht einer Anwendung bestehender Gesetze bei der kommunalen Planung (Bauleitplanung) und im Bauordnungsrecht.
Naturnahe Gestaltung der Oberflächengewässer (Nachhaltigkeitsaspekt (4.)) ist in Niedersachsen ein Thema, steht aber in keinem ausdrücklichen Zusammenhang mit dem Hochwasserschutz.
⇧ 2003
↑ Zur Temperatur- und Hochwasserentwicklung der letzten 1000 Jahre in Deutschland
-
DWD Klimastatusbericht 2003
R. Glaser, Ch. Beck, H. Stangl
2003 de Zur Temperatur- und Hochwasserentwicklung der letzten 1000 Jahre in
Deutschland
(Wayback‑Archiv)
Zur Temperatur- und Hochwasserentwicklung der letzten 1000 Jahre in
Deutschland
(Wayback‑Archiv)

 Hochwassermarken in Eibelstadt am Main
Hochwassermarken in Eibelstadt am Main
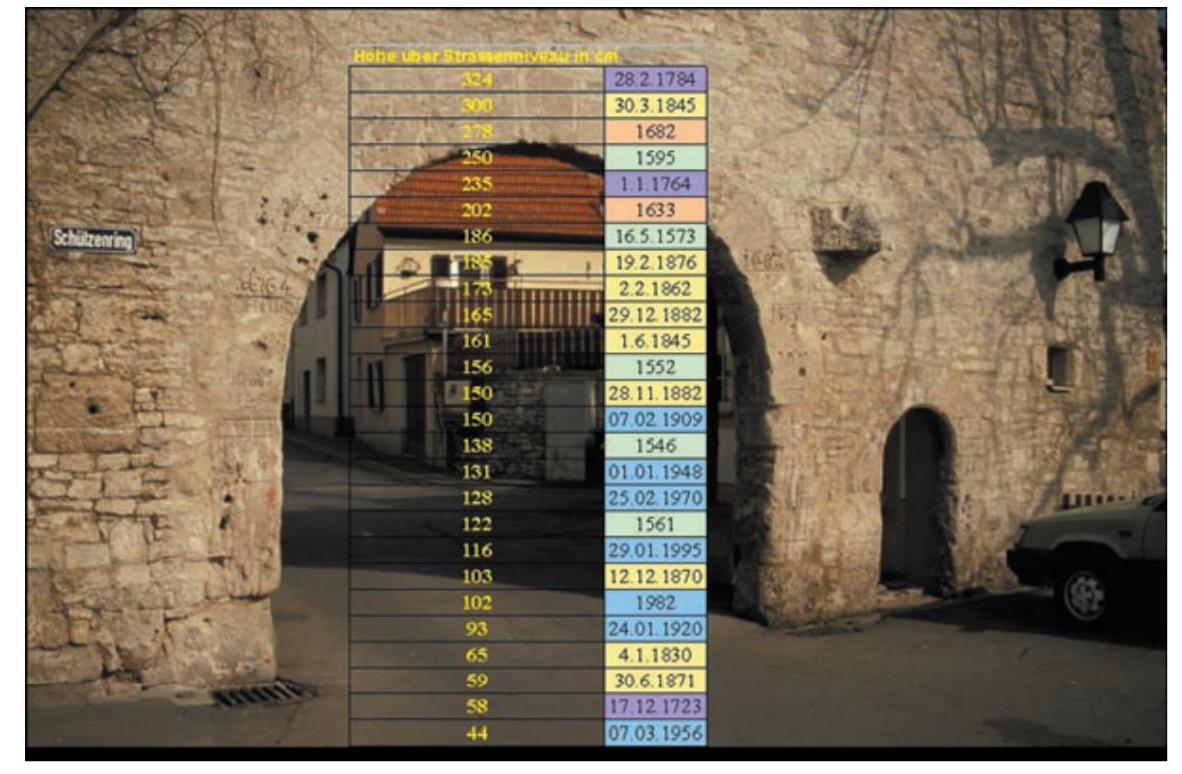
Schlussfolgerungen und Perspektiven
Das Klima, sein Wandel und insbesondere klimabedingte Katastrophen zogen zu allen Zeiten ein großes öffentliches Interesse auf sich - wenn auch die Wahrnehmungsund Interpretationsmuster im Laufe der Zeit einem beträchtlichen Wandel unterzogen waren.
Die Analyse historischer Aufzeichnungen ermöglicht Rekonstruktionen von Hochwasserereignissen und klimatischen Parametern ab etwa dem Jahr 1000 n.Chr.
Betrachtet man die Ergebnisse, so wird zunächst offensichtlich, dass es zu allen Zeiten klimatische Extremereignisse gab.
Immer wieder wurde die Bevölkerung von Hitzewellen und Dürren, Frostperioden und Starkniederschlägen überrascht.
In manchen Regionen übertrafen einzelne Hochwasserereignisse die "Jahrhunderthochwässer" des vergangenen Jahrzehnts deutlich.
Ein Blick auf die langen Reihen offenbart die hohe Variabilität des mitteleuropäischen Klima- und Hochwassergeschehens.
Während einzelne Temperatur- und Niederschlagstrends des vergangenen Jahrhunderts auch im historischen Vergleich bemerkenswert erscheinen, waren andererseits unsere Vorfahren in den in dieser Studie diskutierten Flußgebieten offenbar zeitweise einem höheren Hochwasserrisiko ausgesetzt.
Unter diesem Eindruck erscheint so manches Bild von "niedagewesenen Klimakapriolen" oder den "hausgemachten Hochwässern" in einem anderen Licht.
Weitergehende Untersuchungen sollen die Bedeutung der verschiedenen Einflußfaktoren erhellen und so eine wichtige Grundlage für gesellschaftliche Bewertungen und die Ableitung möglicher Handlungsszenarien liefern.
⇧ 2002
↑ Hochwasser am Main
-
Klima Notizen.de / Klaus Öllerer
2002 de Hochwasser am MainHochwasser am Main 1500-2000
⇧ 1910
↑ Überflutungen 1910 in Paris
Paris 1910
-
2012-04-29 fr
 INONDATIONS DE 1910 à PARIS.wmv
INONDATIONS DE 1910 à PARIS.wmv
(Expositions de 2010 à paris et en banlieu pour commémorer les inondations)
⇧ 1861/62
↑ en California Megaflood 1861/62
"A 43-day storm that began in December 1861 put central and southern California underwater for up to six months, and it could happen again."
![]()
![]() Lithograph of K Street in Sacramento, CA during the 1862 flood
Lithograph of K Street in Sacramento, CA during the 1862 flood

-
Wikipedia
de
Große Flut von 1862
en Great Flood of 1862
fr Grande inondation de 1862
-
Wikipedia
de
Sacramento
en Sacramento, California
fr Sacramento
-
Watts Up With That? (Antony Watts)
2017-02-17 en California's past megafloods - and the coming ARkStormSummary
To boost our fear, activists and journalists report the weather with amnesia about the past.
Ten year records become astonishing events;
weather catastrophes of 50 or 100 years ago are forgotten.
It makes for good clickbait but cripples our ability to prepare for the inevitable.
California's history of floods and droughts gives a fine example - if we listen to the US Geological Survey's reminder of past megafloods, and their warning of the coming ARkStorm.
⇧
7 Wassermenge
en Water amount
fr Débit d'eau
Mit folgenden Links wird von anderen Webseiten auf diese Seite verwiesen:
| de | en | fr |
|---|---|---|
|
Wetterphänomene Wassermenge |
Weather phenomena Water amount |
Phénomènes météorologiques Débit d'eau |
- Verzeichnis │ Allgemein │ Text
⇧ de Verzeichnis en Contents fr Sommaire
- 2016
- de Klimamodelle hinterfragt: Wasserhaushalt schwankte im 20. Jahrhundert weniger stark als erwartet
- 2015
- de Der Tag, an dem es einen ganzen Zürichsee regnete
- 2010
- de
Sonnenaktivität und Wassermengen in Flüssen und Seen
en Solar to river flow and lake level correlations - de
IPCC unterschlägt die Abnahme der Gefahr von Wassermangel in der
Zukunft
en The IPCC: Hiding the Decline in the Future Global Population at Risk of Water Shortage
⇧ de Allgemein en General fr Générale
|
| de | en | fr |
|---|---|---|
| Wasser, Land, Nahrung Wasser |
Water, Land, Food Water |
Eau, terre, nourrit Eau |
| Wassermangel | ||
⇧ de Text en Text fr Texte
⇧ 2016
↑ Klimamodelle hinterfragt: Wasserhaushalt schwankte im 20. Jahrhundert weniger stark als erwartet
-
Die kalte Sonne (Fritz Vahrenholt & Sebastian Lüning)
2016-04-14 de Klimamodelle hinterfragt: Wasserhaushalt schwankte im 20. Jahrhundert weniger stark als erwartet
⇧ 2015
↑ Der Tag, an dem es einen ganzen Zürichsee regnete
-
Zürichsee-Zeitung / Martin Steinegger
2015-05-08 de Der Tag, an dem es einen ganzen Zürichsee regneteWie viel Wasser kann es in der Schweiz an einem Tag regnen?
Meteoschweiz gibt in einem aktuellen Blogbeitrag dazu die Antwort:
Einmal den ganzen Zürichsee.Der regenreichste Tag seit 1961 war der 7. August 1978.
An diesem Tag fielen gemäss der Berechnung von Meteoschweiz 3,6 km3 (Kubikkilometer) Wasser.
Das entspricht 3,6 Milliarden Kubikmeter. Oder anders umgerechnet:
es entspricht ziemlich genau dem Wasservolumen des Zürichsees, der etwa 3,9 Kubikkilometer fasst.Güterzug, 16-Mal um die Erde gewickelt
In der Schweiz kann es also an einem Tag einen ganzen Zürichsee regnen. Meteoschweiz bietet dazu eine anschauliche Umrechnung:
Würde man diese Wassermenge auf Kesselwagen der SBB verteilen, die 85000 Liter fassen und gut 15 Meter lang sind, benötigte man rund 42 Millionen Wagen.Aneinandergereiht würden diese einen 640000 Kilometer langen Zug bilden.
Diesen könnte man 16-Mal um die Erde «wickeln».
Auf Rang zwei der niederschlagsreichsten Tage folgen übrigens der 21. Dezember 1991 und der 8. August 2007.
An diesen beiden Tagen fielen aber gemäss Meteoschweiz deutlich geringere Wassermengen.
Oder anders ausgedrückte: es regnete keinen ganzen Zürichsee - sondern eher einen Walensee.
⇧ 2010
↑
Sonnenaktivität und Wassermengen in Flüssen und Seen
en
Solar to river flow and lake level correlations
|
|
|
|
de Korrelation zwischen der Sonnenaktivität (gemessen an der Zahl der Sonnenflecken) und der Wassermenge, die der südamerikanische Fluß Parana führt. Der Parana ist der zweitgrößte Fluß Südamerikas. Der gewaltige Itaipu-Damm mit einer installierten Kraftwerksleistung von 14.000 MW staut den Parana. |
en The figure above is after a figure from Maus et al 2010 "Long term solar activity influences on South American rivers". It shows a very good correlation between solar activity, as measured by sunspot number, and the flow rate of the Parana River, the second largest river in South America. The Parana River now hosts the Itaipu Dam with installed capacity of 14,000 MW. |
|
|
Die AGW-Anhänger behaupten, der Einfluß der Sonne auf das Klima sei gering, da sich der Betrag der Sonnenstrahlung nur gering mit dem Sonnenfleckenzyklus ändere. Wenn aber die Sonnenaktivität offenbar die Wassermengen in Flüssen und Seen steuert, ist ein Einfluß auf andere Aspekte des Wettergeschehens mindestens plausibel. |
|
de Der nur sehr zögerlich gestartete und sich schwach entwickelnde Zyklus 24 läßt angesichts des Einflusses auf die Flüsse verschiedene Folgen erwarten:
Wenn diese vorhergesagte Folgen eines schwachen Sonnenfleckenzyklus 24 eintreten, werden die CAGW-Anhänger zweifellos versuchen, sie als Konsequenzen der vermeintlichen globalen Erwärmung zu vermarkten - selbst wenn es bis dahin global kälter werden sollte. |
en Given the link between East African and central South American rainfall and solar activity, the list of economic impacts from the current solar minimum (Solar Cycles 24 and 25) can be expanded to:
This list is by no means exhaustive. The last time the world witnessed mass starvation was the 1965-67 drought in India which killed 1.5 million people. Things don't look pretty. |
↑
IPCC unterschlägt die Abnahme der Gefahr von Wassermangel in der
Zukunft
en
The IPCC: Hiding the Decline in the Future Global Population at Risk of
Water Shortage
-
Watts Up With That? (Antony Watts)
2010-01-18 en The IPCC: Hiding the Decline in the Future Global Population at Risk of Water ShortageThis is an error, based not on blunders or poor scholarship but on selective reporting of results, where one side of the story is highlighted but the other side is buried in silence.
In other words, it's a sin of omission, that is, it results, literally, from being economical with the truth.
It succeeds in conveying an erroneous impression of the issue - similar to what "hide the decline" did successfully (until Climategate opened and let the sunshine in).
-
IPCC Figure SPM.2
en Key impacts as a function of increasing global average temperature change
-
Arnell (2004), Table 10
en Number of people (million) with an increase or decrease in water stress
⇧
8 Süsswasserflächen
en Fresh water areas
fr Zones d'eau douce
Mit folgenden Links wird von anderen Webseiten auf diese Seite verwiesen:
| de | en | fr |
|---|---|---|
|
Wetterphänomene Süsswasserflächen |
Weather phenomena Fresh water areas |
Phénomènes météorologiques Zones d'eau douce |
-
Die kalte Sonne (Fritz Vahrenholt & Sebastian Lüning)
2017-01-27 de Klimawandel vergößert globale Süßwasserflächen: In den letzten 32 Jahren sind Wassergebiete von 170 mal dem Bodensee dazugekommenIm Dezember 2016 erschien in Nature eine Studie von Pekel et al., die weltweite Veränderungen im Oberflächenwasser während der letzten 32 Jahre anhand von Satellitenbildern kartiert hat.
Das Ergebnis: In einigen Gegenden gibt es jetzt weniger Wasser, in anderen mehr.
Aus dem Abstract:
Between 1984 and 2015 permanent surface water has disappeared from an area of almost 90,000 square kilometres, roughly equivalent to that of Lake Superior, though new permanent bodies of surface water covering 184,000 square kilometres have formed elsewhere.
-
NATURE
2016-12-15 de High-resolution mapping of global surface water and its long-term changes
⇧
9 Auswirkungen auf die Schneebedeckung
en Effects on Snow Sover
fr Effets sur la couverture neigeuse
Mit folgenden Links wird von anderen Webseiten auf diese Seite verwiesen:
| de | en | fr |
|---|---|---|
|
Wetterphänomene Auswirkungen auf die Schneebedeckung |
Weather phenomena Effects on snow cover |
Phénomènes météorologiques Effets sur la couverture neigeuse |
Links zur Klimaschau
|
|
▶Schnee |
⇧ de Verzeichnis en Contents fr Sommaire
- 2019
- en
Northern Hemisphere snow cover trends (1967-2018):
A comparison between climate models and observations - 2018
- de
 Schnee- und Temperaturtrends in den Alpen: 120 Jahre
Klimageschichte rund um den Arlberg
Schnee- und Temperaturtrends in den Alpen: 120 Jahre
Klimageschichte rund um den Arlberg
- 2017
- de
Weisse Weihnachten
Deutscher Wetterdienst: Keine generelle Abnahme von Weißen Weihnachten in Deutschland für die vergangenen 50 Jahre feststellbar.
Schweiz: Das Märli von weissen Weihnachten - de Alpenklima verständlich dargestellt: Günther Aigner präsentiert Temperatur- und Schneetrends aus Kitzbühel
- de Stark schwankende Schnee-Entwicklung in der Schweiz offenbar eng an Ozeanzyklen gekoppelt
- de Schnee von gestern: Österreichische Schneetrends im historischen Kontext
- 2016
- de Schneemessreihen aus Lech und Zürs
- 2015
- de Winterchronik Deutschland
- de
Das Märli von weissen Weihnachten
en Zurich's Record String Of SNOWLESS Christmases Was Set In 1940s! ...No Trend Over Past 80 Years - 2011
- en Frequency of Big Snows: Northeast U.S. and Colorado
- 2010
- en Snow Season Off to a Roaring Start
- en No significant trend in S. Sierra snowfall since 1916
- 2008
- en Northern Hemisphere Snow Cover Anomalies 1966-2008 January
⇧ de Allgemein en General fr Générale
| de | en | fr |
|---|---|---|
|
Neue Kälteperiode Meldungen |
New Cold Period News |
Nouvelle periode froide Actualités |
| de | en | fr |
|---|---|---|
|
Auswirkungen des Klimas Gletscher |
Impacts of Climate Change Glaciers |
Impacts du changement climatique Glaciers |
⇧ Welt-Info
|
|
Schnee |
| ▷Die Kalte Sonne Blog‑Themen Vahrenholt/Lüning ▶Die kalte Sonne | de ▷Schnee |
| Wikipedia |
de
Schnee en Snow fr Neige |
| Vademecum |
▶Schnee
▶Welt-Info |
| Siehe auch |
▶Alpen
▶Gletscher ▶Bergsturz |
⇧ de Text en Text fr Texte
⇧ 2019
↑
Northern Hemisphere snow cover trends (1967-2018):
A comparison between climate models and observations
-
Watts UP With That? (Anthony Watts)
2019-03-22 en Northern Hemisphere snow cover trends (1967-2018):
A comparison between climate models and observationsAccording to the climate models, snow cover should have steadily decreased for all four seasons.
However, the observations show that only spring and summer demonstrates a long-term decrease.
⇧ 2018
↑ Schnee- und Temperaturtrends in den Alpen: 120 Jahre Klimageschichte rund um den Arlberg
-
Günther Aigner
2018-02-01 en Lech-Zürs: Eine Analyse historischer Temperatur- und Schneemessreihen
Lech-Zürs: Eine Analyse historischer Temperatur- und Schneemessreihen
Agenda:
de Deutsche Untertitel können "angeklickt" werden.
en GERMAN SUBTITLES AVAILABLE! Please find this Speech with English Subtitles in our YouTube-Channel.
-
01:25 - Zitate des Kulturpessimismus
-
06:52 - Wintertemperaturen am Galzig (und Säntis, CH)
-
14:34 - Schneemessreihen aus Lech
-
22:39 - Schneemessreihen aus Zürs
-
25:52 - Die Entwicklung der Skisaisonlängen (Tage mit Skibetrieb)
-
27:51 - Klimatische Entwicklung der Bergsommer
-
33:26 - Zusammenfassung
-
34:58 - Beantwortung der Eingangsfrage
-
35:51 - Fachlicher Austausch (Experten)
-
36:05 - Literatur und Messdaten
-
36:22 - Biografie Günther Aigner
Vortrag in der "Postgarage Lech" am 01. Februar 2018.
Der Tiroler Skitourismusforscher Günther Aigner gibt einen spannenden Überblick über mehr als 120 Jahre Klimageschichte rund um den Arlberg.
Mit Hilfe von amtlichen Messdaten geht er verschiedenen Fragen nach:
Stimmt es, dass es in Lech früher mehr geschneit hat?
Um wie viel Grad Celsius haben sich die Winter am Arlberg (Galzig) in den letzten Jahrzehnten erwärmt?
Stimmt es, dass die Skisaisonen deshalb immer kürzer werden?
Oder gibt es eine Lücke, die zwischen der öffentlicher Wahrnehmung und den amtlichen Messdaten klafft?
-
Die kalte Sonne (Fritz Vahrenholt & Sebastian Lüning)
2018-02-27 de Schnee- und Temperaturtrends in den Alpen: 120 Jahre Klimageschichte rund um den ArlbergKlimadiskussion in der Sackgasse.
Am Ende zählen nur harte Fakten, langjährige Klimareihen und der vorindustrielle Kontext, der bitte nicht erst in der Kleinen Eiszeit beginnt, sondern auch frühere Wärmephasen mit einschließt.
Der Tiroler Skitourismusforscher Günther Aigner hat dies längst erkannt und setzt sich engagiert für eine rationale Diskussion auf solider Datengrundlage ein.
In mühsamer Fleißarbeit hat er Klimadaten zu Schnee und Temperaturen in den Alpen gesammelt und in anschaulichen Abbildungen zusammengestellt.
Am 1. Februar 2018 hielt er einen sehenswerten Vortrag in der "Postgarage Lech", den sich alle Klimainteressierten und regionalen Entscheidungsträger der Alpenregion auf jeden Fall anschauen sollten:
⇧ 2017
↑ Weisse Weihnachten
-
Die kalte Sonne (Fritz Vahrenholt & Sebastian Lüning)
2017-12-31 de Deutscher Wetterdienst: Keine generelle Abnahme von Weißen Weihnachten in Deutschland für die vergangenen 50 Jahre feststellbarVor kurzem war Weihnachten. Viele Mitmenschen verbinden damit ein lustiges Schneegestöber, aus dem dann der Weihnachtsmann auf seinem Rentierschlitten auftaucht, um seine Geschenke zu verteilen.
Wenn dann in Wirklichkeit weder Schneegestöber, noch Rentier, noch Weihnachtsmann erscheinen, ist die Enttäuschung groß.
Sind unsere Erwartungen überhaupt realistisch?
Hat es in der Vergangenheit in Deutschland stets geschneit, bevölkern riesige Rentierhorden die germanischen Wälder und gibt es den Weihnachtsmann überhaupt?
Hanna Zobel vom Spiegel-Jugendmagazin Bento ging am 21. Dezember 2017 der ersten dieser Fragen nach und befragte den Deutschen Wetterdienst:
-
beneto / Hanna Zobel
2017-12-21 de Gab es früher öfter Schnee an Weihnachten?Gab es früher öfter Schnee an Weihnachten?
Klären wir das - ein für alle Mal.
Ja, ja, früher war alles besser.
Vor allem an Weihnachten!
Da gab's noch richtig Schnee. [...]
Aber stimmt das überhaupt?
Gibt es heute wirklich seltener Weiße Weihnachten als in vorigen Jahrzehnten?Wir haben Andreas Friedrich, Meteorologe vom Deutschen Wetterdienst, gefragt. [...]
BENTO: Viele Menschen haben das Gefühl, früher habe es öfter Weiße Weihnachten gegeben. Stimmt das?
DWD: "Nein. Wir haben das mal für die vergangenen 50 Jahre untersucht und können keine generelle Abnahme von Weißen Weihnachten in Deutschland feststellen.
Es war schon immer ein sehr seltenes Ereignis.
Die Statistik zeigt, dass es nur in zehn Prozent der vergangenen 50 Jahre Weiße Weihnachten gab. [...]
BENTO: Also hat sich nichts verändert durch Klimawandel und Erderwärmung?
DWD: "Momentan hat sich das noch nicht so dramatisch ausgewirkt.
Das liegt aber größtenteils daran, dass es in vielen Regionen Deutschlands vor 50 Jahren im Winter so kalt war, dass die durchschnittlich ein bis anderthalb Grad Erwärmung, die wir seit der vorindustriellen Zeit verzeichnen, noch nicht den entscheidenen Impuls gegeben haben.
-
Tages-Anzeiger / Marc Fehr und Marc Brupbacher
2017-12-22 de Das Märli von weissen WeihnachtenAuch dieses Jahr gibt es keine weissen Weihnachten im Flachland.
Wer jetzt denkt, früher habe es an den Festtagen öfter Schnee gegeben, sollte sich diese Daten anschauen.
Lange ist es her:
Richtig weisse Weihnachten gab es in Zürich zuletzt 2003.
Immerhin ein bisschen Schnee gab es nochmals 2010.
Seit nunmehr sieben Jahren ist es nun aber an allen drei Weihnachtstagen grün.
Seit 1931 gab es in Zürich nur 20 Mal wirklich weisse Weihnachten
↑ Alpenklima verständlich dargestellt: Günther Aigner präsentiert Temperatur- und Schneetrends aus Kitzbühel
↑ Stark schwankende Schnee-Entwicklung in der Schweiz offenbar eng an Ozeanzyklen gekoppelt
-
Die kalte Sonne (Fritz Vahrenholt & Sebastian Lüning)
2017-05-25 de Stark schwankende Schnee-Entwicklung in der Schweiz offenbar eng an Ozeanzyklen gekoppelt
↑ Schnee von gestern: Österreichische Schneetrends im historischen Kontext
-
Die kalte Sonne (Fritz Vahrenholt, Sebastian Lüning)
2017-02-02 de Schnee von gestern: Österreichische Schneetrends im historischen KontextDer Fachverband der Seilbahnen Österreichs
Der Fachverband der Seilbahnen Österreichs sieht die Schneelage auf Österreichs Bergen in den nächsten 20 bis 30 Jahren nicht gefährdet
Der Fachverband der Seilbahnen Österreichs hat genug von der Panikmache um die Schneeprognosen und setzt sich zur Wehr.
Im ORF wies der Verband am 1. Dezember 2016 auf die starke natürliche Variabilität der Schneemengen hin:
"Wir wollen aufzeigen, dass vieles, das derzeit medial verbreitet wird, einfach nicht stimmt", betonte Seilbahn-Obmann Franz Hörl am Mittwoch
Recherchen der kalten Sonne:
Fazit der kalten Sonne:
Wieder einmal wird klar, wie wichtig der klimahistorische Weitblick ist.
Klimatische Kurzsichtigkeit führt hier nicht weiter.
Keine Macht der plumpen Schnee-Panikmache!
de Panik-Küche en Panic laboratory fr Marmite alarmiste
Global 2000 und der ZAMG
Anders wird die Lage jedoch von Global 2000 und der ZAMG beurteilt.
Anlass ist eine Studie von Schweizer Lawinenforschern.
ZAMG:
Klimamodelle
sprechen eine andere SpracheAnhand aktueller Daten
Die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) erläuterte auf APA-Anfrage anhand aktueller Daten jedoch,dass Klimamodelle erwarten lassen,
dass die milden Winter auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten häufiger und die kalten Winter seltener werden.Global 2000: Mehr Regen als Schnee
Auch die Umweltschutzorganisation
Global 2000 kann so viel Optimismus im Gespräch mit der APA nicht nachvollziehen.Schon heute
fällt in niedrigen Lagen Niederschlag vermehrt als Regen und weniger als Schnee.Pro Grad Temperaturerwärmung steigt die Schneefallgrenze um etwa 100 Meter und in Österreich ist die Temperatur bereits um zwei Grad gestiegen.
Ein weiterer Anstieg von 1,5 Grad
wird im "Österreichischen Sachstandsbericht Klimawandel" schon in den nächsten Jahrzehnten erwartet, damit ist auch eine Auswirkung auf die Schneelage erwartbar.Die Ergebnisse der Klimaforschung zeigen,
dass in Zukunft auch Lagen zwischen 1.000 und 2.000 Meter stärker betroffen sein werden."Die globale Erwärmung
kann man nicht wegreden, die Effekte sind bereits sichtbar.Wissenschaftliche Untersuchungen
zeigen uns, dass Skigebiete in Österreich großflächig betroffen sein werden.Wir müssen jetzt alles dafür tun,
die globale Erwärmung so weit wie möglich einzudämmen,um unseren Wintersport, wie wir ihn kennen und lieben, zu schützen",
sagte Johannes Wahlmüller, Klima- und Energiesprecher bei Global 2000.
Quelle / Source:
-
ORF
2016-12-01 de Seilbahner: Keine Panik wegen KlimawandelsParth: "Medien verbreiten Horrorszenarien"
Als "schlechte Stimmungsmache für die Branche"
bezeichnete hingegen der Vorstand der Silvretta Seilbahn AG, Hannes Parth, die "Horrorszenarien", die manche Medien verbreiten würden.Und zeichnet seinerseits ein potenzielles Schreckensszenario
am Beispiel von Landeck:Falls alle zehn dortigen Seilbahnen zusperren müssten, würden mehr als 857 Millionen Euro an Bruttoumsätzen wegfallen.
Meteorologe Zenkl will mit seinem Fazit zumindest Skifahrern und Touristikern der nächsten Generation die Angst nehmen:
"Allen Unkenrufen zum Trotz zeigen die alpinen Winter keine auffälligen Klimatrends, und in absehbarer Zukunft wird sich daran nichts Gravierendes ändern.
Die Daten beweisen, dass der alpine Wintersport gesund und gegen die Launen der Natur mittels Schneekanonen sehr gut gerüstet ist."
⇧ 2016
↑ Schneemessreihen aus Lech und Zürs
-
EIKE Europäisches Institut für Klima und Energie
2016-02-18 de Schneemessreihen aus Lech und ZürsDie Skiorte Lech, Zürs, Warth und Schröcken weisen bei westlichen und nördlichen Anströmungen enorme Stauniederschläge auf.
Das Viereck Arlberg / Tannberg / hinterer Bregenzerwald / großes Walsertal zählt zu den schneereichsten Regionen der Alpen. Zwei Messreihen des Hydrographischen Dienstes Vorarlberg finden
⇧ 2015
↑ Winterchronik Deutschland
![]()
![]() Anzahl der Schneetage in Berlin/Potsdam in den letzten 65 Jahren.
Anzahl der Schneetage in Berlin/Potsdam in den letzten 65 Jahren.

-
Die kalte Sonne (Fritz Vahrenholt & Sebastian Lüning)
2015-12-13 de Kurios: Positionspapier der Deutschen Meteorologischen Gesellschaft zum Klimawandel spiegelt laut Vorsitzender nicht die abgestimmte Sichtweise der Gesellschaft wiederAnzahl der Schneetage in Berlin/Potsdam in den letzten 65 Jahren
Vor kurzem durfte Mojib Latif im deutschen Kinderfernsehen seine Überzeugungen verbreiten. Auf logo! behauptete er gegenüber seinem jungen Interviewleiter:
"Als ich so alt war wie Du, war Schnee das normalste auf der Welt. Heute ist das schon die Ausnahme."
Machen wir den Test:
Latif wurde 1954 geboren.
Zu Zeiten seiner Kindheit gab es beispielsweise in Berlin/Potsdam aufs Haar genaus so viele Schneetage wie nach 2000.
Gezeigt sind die Tage mit mehr als 1cm Schneedecke an der Station Potsdam bzw.
Berlin mit einem 7-jährigen gleitenden Mittelwert.
Einen signifikanten Trend für die Winter 1950/51 bis 2014/15 gibt es nicht.
Die Daten streuen dafür viel zu sehr.
Wenn belastbare Tatsachen fehlen werden schonmal Wetter-Mythen bedient...
Quelle / Source:
-
Winter-Chronik de Winter in Deutschland - damals und heute im Vergleich
↑
Das Märli von weissen Weihnachten
en
Zurich's Record String Of SNOWLESS Christmases Was Set In 1940s!
...No Trend Over Past 80 Years
-
Tages-Anzeiger
2015-12-18 de Das Märli von weissen WeihnachtenAuch dieses Jahr gibt es keine weissen Weihnachten im Flachland.
Wer jetzt denkt, früher habe es an den Festtagen öfter Schnee gegeben, sollte sich diese Daten anschauen.
Seit 1931 gab es nur 20-mal wirklich weisse Weihnachten
Ist der Klimawandel schuld daran, dass es so selten weisse Weihnachten gibt?
Nein.
Ein Blick in die Statistik zeigt, auch früher lag am 24., 25. oder 26. Dezember im Raum Zürich nicht öfter Schnee.
Über die fast 80-jährige Messreihe ist kein eindeutiger Trend zu erkennen.
So gab es die längste Phase von grünen Weihnachten von 1941 bis 1949.
-
Die kalte Sonne (Fritz Vahrenholt & Sebastian Lüning)
2015-12-25 de Große Weihnachtsüberraschung: Die längste Phase von grünen Weihnachten in der Schweiz ereignete sich 1941 bis 1949
-
Süddeutsche Zeitung
2015-12-20 de Weiße Weihnachten - ein MythosMinus 13,5 Grad: Den kältesten Heiligabend erlebte München im Jahr 1879.
Sonst ist Schnee an den Feiertagen eher die Ausnahme - auch wenn man das gerne verdrängt.
-
NoTricksZone (Pierre L. Gosselin)
2015-12-22 en Zurich's Record String Of SNOWLESS Christmases Was Set In 1940s! ...No Trend Over Past 80 Years
⇧ 2011
↑ en Frequency of Big Snows: Northeast U.S. and Colorado
⇧ 2010
↑ en Snow Season Off to a Roaring Start
-
Watts Up With That? (Antony Watts)
2010-12-11 en Snow Season Off to a Roaring Start
↑ en No significant trend in S. Sierra snowfall since 1916
-
Watts Up With That? (Antony Watts)
2010-07-24 en Dr. John Christy: "no-significant-trend" in S. Sierra snowfall since 1916
⇧ 2008
↑ en Northern Hemisphere Snow Cover Anomalies 1966-2008 January
-
fr
Janvier 2008 détient le record absolu de neige depuis 1966.
Souvenez-vous que pendant les années 70-79, on craignait un nouvell âge glaciaire.
- Pensée unique fr Préparons nous au refroidissement!
⇧
10 Luftfeuchtigkeit
en Humidity
fr Hygrométrie
Mit folgenden Links wird von anderen Webseiten auf diese Seite verwiesen:
| de | en | fr |
|---|---|---|
|
Wetterphänomene Luftfeuchtigkeit |
Weather phenomena Humidity |
Phénomènes météorologiques Hygrométrie |
![]()
![]() Relative Luftfeuchte in Braunschweig
Relative Luftfeuchte in Braunschweig
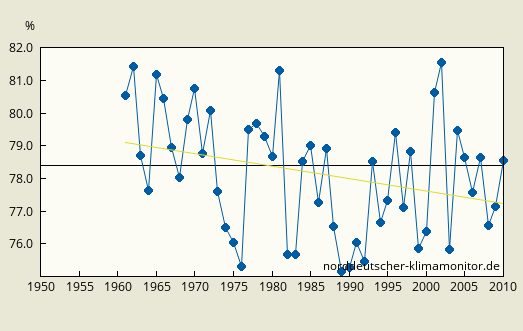
-
Die kalte Sonne (Fritz Vahrenholt & Sebastian Lüning)
2015-01-27 de KKK: Künstler kapern Klimalarm
⇧
11 Dürre
en Drought
fr Sécheresse
Mit folgenden Links wird von anderen Webseiten auf diese Seite verwiesen:
| de | en | fr |
|---|---|---|
|
Wetterphänomene Dürreperioden |
Weather phenomena Periods of Droughts |
Phénomènes météorologiques Periodes de sécheresses |
Links zur Klimaschau
|
|
▶Dürre ▶Niederschläge ▶Waldbrände |
⇧ de Verzeichnis en Contents fr Sommaire
⇧ Welt-Info
|
|
Dürre / Drought / Sécheresse | |||
| ▷Die Kalte Sonne Blog‑Themen Vahrenholt/Lüning ▶Die kalte Sonne | de ▷Dürren | |||
| NoTricksZone | en Drought and Deserts | |||
| Popular Technology | en Droughts, Floods | |||
| Wikipedia |
|
|||
| Vademecum |
▶Dürre
▶Welt-Info |
⇧ de Allgemein en General fr Générale
![]()
![]() Abbildung 2: 11-jähriger Sonnenfleckenzyklus und
Wettertrend im Juni/Juli im Deutschlandmittel
mit Trendprognose für die nächsten Jahre
Abbildung 2: 11-jähriger Sonnenfleckenzyklus und
Wettertrend im Juni/Juli im Deutschlandmittel
mit Trendprognose für die nächsten Jahre

▶Niederschläge: Kommt ein Dürresommer?
▶Sonnenscheindauer: Kommt ein Dürresommer?
▶Temperaturen: Kommt ein Dürresommer?
▶Auftreten von Dürre: Kommt ein Dürresommer?
Siehe auch:
| de | en | fr |
|---|---|---|
|
Wetterphänomene Hitzewellen |
Weather phenomena Heat Waves |
Phénomènes météorologiques Canicules |
⇧ de Text en Text fr Texte
↑
a Auftreten von Dürre
en Situation of Droughts
fr Situations de sécheresses
de Verzeichnis en Contents fr Sommaire
- 2020
- de Kommt ein Dürresommer? Eine experimentelle Prognose auf Basis der schwankenden Sonnenaktivität
- 2019
- de
Haben Dürren die Maya-Kultur zu Fall gebracht?
Severe Drought May Have Helped Hasten Ancient Maya's Collapse - 2018
- de Dürregeschichte Mitteleuropas: Klimaforscher Christian Pfister mit unerklärlichen Gedächtnislücken
- de Wie ungewöhnlich ist die aktuelle Trockenperiode?
- de
Die jahrelange beispiellose Hitze- und Dürreperiode in Europa
um 1540
en The year-long unprecedented European heat and drought of 1540 - de
Wetter, Klima und Medien
Teil 1: Das ZDF und seine Wetterfrösche - de
Nichts Neues: Dürren machten Südamerika auch in vorindustriellen
Zeiten zu schaffen
Immer wenn es in Kolumbien wärmer wurde, etwa vor 1000 Jahren zur Zeit der Mittelalterlichen Wärmeperiode, blieb in der andischen Zentralcordillere der Regen aus. - 2017
- de Globale Dürre-Häufigkeit hat sich in den letzten 100 Jahren nicht verändert
- 2012
- de Weltweites Auftreten von Dürren wurde überschätzt
- de Entspannung an der Extremwetterfront: Dürren sind in den letzten 60 Jahren nicht häufiger geworden
- en 'Global Warming' to Drought Links Shot Down
- en Little Change in Drought Over 60 Years
- en Study: Drought Trends, Estimates Possibly Overstated Due To Inaccurate Science
de Text en Text fr Texte
⇧ 2020
↑ Kommt ein Dürresommer? Eine experimentelle Prognose auf Basis der schwankenden Sonnenaktivität
-
Die kalte Sonne (Fritz Vahrenholt & Sebastian Lüning)
Dr. Ludger Laurenz
2020-04-19 de Kommt ein Dürresommer? Eine experimentelle Prognose auf Basis der schwankenden SonnenaktivitätDie schwankende Sonnenaktivität beeinflusst unser Wetter nach neueren Untersuchungen wesentlich stärker als gedacht.
Die Aktivität der Sonne schwankt in einem elfjährigen Zyklus, die Energie der Sonnenstrahlung ändert sich dabei aber nur um etwa 0,1 Prozent.
Dennoch beeinflusst die Variation der Sonnenstrahlung unser Wetter erheblich und für jeden spürbar.
Mögliche Verstärkermechanismen befinden sich noch in der Erforschung.
Laut folgender These wird der solare Einfluss auf unser Wetter erkennbar:
Der solare Einfluss auf unser Wetter wird sichtbar, wenn der Beginn des Sonnenzyklus auf das Jahr des Sonnenflecken-Maximums gelegt wird.
In jenem Jahr erzeugt die Sonne einen Startimpuls.
Ausgelöst durch diesen Impuls werden in jedem Zyklus für etwa 10 Jahre wiederkehrende Wettermuster gebildet.
Das betrifft alle Schichten der Atmosphäre.
Aus den wiederkehrenden Wettermustern lassen sich Trendprognosen erstellen.
Dazu hat der Autor in den letzten Monaten mehrere Beiträge verfasst (hier & hier).
-
Die Kalte Sonne / Dr. Ludger Laurenz
2010-03-06 de Handschrift der Sonne in Daten zahlreicher Wetterstationen fordert Meteorologen und Klimaforscher herausZusammenfassende Hypothesen
Im 11-jährigen Sonnenzyklus (Schwabezyklus) erzeugt die Sonne im Jahr des Sonnenfleckenmaximums einen Startimpuls.
Ausgelöst durch diesen Startimpuls werden in jedem Sonnenfleckenzyklus für etwa 10 Jahre ab dem Sonnenfleckenmaximum wiederkehrende Wettermuster gebildet.
Der Vergleich zwischen Sonnensignalen einzelner Stationen mit dem Sonnensignal im Mittelwert größerer Regionen hat gezeigt, dass der solare Einfluss an einzelnen Wetterstationen deutlicher ausgeprägt ist als in Mittelwerten über größere Regionen wie Bundesländer oder Staaten.
Das solare Wettermuster des Schwabezyklus ist beim Niederschlag ausgeprägter als bei der Sonnenscheindauer oder Temperatur.
Eigentlich dürfte es die gezeigten solaren Wettermuster nicht geben.
Sowohl der IPCC als auch führenden Klimaforschungs- und Klimafolgenforschungseinrichtungen in Deutschland betonen bis heute, dass von der Sonne kein bedeutender Einfluss auf den Wettertrend ausgehen kann.
Dafür sei die Variabilität der Sonnenaktivität innerhalb des Schwabezyklus viel zu gering.
Mit diesem Beitrag werden insbesondere die Klimawissenschaftler angesprochen,
die den aktuellen Klimawandel fast allein auf die Zunahme der CO₂-Konzentration zurückführen
und zur Stellungnahme hinsichtlich des nachgewiesenen solaren Einflusses auf den Wettertrend aufgefordert.
Mit dem aufgezeigten solaren Einfluss wird die Argumentation gestützt, dass die Sonne der Haupttreiber für Klimaveränderungen und die aktuelle Warmzeit ist.
Die im ersten KALTESONNE-Beitrag dargestellte positive Korrelation zwischen der Anzahl der Sonnenflecken im Jahr des Fleckenmaximums und der Temperaturanomalie im äquatorialen Pazifik unterstützt die Annahme, dass die globale Erwärmung der letzten Jahrzehnte solar beeinflusst ist (s. bit.ly/2VIKA7R, Abbildung 7).
Mit Hilfe der These vom Impuls der Sonne im Jahr des Fleckenmaximums sind erstmalig Prognosen des monatlichen Niederschlagstrends bis zu 10 Jahre im Voraus möglich.
Die bisher gefundenen Muster sind aber nur in 10 bis 20 Prozent des Jahres so eindeutig, dass eine Trendprognose Sinn ergibt.
Auch in der restlichen Zeit des Jahres ist ein solarer Einfluss auf die Wettermuster zu vermuten.
Allerdings muss nach dem oder den Schlüsseln gesucht werden, die den solaren Einfluss aufzeigen.
Ein Schlüssel dürfte bei den Phasenverschiebungen und unterschiedlichen Verzögerungen in der Wirkungskette Sonne, Stratosphäre und Troposphäre liegen.
Sollte ein solcher Verzögerungsschlüssel gefunden werden, wären noch wesentlich bessere Wettertrend-Prognosen als in diesem Beitrag skizziert möglich sein.
Klimaforschung sollte die Sonne als zentrale Einflussgröße einbeziehen.
Es ist Aufgabe von Sonnenphysikern und Atmosphärenforschern, die Signale der Sonne zu identifizieren, die eine den Wettertrend beeinflussende Wirkung haben.
Alle EDV-gestützten Klimaprojektionen und Zukunftsszenarien, die bisher die Sonne nicht als wesentlichen Wetter- und Klimagestalter einbezogen haben, dürften wertlos sein.
Erst mit Einbeziehung der Sonne als wichtigen Wetter- und Klimagestalter in die Computerprogramme ist mit belastbaren Zukunftsprojektionen zu rechnen.
-
Die Kalte Sonne / Dr. Ludger Laurenz
2020-01-31 de Handschrift des 11-jährigen Sonnenfleckenzyklus in Atmosphäre und OzeanenINHALT:
Kapitel 1: These vom Impuls der Sonne im Jahr des Sonnenfleckenmaximums
Kapitel 2: Vom Sonnenfleckenzyklus im australischen Buschfeuer zur globalen Erwärmung
Kapitel 3: Handschrift der Sonnenfleckenzyklus in der Atmosphäre (17 km, 10 km)
Kapitel 4: Handschrift der Sonnenfleckenzyklus in den Daten einzelner Wetterstationen
Dr. Ludger Laurenz gelang in Zusammenarbeit mit zwei weiteren Wissenschaftlern der Nachweis, dass die Niederschlagsverteilung in weiten Teilen von Europa vom Sonnenfleckenzyklus beeinflusst wird.
Die Ergebnisse sind 2019 im Journal Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics veröffentlicht worden
▶ en Influence of solar activity on European rainfall
Laurenz, L., H.-J. Lüdecke, S. Lüning (2019)
J. Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics,
185: 29-42, doi: 10.1016/j.jastp.2019.01.012
Der Einfluss des Startimpulses der Sonne lässt sich im Sommer in den Monaten Juni und Juli nachweisen, wenn die Sonne bei uns am höchsten steht.
Der Deutsche Wetterdienst (DWD) stellt die Wetterdaten von Deutschland, den und vieler Stationen ab 1881 zur Verfügung.
Seitdem hat es 12 vollständige Sonnenzyklen (von Maximum zu Maximum) gegeben, von 1883 bis 2013, und den aktuellen Zyklus, der 2014 mit einem weiteren Maximum begonnen hat.
Wird der Beginn eines jeden Zyklus auf das Impulsjahr gelegt, entsteht der Kurvenschwarm in Abbildung 1.
Das Impulsjahr entspricht meist dem nach SILSO definierten Jahr mit dem Sonnenfleckenmaximum.
SILSO Sunspot Index and Long-term Solar Observations
en Sunspot number series: latest updateSolar Cycle 25
An international panel of experts coordinated by the NOAA and NASA,to which the WDC-SILSO contributed, released a preliminary forecast for Solar Cycle 25 on April 5, 2019.
Based on a compilation of more than 60 forecasts published by various teams using a wide range of methods, the panel reached a consensus indicating that cycle 25 will most likely peak between 2023 and 2026 at a maximum sunspot number between 95 and 130.
This prediction is now given in the scale of sunspot number Version 2.
Therefore, solar cycle 25 will be similar to cycle 24, which peaked at 116 in April 2014.
The next minimum between the current cycle 24 and cycle 25 is predicted to occur between July 2019 and September 2020.
Given the previous minimum in December 2008, this thus corresponds to a duration for cycle 24 between 10.6 and 11.75 years.
Je nach Monat oder Jahreszeit, in denen solare Wettermuster auftreten, können sich die Impulsjahre geringfügig unterscheiden.
Das dürfte nicht an unterschiedlichen Zeitpunkten des Sonnenimpulses liegen, sondern an unterschiedlichen Verzögerungen, bis das Sonnensignal im Wettertrend erscheint.
Die These vom Impuls im Jahr des Sonnenfleckenmaximums ist so jung, dass Fragen zur Definition des Impulsjahres und der Verzögerungszeiten noch näher analysiert werden müssen.
...
Abbildung 1: Trend der Niederschlagssumme Juni/Juli im Deutschlandmittel

 Abbildung 1: 11-jähriger Sonnenfleckenzyklus und
Trend der Niederschlagssumme Juni/Juli im Deutschlandmittel
Abbildung 1: 11-jähriger Sonnenfleckenzyklus und
Trend der Niederschlagssumme Juni/Juli im Deutschlandmittel
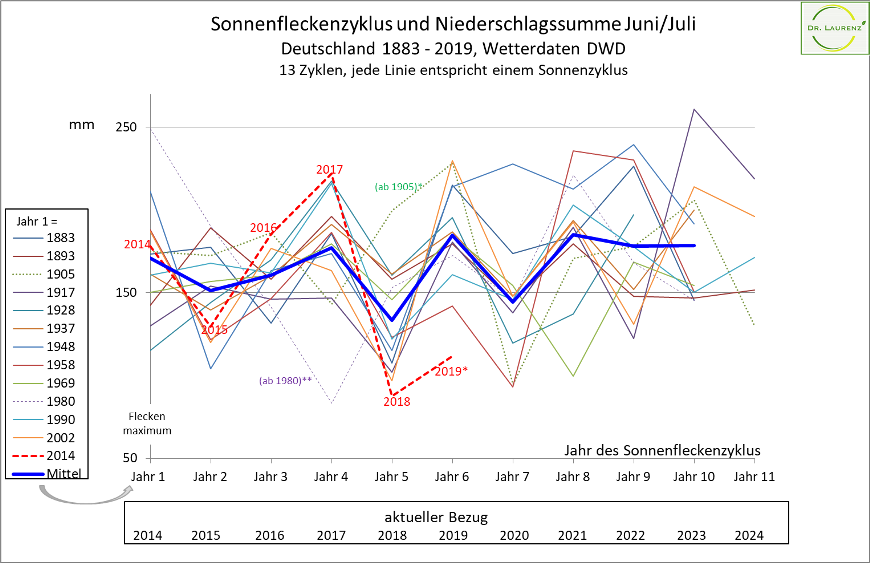
Jede Linie entspricht dem Verlauf der Niederschlagssumme in einem Sonnenzyklus.
Beim erstmaligen Betrachten irritiert der Kurvenverlauf.
Ein ähnliches Muster findet sich weltweit in allen solaren Wettermustern, wenn der Beginn des Sonnenzyklus auf das Jahr des Fleckenmaximums gelegt wird.
Eine Erklärung dafür wird am Ende dieses Beitrages gegeben.
Zeitweise verlaufen alle 13 Kurven gleichsinnig parallel.
Das ist ein Hinweis darauf, dass von der Sonne im Jahr des Fleckenmaximums ein Impuls ausgeht, der für diesen Trend verantwortlich ist.
Mit dieser Parallelität kommt das Signal zum Ausdruck, das die Sonne im Verlauf des Sonnenfleckenzyklus an die Sommerniederschlagsaktivität in Deutschland sendet.
...
Abbildung 2: Wettertrend im Juni/Juli im Deutschlandmittel

 Abbildung 2: 11-jähriger Sonnenfleckenzyklus und
Wettertrend im Juni/Juli im Deutschlandmittel
mit Trendprognose für die nächsten Jahre
Abbildung 2: 11-jähriger Sonnenfleckenzyklus und
Wettertrend im Juni/Juli im Deutschlandmittel
mit Trendprognose für die nächsten Jahre

▶Niederschläge: Kommt ein Dürresommer?
▶Sonnenscheindauer: Kommt ein Dürresommer?
▶Temperaturen: Kommt ein Dürresommer?
▶Auftreten von Dürre: Kommt ein Dürresommer?In Abbildung 2 ist das Sonnensignal für die Klimagrößen Niederschlagssumme, Sonnenscheindauer und Temperatur für Juni/Juli im Mittel von Deutschland dargestellt.
Für den Niederschlagstrend und die Sonnenscheindauer werden Relativwerte verwendet.
Dadurch sind diese Größen leichter vergleichbar.
Die Sonnenscheindauer ist erwartungsgemäß negativ korreliert zur Niederschlagssumme.
Die Temperatur verläuft weitgehend parallel zur Sonnenscheindauer.
Das Zyklusjahr 5 ist das trockenste, sonnenscheinreichste und wärmste Jahr aller Zyklusjahre.
Das Hitze- und Dürrejahr 2018 ist ein Jahr 5.
Die Sonnenaktivität war offensichtlich verantwortlich für den Wettercharakter im Sommer 2018.
Der Kurvenverlauf in Abbildung 2 lässt sich für Trendprognosen nutzen.
Dazu sind die Jahreszahlen des aktuellen Sonnenzyklus, beginnend mit 2014, am unteren Rand eingefügt.
Für 2020 sind erneut niedrige, eventuell sogar sehr niedrige Niederschlagssummen wahrscheinlicher als durchschnittliche oder sogar überdurchschnittliche Regensummen.
In 11 von 12 Zyklen sinkt die Niederschlagssumme von Jahr 6 zu Jahr 7, s. Abbildung 1.
Der aktuelle Sonnenzyklus mit dem zu Beginn sehr schwachem Impuls verläuft nicht normal.
So ist der in anderen Zyklen regelmäßig auftretende Windrichtungswechsel in der QBO (s.u.) von Jahr 1 zum Jahr 2 ausgeblieben.
Wikipedia
de Quasi-zweijährige SchwingungDie quasi-zweijährige Schwingung (kurz: QBO vom englischen "quasi-biennial oscillation"), auch quasi-biennale Oszillation, ist eine quasi-periodische atmosphärische Welle des zonalen Windes in der äquatorialen Stratosphäre der Erde.
Wenn sich 2020 entsprechend den Kurvenverläufen in Abbildung 1 zu einem historischen Dürrejahr entwickelt,
könnte das allein durch den aktuellen Verlauf der Sonnenaktivität verursacht worden sein.
Für Deutschland lässt sich in Zukunft ein Trend für die Niederschlagssumme Juni und Juli für ca. 10 Jahre im Voraus aufstellen, sobald der Zeitpunkt und die Qualität des Sonnenfleckenmaximums bzw. des Sonnenimpulses bekannt sind.
In wieweit das auch in Zyklen mit zu Beginn sehr niedriger Fleckenzahl und schwachem Impuls möglich sein wird, müssen weitere Untersuchungen zeigen.
...
Abbildung 3: Wettertrend im Juni/Juli in verschiedenen Regionen Deutschlands und den Niederlanden

 Abbildung 3: 11-jähriger Sonnenfleckenzyklus und
Wettertrend im Juni/Juli in verschiedenen Regionen Deutschlands
und den Niederlanden
Abbildung 3: 11-jähriger Sonnenfleckenzyklus und
Wettertrend im Juni/Juli in verschiedenen Regionen Deutschlands
und den Niederlanden

In allen Bundesländern ähnliches Sonnensignal
Zur Berechnung des Sonnensignals in unterschiedlichen Regionen Deutschlands sind die Datensätze aus 12 Bundesländern verwendet, die Niederschlagssummen in Relativwerte umgewandelt worden.
Die Werte eigenständiger Städte sind in umgebenden Bundesländern integriert.
Zur besseren Übersichtlichkeit sind die Bundesländer mit ähnlichem Kurvenverlauf in Gruppen zusammengefasst, s. Abbildung 3.
Zu den Ergebnissen der Bundesländer ist der Niederschlagstrend der Niederlande hinzugefügt, um zu zeigen, dass sich das in Nordwest-Deutschland besonders starke Sonnensignal auf dem Gebiet der Niederlande fortpflanzt.
Der Kurvenverlauf von Schleswig-Holstein und Baden-Württemberg wechselt mehr oder weniger gleichförmig von Jahr zu Jahr zwischen niedriger und hoher Niederschlagssumme, auch in den Zyklusjahren 9 bis 11.
Die Kurven der drei anderen Regionen bleiben ab dem Zyklusjahr 8 auf hohem Niveau.
Die Ausschläge zwischen den Extremen sind im Nord-West-Deutschland mit maximal 40 Prozent (Jahr 5 zu Jahr 6) am größten.
In den benachbarten Niederlanden steigt der Betrag sogar auf beachtliche 45 Prozent.
Ähnlich hoch sind die Ausschläge in Belgien und Luxemburg.
Auch mit Hilfe dieser Abbildung können Juni/Juli-Niederschlagsprognosen für die verschiedenen Regionen erstellt werden.
Das aktuelle Jahr 2020 entspricht dem Zyklusjahr 7, einem Jahr mit deutlichem Trend zu unterdurchschnittlicher Sommer-Niederschlagssumme.
2021, dem Zyklusjahr 8, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit für erstmalig wieder überdurchschnittlich viel Regen im Hochsommer.
...
Abbildung 4: Niederschlagssumme verschiedener Zeiträume

 Abbildung 4: 11-jähriger Sonnenfleckenzyklus und
Niederschlagssumme verschiedener Zeiträume
Abbildung 4: 11-jähriger Sonnenfleckenzyklus und
Niederschlagssumme verschiedener Zeiträume
 -
-
...
Mit Abbildung 4 wird die Struktur des Sonnensignals sowohl hinsichtlich des Auftretens in einzelnen Zyklusjahren als auch im Verlauf des Jahres sichtbar.
Das Sonnensignal ist im Juni/Juli wesentlich stärker ausgeprägt als im Zeitraum Mai bis August und dem Gesamtjahr.
Das Signal ist auf die Monate Juni und Juli begrenzt.
Bei der hier nicht dargestellten Betrachtung der Einzelmonate ist das Sonnensignal im Juni stärker ausgeprägt als im Juli.
Schon im vorgelagerten Mai als auch im nachgelagerten August ist es kaum noch erkennbar.
Die jährlichen Ausschläge steigern sich vom Jahr des Sonnenfleckenmaximums bis zur Phase des Fleckenminimums mit den Zyklusjahren 5, 6 und 7.
Ab dem Zyklusjahr 8 verschwindet das Sonnensignal, die Niederschlagssummen bleiben bis zum nächsten Sonnenfleckenmaximum meist auf überdurchschnittlichem Niveau.
Prognosen haben in den Zyklusjahren 3 bis 8 und Monaten Juni/Juli eine hohe Eintrittswahrscheinlichkeit.
Das für Deutschland typische Sonnensignal in der Juni/Juli-Niederschlagssumme erstreckt sich in Europa auf die eher westlich gelegenen Länder von Dänemark über Großbritannien/Irland, Benelux-Länder, Alpenrepubliken, Frankreich und die Iberische Halbinsel.
In den unmittelbar östlich Nachbarschaft ist das Sonnensignal nur etwa halb so stark.
Das Signal ist kaum vorhanden in einem großen Bogen um Deutschland herum von Island über Norwegen, Finnland, Weißrussland, Bulgarien, Rumänien sowie dem zentralen und östlichen Mittelmeerraum.
Übertragungsweg für das Sonnensignal des Schwabezyklus auf unser Wetter
Die hohe Qualität des Sonnensignals in den Juni/Juli-Niederschlagssummen in Abbildung 1 setzt voraus, dass der Impuls der Sonne im Jahr des Fleckenmaximums durch ein festes Zusammenspiel von Planetenstellung, Sonnenaktivität, Vorgängen in der Mesosphäre (50 bis 80 km Höhe), Stratosphäre (12 bis 50 km Höhe) und Troposphäre (bis 12 km Höhe) übertragen wird.
Zu diesem Übertragungsweg gibt es weltweit viele neue Publikationen.
Auch deutsche Forschungseinrichtungen wie das Max-Planck-Institut für Meteorologie in Hamburg [1] oder GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel [2] sind an der Forschung beteiligt.
[1] Geophysical Research Letters
2019-11-20 en Realistic Quasi-Biennial Oscillation Variability in Historical and Decadal Hindcast Simulations Using CMIP6 Forcing[2] Atmospheric Chemistry and Physics
2019-11-20 en Quantifying uncertainties of climate signals related to the 11-year solar cycle.
Part I: Annual mean response in heating rates,temperature and ozoneAus dem Studium der Literatur kann abgeleitet werden, dass die Übertragung des Sonnensignals wahrscheinlich über fünf Ebenen erfolgt:
-
Ebene 1 (vorgeschaltet)
Laufbahn der Planeten im Sonnensystem, die je nach ihrer Stellung das Schwerefeld der Sonne verändern
und damit die Sonnenfleckenaktivität im 11-Jahresrythmus und die Variabilität der UV-Strahlung steuert.
-
Ebene 2
Sonne mit Sonnenflecken, "Sonnenwind" und UV-Strahlung, die das Ozon in der Mesosphäre (50 bis 80 km Höhe) und Stratosphäre (12 bis 50 km Höhe) chemisch-physikalisch beeinflusst.
Die UV-Strahlung variiert während des Sonnenzyklus um ca. 10 Prozent.
-
Ebene 3
Mesophäre und Stratosphäre mit der Ozonchemie und -physik:
je stärker die UV-Strahlung, umso mehr Ozon, umso höher die Temperatur.
Die Ozondynamik wird von der UV-Strahlung gesteuert.
Dadurch verändern sich während des Sonnenzyklus die Temperaturgradienten zwischen Äquator und Polen sowie zwischen verschiedenen Höhen der Atmosphäre.
-
Ebene 4
Quasi-Biennale Oszillation (QBO), die von den Temperaturgradienten in 12 bis 80/nbsp;km Höhe beeinflusst wird.
In der QBO, eine Windzone in 20 bis 40 km Höhe über dem Äquator, wechselt die Windrichtung von Jahr zu Jahr mehr oder weniger regelmäßig von West nach Ost und umgekehrt.
Der Sonnenimpuls wird auf die QBO übertragen, indem die Windrichtung in der QBO im Jahr des Fleckenmaximums in jedem Zyklus von Mai bis Dezember auf Ost dreht.
Der jährliche Windrichtungswechsel (in 20 bis 25 km Höhe) bleibt in den Folgejahren nach eigenen Berechnungen für mehrere Jahre exakt im 12‑Monatsrythmus erhalten, bevor sich der Rhythmus im Verlauf eines jeden Zyklus auf mehr als 12 Monate verlängert.
-
Ebene 5
Zirkulationssystem der Troposphäre mit den wetterbildenden Hoch- und Tiefdruckgebieten, das von der QBO beeinflusst wird.
Der fast jährliche Windrichtungswechsel in der QBO dürfte für das Zick-Zack-Muster in den Niederschlagskurven in den obigen Abbildungen verantwortlich sein.
Fazit
Es gibt unzweifelhaft einen starken Einfluss der Variabilität der Sonne im Rahmen des 11-jährigen Sonnenfleckenzyklus auf unser Wetter,
der wesentlich größer ist als bisher vermutet.
Der Einfluss konzentriert sich auf die Sommermonate Juni und Juli, den Zeitraum höchster Sonneneinstrahlung.
Er zeigt sich in den Niederschlagssumme stärker als in der Sonnenscheindauer oder Temperatur.
Die Niederschlagssumme Juni/Juli reagiert in jedem einzelnen Jahr des Sonnenzyklus unterschiedlich auf die Variabilität der Sonnenstrahlung.
Während der Phase des Sonnenfleckenminimums, in der wir uns zurzeit befinden, betragen die solar verursachten jährlichen Schwankungen der Niederschlagsumme im Juni/Juli 30 bis über 40 Prozent.
Diese Schwankungen haben sich mit hoher Zuverlässigkeit in fast allen 13 Zyklen seit 1883 wiederholt.
Auf Basis dieser Zuverlässigkeit lassen sich für Deutschland Prognosen erstellen.
Prognose für Juni/Juli 2020: Die Niederschlagssumme erreicht nur ca. 80 Prozent des langjährigen Mittels, mit dem Trend zu noch niedrigerem Wert.
Prognose für Juni/Juli 2021: Die Niederschlagssumme erreicht ca. 110 Prozent des langjährigen Mittels.
Diese experimentellen Prognosen sind selbstverständlich ohne Gewähr.
Ziel der Übung ist es, mittelfristige Klimavorhersagen zu entwickeln bzw. zu überprüfen, ob dies möglich ist.
-
|
|
Kommt ein Dürresommer? Sonnenzyklen: Webseiten / Solar cycles / Cycles solaires Wetterphänomene: Niederschläge Wetterphänomene: Sonnenscheindauer |
⇧ 2019
↑ Haben Dürren die Maya-Kultur zu Fall gebracht?
-
Die kalte Sonne (Fritz Vahrenholt & Sebastian Lüning)
2019-06-09 de Haben Dürren die Maya-Kultur zu Fall gebracht?Severe Drought May Have Helped Hasten Ancient Maya's Collapse
⇧ 2018
↑ Dürregeschichte Mitteleuropas: Klimaforscher Christian Pfister mit unerklärlichen Gedächtnislücken
-
Die kalte Sonne (Fritz Vahrenholt & Sebastian Lüning)
2018-08-15 de Dürregeschichte Mitteleuropas: Klimaforscher Christian Pfister mit unerklärlichen GedächtnislückenAm 2. August 2018 brachte SRF ein längeres Radiointerview mit dem bekannten Berner Klima-Historiker Christian Pfister zur diesjährigen langen Dürreperiode in Mitteleuropa.
Pfister bezeichnet das Dürrejahr 1540 als Ausreißer, während die Dürre 2018 die zukünftige Norm darstellen könnte.
Eine steile These.
Zumal sie dem widerspricht, was der heute emeritierte Klimahistoriker Pfister noch im Jahr 2000 selber feststellte (pdf hier).
Dürresommer im Schweizer Mittelland seit 1525
Eine seltsame Gedächtnislücke.
Im Fazit der Arbeit lesen wir doch tatsächlich, dass beim Vergleich des Zeitraums von 1525 bis 2000 die häufigsten Dürren in Mitteleuropa während des Maunder-Minimum im 17. Jahrhundert auftraten und am wenigsten im 20. Jahrhundert:
...
Schussfolgerung
Man reibt sich verwundert die Augen.
Was passiert hier genau?
Will oder kann sich Pfister nicht mehr erinnern?
War alles falsch, was er früher gemacht hat?
Steht er lieber auf der Seite der vermeintlich Guten und verbiegt zu diesem Zweck sogar die Realitäten?
↑ Wie ungewöhnlich ist die aktuelle Trockenperiode?
-
EIKE Europäisches Institut für Klima und Energie
Prof. Dr. Horst-Joachim Lüdecke
2018-08-08 de Wie ungewöhnlich ist die aktuelle Trockenperiode?Kaum spielt das Wetter wieder einmal Kapriolen, kreisen auch schon die Krähen des Untergangs über unseren Häuptern und fordern CO2-Buße.
Ein nüchterner Blick auf die Daten beweist dagegen nur Eines:
"Das Gewöhnliche am Wetter ist seine Ungewöhnlichkeit".

 Summe der Niederschlagsmengen von Mai+Juni+Juli für Deutschland
und Mittelengland
Summe der Niederschlagsmengen von Mai+Juni+Juli für Deutschland
und Mittelengland
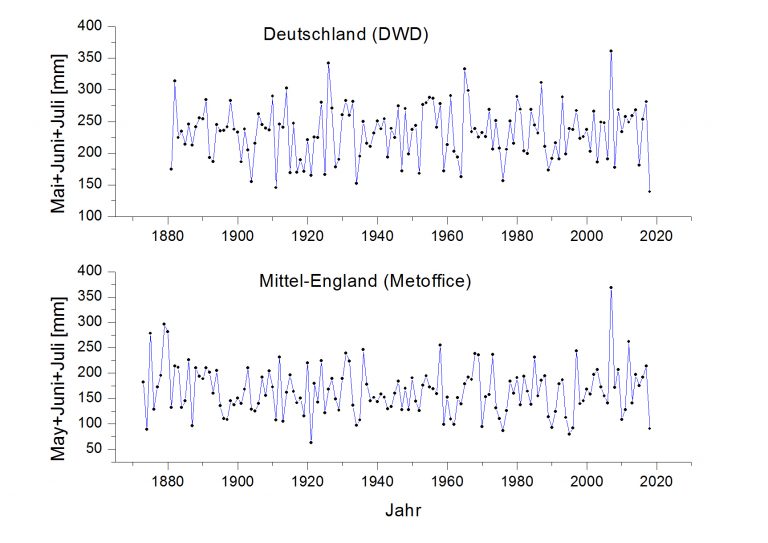
Was ist zu sehen?
Jedenfalls kein säkularer Trend, wie er seitens des IPCC durch den angestiegenen CO2-Gehalt in der Luft vermutet wird.
Wir sehen Wetterereignisse (zur Erinnerung: Klima ist definiert als der statistischen Mittelwert von Wetter über mindestens 30 Jahre).
Der Summenregenwert Mai+Juni+Juli von Deutschland in 2018 ist tatsächlich ein Wetterrekord, wenn auch nur knapp. Seine 139,4 mm Regensumme in 2018 unterbieten die 145,7 mm in 1911 nur geringfügig.
↑
Die jahrelange beispiellose Hitze- und Dürreperiode in Europa um 1540
en
The year-long unprecedented European heat and drought of 1540
-
EIKE Europäisches Institut für Klima und Energie
Oliver Wetter, Christian Pfister, Johannes P. Werner, Eduardo Zorita und weitere
2018-08-04 de Die jahrelange beispiellose Hitze- und Dürreperiode in Europa um 1540 - ein Worst CaseAbstract
Die Hitzewellen der Jahre 2003 in Westeuropa und 2010 in Russland, welche allgemein als seltene klimatische Anomalien außerhalb bisheriger Erfahrungen apostrophiert werden, werden oftmals als Warnungen vor noch häufigeren Extremen in einer von der globalen Erwärmung beeinflussten Zukunft herangezogen.
Eine neue Rekonstruktion der Temperaturen in Westeuropa im Frühjahr und Sommer zeigt jedoch, dass es im Jahre 1540 signifikant höhere Temperaturen gegeben haben muss.
Um die Plausibilität dieses Ergebnisses zu überprüfen, untersuchten wir die Schwere der Dürre 1540, indem wir das Argument der bekannten Rückkopplung zwischen Austrocknung des Bodens und Temperatur untersuchten.
Quelle/Source:
-
Springer Nature
Oliver Wetter, Christian Pfister, Johannes P. Werner, Eduardo Zorita and others
2018-06-28 en The year-long unprecedented European heat and drought of 1540 - a worst caseAbstract
The heat waves of 2003 in Western Europe and 2010 in Russia, commonly labelled as rare climatic anomalies outside of previous experience, are often taken as harbingers of more frequent extremes in the global warming-influenced future.
However, a recent reconstruction of spring-summer temperatures for WE resulted in the likelihood of significantly higher temperatures in 1540.
In order to check the plausibility of this result we investigated the severity of the 1540 drought by putting forward the argument of the known soil desiccation-temperature feedback.
Based on more than 300 first-hand documentary weather report sources originating from an area of 2 to 3 million km2, we show that Europe was affected by an unprecedented 11-month-long Megadrought.
The estimated number of precipitation days and precipitation amount for Central and Western Europe in 1540 is significantly lower than the 100-year minima of the instrumental measurement period for spring, summer and autumn.
This result is supported by independent documentary evidence about extremely low river flows and Europe-wide wild-, forest- and settlement fires.
We found that an event of this severity cannot be simulated by state-of-the-art climate models.
↑
Wetter, Klima und Medien
Teil 1: Das ZDF und seine Wetterfrösche
-
EIKE Europäisches Institut für Klima und Energie
Raimund Leistenschneider
2018-07-20 de Wetter, Klima und Medien
Teil 1: Das ZDF und seine WetterfröscheZDF:
Herr Terli legte am Samstag, den 14.07. in seiner Wettervorhersage nach den 19:00 Uhr Nachrichten noch eine Steigerung drauf.
"Feststeckende Hochs und Tiefs, das sind die direkten Auswirkungen des Klimawandels."
Donnerwetter, das grenzt ja fast schon an den meteorologischen Nobelpreis unserer Tage.
Zwischenergebnis
Ein Meteorologe, der noch nicht einmal den Wetterbericht (das Wetter) für den nächsten Tag richtig vorhersagen kann, der sollte nicht vom Klimawandel schwadronieren.
Das Wettergeschehen und die Meteorologie sind leider etwas komplexer und vielschichtiger, als Herr Terli dies darstellt.
Aber vielleicht ist das heutige Studium der Meteorologie wirklich auf den Nenner geschrumpft:
CO2 = Erderwärmung, mit dem Abstrakt
mit dem Abstrakt: Autos und Industrie = Böse
Da kann dann jeder ein Diplom erringen, solange er nur im Mainstream unterwegs ist.
Ist nun eine anhaltende Dürre in Deutschland zu verzeichnen?

 WetterOnline zeigt, dass kein Trend beim Niederschlag zu
verzeichnen ist.
WetterOnline zeigt, dass kein Trend beim Niederschlag zu
verzeichnen ist.
Wetteronline dazu: "Im Vergleich zu seinen Vorgängern zeigte sich das Jahr 2017 deutlich feuchter.
Trotzdem bewegte sich die Regenmenge über Deutschland verteilt noch immer im Normalbereich des langjährigen Durchschnitts."
 Wetterrückblick
Wetterrückblick
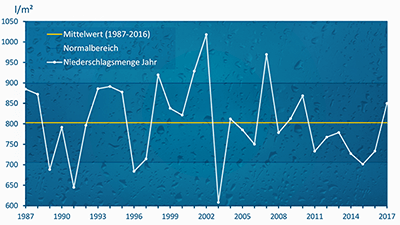

 Auch weltweit ist nach den Daten der NOAA und des NCDC keine
Trockenheit zu verzeichnen.
Auch weltweit ist nach den Daten der NOAA und des NCDC keine
Trockenheit zu verzeichnen.
Mehr noch, die Jahre sind regenreicher geworden.
Man vergleiche heute mit der Situation um 1900.
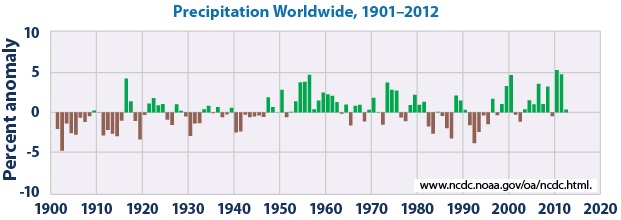
Ergebnis:
Das Desinformationsfernsehen ZDF und deren Wetterfrösche versuchen eine Hype zu schüren, den Menschen Angst einzujagen, ohne jegliche Grundlage.
Hier wird ganz offensichtlich Propaganda für bestimmte politische Richtungen betrieben.
Doch dazu im nächsten Teil mehr. Denn bei anderen Themen, wie dem Diesel, wird genauso vorgegangen.
↑ Nichts Neues: Dürren machten Südamerika auch in vorindustriellen Zeiten zu schaffen
-
Die kalte Sonne (Fritz Vahrenholt & Sebastian Lüning)
2018-01-27 de Nichts Neues: Dürren machten Südamerika auch in vorindustriellen Zeiten zu schaffenImmer wenn es in Kolumbien wärmer wurde, etwa vor 1000 Jahren zur Zeit der Mittelalterlichen Wärmeperiode, blieb in der andischen Zentralcordillere der Regen aus.
⇧ 2017
↑ Globale Dürre-Häufigkeit hat sich in den letzten 100 Jahren nicht verändert
-
Die kalte Sonne (Fritz Vahrenholt & Sebastian Lüning)
2017-09-22 de Globale Dürre-Häufigkeit hat sich in den letzten 100 Jahren nicht verändert
⇧ 2012
↑ Weltweites Auftreten von Dürren wurde überschätzt
-
Neue Zürcher Zeitung
2012-11-14 de Weltweites Auftreten von Dürren wurde überschätztDürrekatastrophen wie jene in den USA im letzten Sommer scheinen sich zu häufen; der Klimawandel soll dafür verantwortlich sein.
Nun zeigt jedoch eine neue Analyse der Dürretrends der letzten 60 Jahre, dass der postulierte Aufwärtstrend übertrieben war und es sich kaum belegen lässt, dass extreme Trockenheiten häufiger und grossflächiger aufgetreten sind.
Dürre verursacht Hitze - nicht umgekehrt
Denn in Wahrheit ist Dürre nicht eine Folge von hohen Temperaturen, sondern verursacht diese vielmehr.
Wenn weniger Wasser aus dem Boden verdunsten kann, wobei dieser abkühlt, steigen die Temperaturen in der Umgebung an.
↑ Entspannung an der Extremwetterfront: Dürren sind in den letzten 60 Jahren nicht häufiger geworden
-
Die kalte Sonne (Fritz Vahrenholt & Sebastian Lüning)
2012-12-06 de Entspannung an der Extremwetterfront: Dürren sind in den letzten 60 Jahren nicht häufiger geworden
↑ en 'Global Warming' to Drought Links Shot Down
-
Watts Up With That? (Antony Watts)
2012-11-16 en 'Global Warming' to Drought Links Shot Down
↑ en Little Change in Drought Over 60 Years
-
Roger Pielke Jr.'s Blog
2012-11-15en Little Change in Drought Over 60 Years
↑ en Study: Drought Trends, Estimates Possibly Overstated Due To Inaccurate Science
-
CBS Washington DC
2012-11-19en Study: Drought Trends, Estimates Possibly Overstated Due To Inaccurate Science
↑ b Klimawandel-Faustregel
-
Die kalte Sonne (Fritz Vahrenholt & Sebastian Lüning)
2017-09-18 de Dürrevorhersagen nur robust wenn Ozeanzyklen berücksichtigt werden
-
Die kalte Sonne (Fritz Vahrenholt & Sebastian Lüning)
2016-03-16 de Klimawandel-Faustregel entpuppt sich als falsch: Trockene Gebiete werden nicht immer trockener
-
20 Minuten
2014-09-15 de Trockene Gebiete werden nicht immer trockenerTrockene Regionen werden trockener, feuchte feuchter - so lautet eine Faustregel zum Klimawandel.
Nun haben ETH-Forscher herausgefunden, dass das nicht immer stimmt. storybild
-
Climate System Science
2016-03-07 en Global warming increases rain in world's driest areasGlobal warming will increase rainfall in some of the world's driest areas over land, with not only the wet getting wetter over land but the dry getting wetter as well.
↑
c Panik und Entwarnung
en Panic and all-clear
fr Panique et fin de l'alerte
Panik
- de Ständige Behauptung von Klaus Töpfer (UNEP): "Wüsten breiten sich aus!"
Entwarnung - Die NASA stellt 1998 fest:
- en "For many years, scientists have believed that the southern expansion of the Sahara has been due to human activity. However, results from the AVHRR instrument and its measurements of vegetation suggest a different explanation: rainfall patterns. In drier years (1984 was one of the driest summers in recorded history in Northern Africa), the Sahara expands south, but in wetter years (such as 1994), vegetation moves back and there is no net expansion of the Sahara as had been previously suggested."
- Der Wasserplanet de Ständige Behauptung von Klaus Töpfer (UNEP): "Wüsten breiten sich aus!
-
Klimaskeptiker Info
de Breiten sich die Wüsten aus? - Nein, sie breiten sich nicht aus!
↑
d Weitere Falschinformationen und Richtigstellungen
en Further missinformation and rectifications
fr D'autres informations erronées et rectifications
-
fr
Accusations:
"Les sécheresse deviennent plus longues et plus intenses" a déclaré, sans ambages, Al Gore devant la Commission de l'Environnement et des Travaux Publics du Sénat Américain, le 21 Mars 2007.
Réalité:
Le graphique vaut plus qu'un long discours. Il reporte, à la même échelle temporelle, les relevés de température moyenne du globe et le nombre des sécheresses intenses réellement observées sur la planète.
On y voit que le nombre des sécheresses intenses a diminué au fur et à mesure que le réchauffement dit "anthropogénique" s'est accentué.
- Pensée unique fr "Les sécheresse deviennent plus longues et plus intenses"
↑
e Dürreperioden
en Periods of Droughts
fr Periodes de sécheresses
↑
Europa
en Europe
fr Europe
-
Die kalte Sonne (Fritz Vahrenholt & Sebastian Lüning)
2016-02-23 de Neue Studien geben Entwarnung: Europäische Dürren noch vollständig im Bereich der natürlichen SchwankungsbreiteWer kennt sie nicht, die Märchen der Gebrüder Klimagrimm:
Die Dürren würden angeblich immer häufiger und intensiver werden.
Früher sei alles besser gewesen:
immer schön nass, gerade genug Wasser, nicht zu viel und nicht zu wenig.Wer so etwas behauptet, hat keinen blassen Schimmer von der Klimageschichte.
Um diese zu studieren, müsste man aber die Fachjournale durchstöbern - viel zu anstrengend.
Lieber lesen wir weiter die Klimagrusel-Stories in der Tagespresse.
Wir wollen Ihnen das Blättern durch unzählige Journals ersparen.
Mit dem heutigen Beitrag starten wir eine Serie zur Kleinen Dürrekunde.
Einmal um den Globus und wieder zurück.
Beginnen möchten wir zuhause, in Europa.
Auf der Iberischen Halbinsel traten im 8. und 9. Jahrhundert nach Christus schwere Dürrephasen auf,
wie eine Auswertung alter maurischer Auswertungen durch ein Team um Fernando Domínguez-Castro ergab.
Von 971-975 war hingegen Schnee und Hagel häufiger als heute.
Im Abstract der Arbeit, die im März 2014 in The Holocene erschien, heißt es:
The Holocene
Climatic potential of Islamic chronicles in Iberia: Extreme droughts (ad 711-1010)From ad 711 to 1492, several regions in Iberia were under Muslim ruling.
This Al-Andalus civilization generated a large amount of documentation during those centuries.
Unfortunately, most of the documents are lost.
The surviving Arabic documentary sources have never been studied from a climate perspective.
In this paper, we present the first attempt to retrieve climate evidence from them.
We studied all the Islamic chronicles (documents written by Islamic historians that narrate the social, political and religious history) available for the period ad 711-1010.
It is shown that these sources recorded extreme events with a high temporal and spatial resolution.
We identified three severe droughts, ad 748-754, ad 812-823 and ad 867-879, affecting Al-Andalus.
We also noticed that the weather in Cordoba during the period ad 971-975 showed a higher frequency of snow and hail than current climate.
The possibility of obtaining long continuous series from this type of source seems highly difficult.
Nur einen Monat später berichtete eine Gruppe um Francisca Navarro-Hervás im selben Journal über
eine schwere iberische Dürrephase von anderthalb Jahrhunderten um 4550-4400 Jahre vor heute:
The Holocene / Francisca Navarro-Hervás
Evaporite evidence of a mid-Holocene (c. 4550-4400 cal. yr BP) aridity crisis in southwestern Europe and palaeoenvironmental consequencesSedimentological evidence for an abrupt dry spell in south-eastern Spain during the middle Holocene, from c. 4906 to 4384 cal. yr BP, is presented.
This phase was determined primarily from halite beds deposited between muddy slimes in a lagoon system of Puerto de Mazarrón (Murcia province) with a peak phase from c. 4550 to 4400 cal. yr BP.
A multi-core, multi-proxy study of 20 geotechnical drills was made in the lagoon basin to identify the main sedimentary episodes and depositional environments.
The results suggest that this halite bed, more than 80 cm thick, was conditioned by climate change and was accompanied by a generalized drying-out of the basin.
Halite precipitation was linked with palaeoecological changes, including forest and mesophyte depletions and increasing cover and diversity of xerophytic plant species.
Archaeological evidence indicates a demise of the population at this period probably due to resource exhaustion.
An overall picture of the biostratigraphy and palaeoclimates of the region is given in a broader geographical context.
Castro und Kollegen (2015) untersuchten ein Moor in der spanischen Serra do Xistral
und fanden in den letzten 5300 Jahren einen regen Wechsel zwischen 10 Feuchtperioden, getrennt durch Trockenphasen:
ScienceDirect / D. Castroa et al. (2015)
Climate change records between the mid- and late Holocene in a peat bog from Serra do Xistral (SW Europe) using plant macrofossils and peat humification analysesTo implement models of global change, information from peripheral regions and concerning the distinction between global and local events is needed.
In this context, we studied the occurrence of hydrological changes over the last 5300 years in the southern most European area of active blanket bogs.
The reconstruction of the bog surface wetness was performed on the basis of the analysis of plant macrofossils and peat humification.
To interpret these proxies, the current botanical composition of the bog and the ecological behavior of the different plant species were used.
From its present ecological behavior, we have established the main indicator species for different bog surface wetness.
The seeds of Juncus bulbosus and Drosera rotundifolia, which were significantly correlated with the humification index, as well as the seeds and rhizomes of Eriophorum angustifolium, were the primary indicators for wetness.
The Sphagnum species are not abundant, and most are restricted to wet and damp periods.
The concordance between both proxies, in spite of certain discrepancies, allowed us to estimate the chronological sequence of hydrological changes along the bog profile.
We have differentiated 10 wet periods during which the bog surface could be flooded or wet (5300-4850; 4350-3900; 3550-3350; 3150-3050; 2700-2450; 2250-2150; 1950-1300; 1150-1050; 900-800 and 700-20 cal. yr. BP).
These identified wet periods are in agreement with previous paleoclimate studies with different spatial scales and proxies.
Weiter in Frankreich. Labuhn und Kollegen veröffentlichten im November 2015 in Climate of the Past Discussions
eine Analyse der französischen Sommerdürren der letzten 700 Jahre.
Überraschend: Einen Langzeittrend gibt es nicht, dafür stark ausgeprägte natürliche Schwankungen.
Die Entwicklung der letzten Jahrzehnte passt bestens ins Bild der natürlichen Variabilität, die möglicherweise von Ozeanzyklen (NAO, AMO) angetrieben sein könnte.
Climate of the Past Discussions
French summer droughts since 1326 CE: a reconstruction based on tree ring cellulose d18O
 Dürreentwicklung in Frankreich der letzten 700 Jahre.
Dürreentwicklung in Frankreich der letzten 700 Jahre.
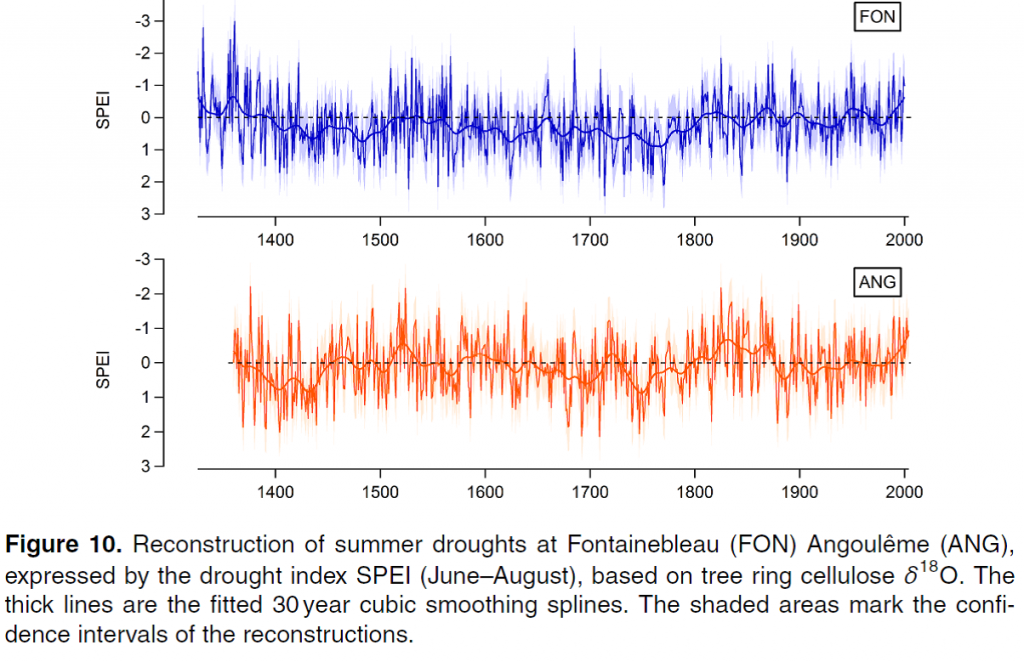
Bereits im Oktober 2014 hatte eine Gruppe um Sonja Szymczak in den Quaternary Science Reviews
eine Dürrerekonstruktion der letzten 800 Jahre für Korsika vorgestellt.
Fazit auch hier: Kein Trend! Das Dürregeschehen der letzten Jahrzehnte fügt sich nahtlos in die bekannte natürliche Dynamik der letzten Jahrhunderte ein (Abb. 2).
Quaternary Science Reviews Combining wood anatomy and stable isotope variations in a 600-year multi-parameter climate reconstruction from Corsican black pine

 Sommer-Niederschläge auf Korsika während der letzten 800 Jahre
Sommer-Niederschläge auf Korsika während der letzten 800 Jahre
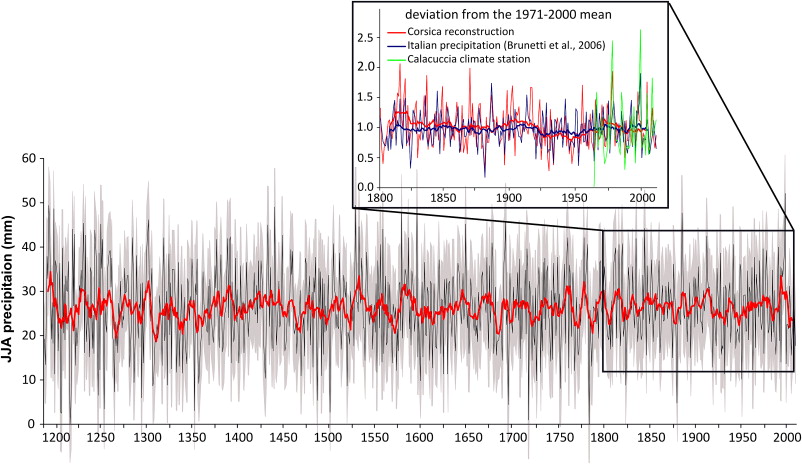
Springen wir weiter in die Tschechische Republik.
Im Oktober 2015 publizierten Dobrovolný et al. in Climate of the Past von hier
eine Dürrerekonstruktion für die letzten 1250 Jahre.
Wiederum fallen Schwankungen im Bereich der bekannten Ozeanzyklen auf, von einem Trend ist jedoch keine Spur (Abb. 3).
Die Entwicklung der letzten Jahrzehnte fällt voll und ganz in den Bereich der natürlichen Schwankungsbreite.
Climate of the Past / Dobrovolný et al.
A tree-ring perspective on temporal changes in the frequency and intensity of hydroclimatic extremes in the territory of the Czech Republic since 761 AD
 Niederschlagsentwicklung in der Tschechischen Republik seit 761 n.
Chr.
Niederschlagsentwicklung in der Tschechischen Republik seit 761 n.
Chr.
Ausschläge der roten Kurve ("negative extremes") nach unten markiert Dürren.
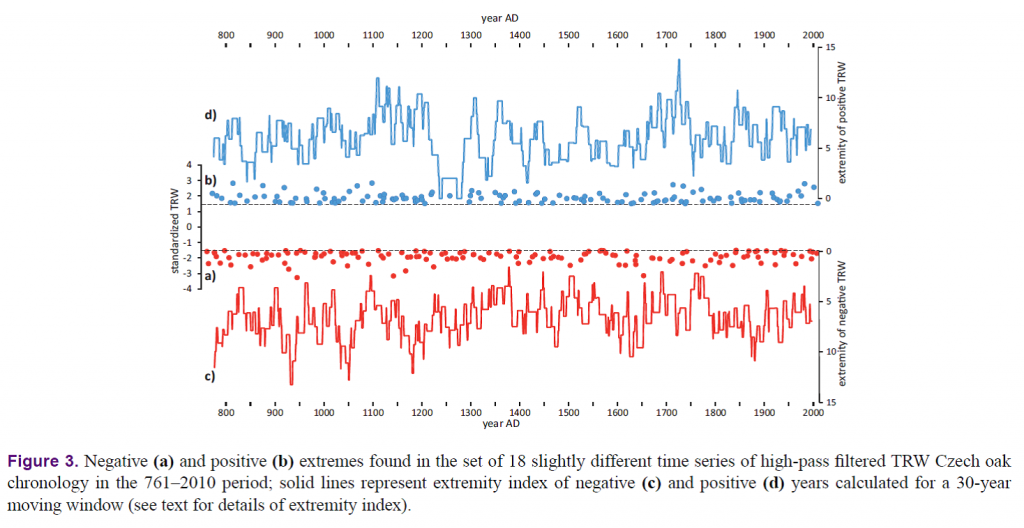
Nun nach Skandinavien. Krstina Seftgen & Team schauten sich
schauten sich Dürren, Überflutungen und anderes finnisches Extremwetter für die letzten 1000 Jahre an.
In der im Juni 2015 in Climate Dynamics erschienenen Arbeit dokumentieren die Autoren
das 17. Jahrhundert als am extremwetterreichsten.
Das 20. und frühe 21. Jahrhundert war in keinster Weise besonders im Kontext der letzten 1000 Jahre.
Hier ein Auszug aus der Kurzfassung der Arbeit:
Climate Dynamics
A tree-ring field reconstruction of Fennoscandian summer hydroclimate variability for the last millenniumTHE HOCKEY SCHTICK
New paper finds the 17th century had more extreme weather than the 20th centuryThe reconstruction gives a unique opportunity to examine the frequency, severity, persistence, and spatial characteristics of Fennoscandian hydroclimatic variability in the context of the last 1,000 years.
The full SPEI reconstruction highlights the seventeenth century as a period of frequent severe and widespread hydroclimatic anomalies.
Although some severe extremes have occurred locally throughout the domain over the fifteenth and sixteenth centuries, the period is surprisingly free from any spatially extensive anomalies.
The twentieth century is not anomalous in terms of the number of severe and spatially extensive hydro climatic extremes in the context of the last millennium.
Ein Blick in die Dürregeschichte sollte für jeden Redakteur zum Pflichtprogramm werden, bevor er über aktuelle Dürren schreibt.
Ein neuer europäischer Dürreatlas liefert eine gute Grundlage, wie Spiegel Online am 6. November 2015 meldete:
Klimageschichte: Atlas zeigt Europas Dürre-Katastrophen
Millionen Menschen starben in den Katastrophen:
Eine Karte zeigt, wann Europa von schwerer Dürre getroffen wurde - erstaunlich häufig.
Die Leute mussten Hunde und Pferde essen.
Doch bald gab es gar keine Nahrung mehr.
Millionen Menschen starben im Großen Hunger von 1315 bis 1322 in Europa.
Ursache war eine tödliche Witterung, wie sie in der Geschichte des Kontinents beachtlich häufig wiederkehrte.
Aus der Analyse alter Baumstämme haben Forscher die Geschichte von Dürrekatastrophen rekonstruiert.
Jeder Baumring lässt sich eindeutig einem Jahr zuordnen.
Aus der Breite von Jahresringen im Holz lesen Experten Niederschlag und Temperatur.
Der neue Dürre-Atlas der Alten Welt bietet auf Basis solcher Baumringanalysen einen Rückblick in die Klimageschichte Europas, des Nahen Ostens und Nordafrikas der vergangenen zwei Jahrtausende.
Die Klimadaten sind das Abbild gigantischer Katastrophen.
Sie zeigen im 14. Jahrhundert viele kalte Sommer.
1314 kamen schwere Regenfälle und ein harter Winter hinzu - auf Jahre hinaus mangelte es an Ernte.
Drückende Hitzewellen
Weiterlesen auf Spiegel Online.
Spiegel Online Atlas zeigt Europas Dürre-Katastrophen
Millionen Menschen starben in den Katastrophen: Eine Karte zeigt, wann Europa von schwerer Dürre getroffen wurde - erstaunlich häufig.
Im Folgenden die dazugehörige Pressemitteilung der Columbia University:
Columbia University
New Drought Atlas Maps 2,000 Years of Climate in EuropeCompletes the First Big-Picture View Across Northern Hemisphere
The long history of severe droughts across Europe and the Mediterranean has largely been told through historical documents and ancient journals, each chronicling the impact in a geographically restricted area.
Now, for the first time, an atlas based on scientific evidence provides the big picture, using tree rings to map the reach and severity of dry and wet periods across Europe, and parts of North Africa and the Middle East, year to year over the past 2,000 years.
Together with two previous drought atlases covering North America and Asia, the Old World Drought Atlas significantly adds to the historical picture of long-term climate variability over the Northern Hemisphere.
In so doing, it should help climate scientists pinpoint causes of drought and extreme rainfall in the past, and identify patterns that could lead to better climate model projections for the future.
A paper describing the new atlas, coauthored by scientists from 40 institutions, appears today in the journal Science Advances.
"The Old World Drought Atlas fills a major geographic gap in the data that's important to determine patterns of climate variability back in time," said Edward Cook, cofounder of the Tree Ring Lab at Columbia University's Lamont-Doherty Earth Observatory, and leader of all three drought-atlas projects.
"That's important for understanding causes of megadroughts, and it's important for climate modelers to test hypotheses of climate forcing and change."
For example, if Europe had a wet year north of the Alps and a dry year to the south, that provides clues to circulation patterns and suggests influence from the North Atlantic Oscillation, one of the primary sources of climate variability affecting patterns in Europe.
"You can't get that from one spot on a map," Cook said.
"That's the differentiator between the atlas and all these wonderful historic records - the records don't give you the broad-scale patterns."
The new atlas could also improve understanding of climate phenomena like the Atlantic Multi-decadal Oscillation, a variation in North Atlantic sea-surface temperatures that hasn't been tracked long enough to tell if it is a transitory event, forced by human intervention in the climate system, or a natural long-term oscillation.
By combining the Old World Drought Atlas with the Asia and North America atlases, climatologists and climate modelers may also discover other sources of internal climate variability that are leading to drought and wetness across the Northern Hemisphere, Cook said.
In the Science Advances paper, Cook and his coauthors compare results from the new atlas and its counterparts across three time spans: the generally warm Medieval Climate Anomaly (1000-1200); the Little Ice Age (1550-1750); and the modern period (1850-2012).
The atlases together show persistently drier-than-average conditions across north-central Europe over the past 1,000 years, and a history of megadroughts in the Northern Hemisphere that lasted longer during the Medieval Climate Anomaly than they did during the 20th century.
But there is little understanding as to why, the authors write.
Climate models have had difficulty reproducing megadroughts of the past, indicating something may be missing in their representation of the climate system, Cook said.
The drought atlases provide a much deeper understanding of natural climate processes than scientists have had to date, said Richard Seager, a coauthor of the paper and a climate modeler at Lamont-Doherty Earth Observatory.
"Climate variability tends to occur within patterns that span the globe, creating wet conditions somewhere and dry conditions somewhere else," said Seager.
"By having tree ring-based hydroclimate reconstructions for three northern hemisphere continents, we can now easily see these patterns and identify the responsible modes of variability."
The hemispheric scale adds to the potential uses of what was already the gold standard of paleo-hydroclimate research, said Sloan Coats, a climate dynamicist at the University of Colorado who studies megadroughts using the atlases.
"The fact that the drought atlases provide a nearly hemispheric view of hydroclimate variability provides an incredible amount of information that can be used to better understand what was happening in the atmosphere and ocean," Coats said.
In Europe and the Mediterranean, the new drought atlas expands scientists' understanding of climate conditions during historic famines.
For instance, an unusually cold winter and spring are often blamed for a 1740-1741 famine in Ireland.
The Old World Drought Atlas points to another contributor: rainfall well below normal during the spring and summer of 1741, the authors write in the paper.
The atlas shows how the drought spread across Ireland, England and Wales.
The atlas also tracks the reach of the great European famine of 1315-1317, when historical documents describe how excessive precipitation across much of the continent made growing food nearly impossible.
The atlas tracks the hydroclimate across Europe and shows its yearly progressions from 1314 to 1317 in detail, including highlighting drier conditions in southern Italy, which largely escaped the crisis.
The atlas may also help shed light on more recent phenomena, including a record 2006-2010 drought in the Levant that a recent Lamont study suggests may have helped spark the ongoing Syrian civil war.
The North America atlas, published in 2004, has been used by other researchers to suggest that a series of droughts starting around 900 years ago may have contributed to the eventual collapse of native cultures.
Likewise, the Asia atlas, published in 2010, has led researchers to connect droughts, at least in part, to the fall of Cambodia's Angkor culture in the 1300s, and China's Ming dynasty in the 1600s.
The tree ring data used to create the new atlas included cores from both living trees and timbers found in ancient construction reaching back more than 2,000 years.
They come from 106 regional tree ring chronologies, each with dozens to thousands of trees, and were contributed to the project by the International Tree Ring Data Bank and European tree-ring scientists.
Vielleicht sollten Modellierer die realen Dürreereignisse etwas besser studieren und verstehen, bevor sie ihre Rechenkästen anschmeißen.
Tallaksen & Stahl wiesen im Januar 2014 auf noch immer bestehende riesige Diskrepanzen in Europa zwischen modellierter virtueller und dokumentierter realer Welt.
Tallaksen & Stahl
Spatial and temporal patterns of large-scale droughts in Europe: Model dispersion and performance
↑
Deutschland
en Germany
fr Allemagne
-
Die kalte Sonne (Fritz Vahrenholt & Sebastian Lüning)
2015-06-30 de Klimabericht des Umweltbundesamtes (UBA) zu Deutschland: Kein statistisch gesicherter Anstieg extremer Niederschläge oder von Trockenperioden
↑
Schweden
en Sweden
fr Suède
-
Die kalte Sonne (Fritz Vahrenholt & Sebastian Lüning)
2012-10-20 de Wann herrschten in Schweden die schlimmsten Dürren? Im 17.-19. Jahrhundert während der Kleinen Eiszeit
-
Wiley Online Library
2012-09-13 en Reconstructed drought variability in southeastern Sweden since the 1650sAbstract
In this study, we present the first regional reconstruction of summer drought for southeastern Sweden.
The June-July standardized precipitation index (SPI) was reconstructed over the period 1650-2002 based on Pinus sylvestris L. tree-ring width data, where the reconstruction could account for 41.6% of the total variance in the instrumental record over 1901-2002.
Our reconstruction suggests an overall wet 18th century and a dry 19th century.
The most outstanding pluvial phase in the pre-instrumental period took place in the mid-1720s and lasted over 50 years, while multi-decadal periods of below average moisture conditions were reconstructed in the 1660s-1720s, 1800s-early 30s, and in the 1840s-50s.
Several of these dry spells have previously been found in reconstructions from Sweden and Finland, indicating that our reconstruction reflects large-scale moisture anomalies across eastern Fennoscandia.
Comparison of the SPI estimates with mid-tropospheric pressure patterns suggests that summertime drought is associated with positive pressure anomalies over British Isles and the North Sea, while an eastward movement of the Icelandic low-pressure systems over the western part of central Fennoscandia results in wetter than normal June-July conditions over the region of interest.
↑ USA
-
Die kalte Sonne (Fritz Vahrenholt & Sebastian Lüning)
2017-07-11 de Dürrephasen an der US-Westküste von Ozeanzyklen gesteuert: Klimamodelle können das Muster nicht reproduzieren
Extremwetter kann nur im klimahistorischen Kontext verstanden werden.
Hier muss ein Automatismus entstehen:
Beim Auftreten einer Dürre heute, sollte sofort die Frage gestellt werden, wie sich dies in den hydroklimatischen Verlauf der letzten Jahrhunderte und Jahrtausende einordnet.
Wir wollen heute über den großen Teich in die USA blicken, zunächst nach Florida.
Ein Forscherteam um Grant Harley rekonstruierte die die Wasserführung des zweitgrößten Flusses in Florida.
Die Ergebnisse erschienen im Januar 2017 im Journal of Hydrology.
Überraschenderweise ereigneten sich die schlimmsten Dürren im 16. bis 19. Jahrhundert.
Am schlimmsten war es wohl in den 1560er Jahren als der Suwannee River über längere Zeit nur 17% der Normalwassermenge führte.
Harley und Kollegen fanden zudem Zyklen in den historischen Niederschlägen, die auf eine Beeinflussung durch Ozeanzyklen hinweisen.
Hier der Abstract:
Journal of Hydrology
Suwannee River flow variability 1550-2005 CE reconstructed from a multispecies tree-ring networkAlthough extreme dry and wet events occurred in the gage record, pluvials and droughts that eclipse the intensity and duration of instrumental events occurred during the 16-19th centuries.
The most prolonged and severe dry conditions during the past 450 years occurred during the 1560s CE.
In this prolonged drought period mean flow was estimated at 17% of the mean instrumental period flow.
Significant peaks in spectral density at 2-7, 10, 45, and 85-year periodicities indicated the important influence of coupled oceanic-atmospheric processes on Suwannee River streamflow over the past four centuries,
Weiter in Texas, wo David Rupp und Kollegen keinen Trend zu verminderten Regenfällen in ihren Modellen feststellen konnten (Rupp et al. 2015):
Rupp et al. 2015
Anthropogenic influence on the changing likelihood of an exceptionally warm summer in Texas, 2011However, no simulated increase in the frequency of large precipitation deficits, or of soil moisture deficits, was detected from preindustrial to year 2011 conditions.
Nun zum Walker Lake an der Grenze von Nevada und Kalifornien.
Hatchett und Kollegen rekonstruktierten die Niederschläge für die letzten 1000 Jahre und fanden einen charakteristischen Wechsel von Trocken- und Feuchtphasen (Hatchett et al. 2015):
(Hatchett et al. 2015
Placing the 2012-2015 California-Nevada drought into a paleoclimatic context: Insights from Walker Lake, California-Nevada, USAAssessing regional hydrologic responses to past climate changes can offer a guide for how water resources might respond to ongoing and future climate change.
Here we employed a coupled water balance and lake evaporation model to examine Walker Lake behaviors during the Medieval Climate Anomaly (MCA), a time of documented hydroclimatic extremes.
Together, a 14C-based shoreline elevation chronology, submerged subfossil tree stumps in the West Walker River, and regional paleoproxy evidence indicate a ~50?year pluvial episode that bridged two 140+? year droughts.
We developed estimates of MCA climates to examine the transient lake behavior and evaluate watershed responses to climate change.
Our findings suggest the importance of decadal climate persistence to elicit large lake-level fluctuations.
We also simulated the current 2012-2015 California-Nevada drought and found that the current drought exceeds MCA droughts in mean severity but not duration.
Coats et al. 2016 untersuchten ebenfalls die Dürregeschichte in den westlichen USA während des letzten Millenniums
und konnten Ozeanzyklen als wichtigen Treiber ausmachen.
Allerdings können die gängigen Klimamodelle diesen Zusammenhang nicht nachvollziehen, was die Prognosleistung der Simulationen stark beeinträchtigt.
Hier der Abstract aus de Geophysical Research Letters:
Geophysical Research Letters
Internal ocean-atmosphere variability drives megadroughts in Western North AmericaMultidecadal droughts that occurred during the Medieval Climate Anomaly represent an important target for validating the ability of climate models to adequately characterize drought risk over the near-term future.
A prominent hypothesis is that these megadroughts were driven by a centuries-long radiatively forced shift in the mean state of the tropical Pacific Ocean.
Here we use a novel combination of spatiotemporal tree ring reconstructions of Northern Hemisphere hydroclimate to infer the atmosphere-ocean dynamics that coincide with megadroughts over the American West and find that these features are consistently associated with 10-30?year periods of frequent cold El Niño-Southern Oscillation conditions and not a centuries-long shift in the mean of the tropical Pacific Ocean.
These results suggest an important role for internal variability in driving past megadroughts.
State-of-the-art climate models from the Coupled Model Intercomparison Project Phase 5, however, do not simulate a consistent association between megadroughts and internal variability of the tropical Pacific Ocean, with implications for our confidence in megadrought risk projections.
Erika Wise präsentierte in den Geophysical Research Letters 2016 eine Dürre-Rekonstruktion für die US-Westküste.
In den letzten 500 Jahren sind immer wieder Dürren aufgetreten, die denen der Heutezeit ähnelten.
Geophysical Research Letters
Five centuries of U.S. West Coast drought: Occurrence, spatial distribution, and associated atmospheric circulation patternsThe U.S. West Coast drought commencing in 2012 developed in association with a large, persistent high-pressure ridge linked to internal atmospheric variability.
This study places the occurrence, spatial patterns, and associated circulation features of West Coast drought into a paleoclimate context through a synoptic dendroclimatology approach linking atmospheric circulation to surface hydroclimate patterns.
Spatial reconstructions of upper atmosphere pressure patterns and cool-season drought show that West Coast-wide drought, although relatively rare compared to north-south dipole drought, has occurred periodically since 1500 Common Era and is consistently associated with a strong ridge centered along the Pacific Northwest coast.
Atmospheric blocking is also linked to north-dry dipole droughts, while south-dry and wider Western droughts indicate La Niña-type patterns.
The transition latitude between the northern and southern sides of the western precipitation dipole, important for California hydroclimate patterns, has had frequent year-to-year fluctuations but remained centered on 40°N over the past five centuries.
Eine Trendstudie von Ge et al. 2016 zu den US-Westküstendürren
dokumentiert Schwankungen und Trends.
Ge et al. 2016
Spatial and temporal patterns of drought in the Continental U.S. during the past century
-
Die kalte Sonne (Fritz Vahrenholt & Sebastian Lüning)
2017-07-07 de Klimageschichte der USA: Die Jahrtausend-Dürre von 1934Extremwetter ist ein wiederkehrendes Problem auf der Erde.
Keine Region ist dagegen immun.
Das hält Klimaaktivisten nicht davon ab, die Ereignisse zu instrumentalisieren.
Bei jeder Dürre, Starkregen, Hitzewelle oder Kältewelle stürmen die interessierten Klimaapokalyptiker zu den Mikrofonen und warnen mit besorgter Miene vor einer kommenden Steigerung des Klimaübels.
Dagegen kann man wenig machen, denn die Damen und Herren Journalisten dürsten nach Sensationen.
Eine fruchtbare Zusammenarbeit.
Dazu kommt dann noch die Politik, die mit Hinweis auf die vermeintliche Klimabedrohung unpopuläre Einschnitte durchboxt.
Angesichts dieser eng verbandelten Interessensgemeinschaft bleibt uns nichts weiter übrig, uns an dieser Stelle auf die wissenschaftlichen Fakten zu beschränken.
Mehr können wir nicht tun.
Heute blicken wir auf das Dürregeschehen in den USA.
Was gibt es Neues aus diesem Teil der Welt?
Aus dem Februar 2017 stammt eine Arbeit von McCabe et al. im International Journal of Climatology.
Fazit: Es gibt große regionale Unterschiede.
International Journal of Climatology
Variability of runoff-based drought conditions in the conterminous United States...for most of the [conterminous United States], drought frequency appears to have decreased during the 1901 through 2014 period.
Insgesamt sind Dürren jedoch seltener geworden:
A Reduction in US Drought Over the Period 1901-2014
Zudem konnte über die letzten 100 Jahre ein langfristiger Rückgang bei den sogenannten Flash-Hitzwellen in den USA festgestellt werden,
wie Mo & Lettenmaier 2015 berichteten:
Mo & Lettenmaier 2015
Heat wave flash droughts in declineHeat wave flash droughts in decline
Flash drought is a term that was popularized during rapidly evolving droughts in the Central U.S. in 2012 that were associated with heat waves.
We posit that there are two kinds of flash droughts, and we will focus on heat wave flash droughts, of which the 2012 events were typical.
We find, based on an analysis of temperature observations and model-reconstructed soil moisture (SM) and evapotranspiration from 1916 to 2013, that heat wave flash droughts in the conterminous U.S. (CONUS) are most likely to occur over the Midwest and the Pacific Northwest during the growing season.
We also find that the number of such events across the CONUS has been decreasing over the last century but rebounded after 2011.
The long-term downward trends appear to be associated with generally increasing trends in SM resulting from increasing trends in precipitation over the areas where heat wave flash droughts are most likely to occur.
Richard Seager and Martin Hoerling wiesen bereits im Juni 2014 im Journal of Climate darauf hin,
dass ein großer Teil der nordamerikanischen Dürreentwicklung durch Ozeanzyklen gesteuert wird:
Journal of Climate / Richard Seager and Martin Hoerling
Atmosphere and Ocean Origins of North American DroughtsThe atmospheric and oceanic causes of North American droughts are examined using observations and ensemble climate simulations.
The models indicate that oceanic forcing of annual mean precipitation variability accounts for up to 40% of total variance in northeastern Mexico, the southern Great Plains, and the Gulf Coast states but less than 10% in central and eastern Canada.
Observations and models indicate robust tropical Pacific and tropical North Atlantic forcing of annual mean precipitation and soil moisture with the most heavily influenced areas being in southwestern North America and the southern Great Plains.
In these regions, individual wet and dry years, droughts, and decadal variations are well reproduced in atmosphere models forced by observed SSTs.
Oceanic forcing was important in causing multiyear droughts in the 1950s and at the turn of the twenty-first century, although a similar ocean configuration in the 1970s was not associated with drought owing to an overwhelming influence of internal atmospheric variability.
Up to half of the soil moisture deficits during severe droughts in the southeast United States in 2000, Texas in 2011, and the central Great Plains in 2012 were related to SST forcing, although SST forcing was an insignificant factor for northern Great Plains drought in 1988.
During the early twenty-first century, natural decadal swings in tropical Pacific and North Atlantic SSTs have contributed to a dry regime for the United States.
Long-term changes caused by increasing trace gas concentrations are now contributing to a modest signal of soil moisture depletion, mainly over the U.S. Southwest, thereby prolonging the duration and severity of naturally occurring droughts.
Auch Kam et al. 2014 sehen
in den Ozeanzyklen einen wichtigen Steuerungmechanismus für die USA:
Kam et al. 2014
Changes in drought risk over the contiguous United States (1901-2012): The influence of the Pacific and Atlantic OceansWe assess uncertainties in the influence of sea surface temperatures on annual meteorological droughts over the contiguous U.S. within a Bayesian approach.
Observational data for 1901-2012 indicate that a negative phase of the Pacific Decadal Oscillation (PDO) and the El Niño-Southern Oscillation (ENSO) elevated annual drought risk over the southern U.S., such that the 4 year return period event becomes a 3 year event, while a positive phase of the Atlantic Multidecadal Oscillation has a weak influence.
In recent decades, the impacts of the negative phases of the PDO and ENSO on U.S. drought have weakened and shifted toward the southwestern U.S.
These changes indicate an increasing of role of atmospheric variability on the U.S. drought overall with implications for long-term changes in drought and the potential for seasonal forecasting.
Abschließend noch ein Paper von Cook et al. 2014 über
die schlimmste Dürre Nordamerikas des letzten Jahrtausends.
Sie stammt nicht etwas aus den letzten Jahren sondern ereignete sich bereits 1934:
Cook et al. 2014
The worst North American drought year of the last millennium: 1934The worst North American drought year of the last millennium: 1934
During the summer of 1934, over 70% of western North America experienced extreme drought, placing this summer far outside the normal range of drought variability and making 1934 the single worst drought year of the last millennium.
Strong atmospheric ridging along the West Coast suppressed cold season precipitation across the Northwest, Southwest, and California, a circulation pattern similar to the winters of 1976-1977 and 2013-2014.
In the spring and summer, the drying spread to the Midwest and Central Plains, driven by severe precipitation deficits downwind from regions of major dust storm activity, consistent with previous work linking drying during the Dust Bowl to anthropogenic dust aerosol forcing.
Despite a moderate La Niña, contributions from sea surface temperature forcing were small, suggesting that the anomalous 1934 drought was primarily a consequence of atmospheric variability, possibly amplified by dust forcing that intensified and spread the drought across nearly all of western North America.
Hier noch die dazugehörige Pressemitteilung der NASA aus dem Oktober 2014:
Pressemitteilung der NASA
NASA Study Finds 1934 Had Worst Drought of Last Thousand YearsA new study using a reconstruction of North American drought history over the last 1,000 years found that the drought of 1934 was the driest and most widespread of the last millennium.
Reference: Cook et al. 2014
The worst North American drought year of the last millennium: 1934.
-
Die kalte Sonne (Fritz Vahrenholt & Sebastian Lüning)
2014-05-01 de Tausend Jahre Dürregeschichte der USA: Am schlimmsten war es in der Kleinen Eiszeit. Aber auch während der Mittelalterlichen Wärmeperiode gab es heftige Mega-Dürren
-
Die kalte Sonne (Fritz Vahrenholt & Sebastian Lüning)
2014-05-02 de Kleine Dürregeschichte der USA der vergangenen 10.000 Jahre: Schon die Indianer mussten immer wieder unter Trockenheit leiden
↑
Südamerika
en South America
fr Amérique du Sud
-
Die kalte Sonne (Fritz Vahrenholt & Sebastian Lüning)
2019-06-09 de Haben Dürren die Maya-Kultur zu Fall gebracht?Severe Drought May Have Helped Hasten Ancient Maya's Collapse
-
Die kalte Sonne (Fritz Vahrenholt & Sebastian Lüning)
2018-01-27 de Nichts Neues: Dürren machten Südamerika auch in vorindustriellen Zeiten zu schaffenImmer wenn es in Kolumbien wärmer wurde, etwa vor 1000 Jahren zur Zeit der Mittelalterlichen Wärmeperiode, blieb in der andischen Zentralcordillere der Regen aus.
↑
Australien
en Australia
fr Australie
-
Real Science (Steven Goddard)
2015-09-26 en Sydney Had No Rain For Six Months In 1790
↑
Afrika
en Africa
fr Afrique
-
Die kalte Sonne (Fritz Vahrenholt & Sebastian Lüning)
2017-07-10 de Déjà vu: Bereits vor 1000 Jahren blieb in Kapstadt für einige Jahrhunderte der Winterregen aus und führte zu DürrenIm "Blog der Republik" wurde am 9. Juni 2017 die aktuelle Dürre in Südafrika ohne lange zu fackeln mit dem Klimawandel verbandelt.
Ohne Frage, Trump hat Schuld an der Wasserknappheit!
Auch wenn US-Präsident Trump den Klimawandel leugnet, Kapstadt leidet unter dramatischer Dürre.
Die südafrikanische Metropole Kapstadt leidet unter der schlimmsten Dürre seit 113 Jahren.
Drastische Notverordnungen sollen das Wassersparen forcieren.
Dazu sollen auch drastisch erhöhte Preise und viel Kommunikationsarbeit beitragen.
Alles nur Tropfen auf dem heißen Stein und zu spät?
Obwohl sich das Drama seit Jahren angekündigt hatte, verließ sich die Politik allein auf den Winterregen - und der ist bisher wieder ausgeblieben.
Jetzt leiden Bevölkerung und Wirtschaft. [...]
Auch wenn der US-Präsident Donald Trump den Klimawandel leugnet, in Südafrika sind seine Folgen unübersehbar.
Weiterlesen im Blog der Republik
Blog der Republik
Auch wenn US-Präsident Trump den Klimawandel leugnet, Kapstadt leidet unter dramatischer Dürre.Es ist immer wieder erstaunlich, wie wenig sich die Kommentatoren in der Klimageschichte auskennen.
Aufgrund dieser historischen Kurzsichtigkeit konstruieren sie dann abenteuerliche Zusammenhänge.
Die allererste Frage sollte doch sein, ob der Winterregen zuvor stets stabil war oder es auch früher schon Schwankungen gegeben hat.
Falls der Regen geschwankt hat, was war der Antrieb der Variabilität?
Und schon sind wir wieder bei unserem Projekt zur Mittelalterlichen Klimaanaomalie, das neben Temperaturschwankungen auch historische Veränderungen in den Niederschlägen erfasst.
Ein Klick auf die Projektkarte reicht, um die entsprechenden Studien aus dem Winterregengebiet Kapstadts zu identifizieren.
Untersuchungen am Offshore Sedimentkern GeoB 8323 sowie in Lake Verlorenvlei, Princessvlei Lake und Katbakkies Pass zeigen, dass der Winterregen bereits vor 1000 Jahren für 200 Jahre reduziert war und Dürren verursachte.
Dies sind die gelb-gefärbten Punkte auf der Karte (sowie ein nahegelegener roter Punkt).
Wenn Sie auf die Punkte klicken, können Sie sogar die wichtigsten Abbildungen öffnen, die die historischen Schwankungen im Winterregen dokumentieren.
Mittelalterlichen Klimaanaomalie
Die Mittelalterliche WärmeperiodeProjektkarte
Medieval Warm Period
⇧
12 Hitzewellen
en Heat Waves
fr Canicules
Mit folgenden Links wird von anderen Webseiten auf diese Seite verwiesen:
| de | en | fr |
|---|---|---|
|
Wetterphänomene Hitzewellen |
Weather phenomena Heat Waves |
Phénomènes météorologiques Canicules |
Links zur Klimaschau
|
|
▶Hitzewellen |
- Verzeichnis │ Allgemein │ Text
⇧ de Verzeichnis en Contents fr Sommaire
- 2018
- de Sommerhitze 2018
- de Es gibt keine "globale Hitzewellen"
- de
Die jahrelange beispiellose Hitze- und Dürreperiode in Europa um 1540
en The year-long unprecedented European heat and drought of 1540 - 2016
- en The Incredible Heatwave Of January 1896 In Australia
- 2015
- en Building The Hockey Stick Ahead Of Paris
- de Minnesota's Extreme Past
- en Iowa Summers Used To Be Much Hotter And Longer
- en September In Indiana Used To Be Hot
- en
The World's Top Climate Scientist Is A Complete Moron
Heatwaves have been on the decline in Texas since the 1920s - en Hot Days Are A Thing Of The Past In Michigan
- en Hot Weather Is A Thing Of The Past In South Dakota
- en Hot Weather Is A Thing Of The Past
- 2012
- de
Ist das noch normal? Die extrem schwierige Analyse von Extremwetter
Anzahl der jährlichen Hitzetage in Zürich für die vergangenen 50 Jahre
⇧ de Allgemein en General fr Générale
-
Wikipedia
de
Hitzewelle
en Heat wave
fr Canicule
Siehe auch:
| de | en | fr |
|---|---|---|
|
Wetterphänomene Dürreperioden |
Weather phenomena Periods of Droughts |
Phénomènes météorologiques Periodes de sécheresses |
⇧ de Text en Text fr Texte
↑
Hitzewellen
en Heat waves
fr Canicules
Hitzewellen / Heat waves / Vagues de chaleur
-
Naturgewalt.de
de Dürren/Hitze/Hungersnöte
de Brände/Waldbrände
|
ca. 900 - 1350 |
|
||||||
| 1540 |
de
Hitzesommer: Überraschung in Westeuropa - Hitzesommer
aus dem Jahr 1540 deutlich wärmer als vermeintlicher Rekordinhaber 2003 en An underestimated record breaking event: why summer 1540 was very likely warmer than 2003 Lange hatte man angenommen, dass die Hitzewelle von 2003 für das letzte Jahrtausend einzigartig gewesen wäre und es kein vergleichbares Hitzeereignis in dieser Zeit in Westeuropa gegeben habe. Dies stellt sich nun offenbar als Irrtum heraus. ... als die Temperaturen während eines Schweizer Hitzesommers im Jahre 1540 den Sommer von 2003 deutlich übertrumpften. |
||||||
| 1615 | war ein so heißer Sommer, dass das Vieh vor Hitze umfiel. | ||||||
| 1636 |
war ein so heißer Sommer, dass die Brunnen austrockneten. Die Hitze dauerte von März bis Juli, die Wälder und Moore brannten. |
||||||
| 1830 | de Hitzewelle in Philadelphia / en Heat Wave in Philadelphia | ||||||
| 1904 |
extrem trocken und heiß. Hitzewelle stoppt die Flussschifffahrt. Tropische Hitze ganz Mitteleuropa. Berlin 16.7. 35,5°. Wasserstand Weichsel und Oder tiefster Stand seit 1811. Elbe in Dresden fast ausgetrocknet. |
||||||
| 1911 | Hitzewelle Mitteleuropa. Berlin am 23.7. 34,6° Hitzewelle Osten USA, New York 40°, Tausende sterben an Hitzschlag. | ||||||
| 1913 |
de
Neuer offizieller Hitzerekord stammt aus dem Jahr 1913
| ||||||
| 1921 | Lang anhaltende Hitzewelle Europa. Probleme bei der Wasserversorgung, Einschränkungen im Schiffsverkehr. 20.7. Karlsruhe 39° | ||||||
| 1922 | nach sonnigem Juni kurze Hitzewelle, 6.7. Frankfurt/M. 37° | ||||||
| 1923/24 |
de
Die schlimmste Hitzewelle aller Zeiten - 1923/24 en World's Worst Heatwave - The Marble Bar heatwave, 1923-24 |
||||||
| 1926 | ...dann oft schwül und warm. lange Hitzewelle im Osten der USA, Hunderte Tote. 18.7. Heuschreckenplage UdSSR, Heuschreckenwolke 6,5 km lang, 4 km breit. | ||||||
| 1930 | Hitzewelle Mittlerer Westen/USA, über 200 Tote, Missouri bis 48°. | ||||||
| 1934 | Presse: "Wetterkatastrophen in allen Teilen der Welt" "beispiellose" Hitzewelle an der Ostküste der USA, am 5.7. New York 55°C (!), viele Opfer, Kansas City an 27 Tagen hintereinander über 40°, verdorrte Felder, ausgetrocknete Flüsse, Heuschrecken- und Käferplage. | ||||||
| 1935 | Hitzewelle im Mittleren Westen/USA setzt die Dürre fort. 150 Tote. | ||||||
| 1936 |
en
North American heat wave The 1936 North American heat wave was the most severe heat wave in the modern history of North America at the time. |
||||||
| 1949 | Hitzewelle in Mittel- und Südeuropa, am Mittelmeer teilweise über 40°, Wasserknappheit überall, Ernteausfälle, 10.7. Fußball-Endspiel :"Glutspiel von Stuttgart". | ||||||
| 1952 | Hitzewelle in Europa, 200 Tote, BRD bis 39,6°, Florenz 40° | ||||||
| 1957 | Hitzewelle hält an bis zum 10.7., Wasserknappheit, 15 Tage durchgehend über 30°, 7.7. bis 39°, 4.7. Zugspitze 14°, Wassernotstand in Niedersachsen, Nordsee ist 22° warm. | ||||||
| 1963 | Hitzewelle und Trockenheit, oft über 30°, Rekorde. | ||||||
| 1977 | 13.7. Hitzewelle im Osten der USA, Blitzschlag legt die gesamte Stromversorgung New Yorks lahm. | ||||||
| 1982 | Hitzewelle Nord-Europa, 2.8. Oslo 35° | ||||||
| 1983 | Sommer heiß und trocken, einer der Jahrhundertsommer, Deutschland bis 40,1°, Trinkwasserknappheit. | ||||||
| 1988 | Dürre USA hält an, "Erinnerungen an die 30ger Jahre". Hitzewelle in Griechenland. | ||||||
| 1993 | Hitzewelle Ostküste der USA, Washington bis 40°, | ||||||
| 1994 |
Hitzewelle in Deutschland, einer der Jahrhundertsommer, teilweise
wärmster Juli seit Beginn der Aufzeichnungen. Wetteramt widerspricht Klaus Töpfer, der für das Wetter die Klimakatastrophe verantwortlich macht. |
||||||
| 1996 | Hitzewelle in Ägypten, 22 Tote. | ||||||
| 1998 | Hitzewelle in Italien und Griechenland. | ||||||
| 1999 | Hitzewelle in Russland, 142 Tote. | ||||||
| 2003 |
de
Hitzesommer: Überraschung in Westeuropa - Hitzesommer
aus dem Jahr 1540 deutlich wärmer als vermeintlicher Rekordinhaber 2003 en An underestimated record breaking event: why summer 1540 was very likely warmer than 2003 Lange hatte man angenommen, dass die Hitzewelle von 2003 für das letzte Jahrtausend einzigartig gewesen wäre und es kein vergleichbares Hitzeereignis in dieser Zeit in Westeuropa gegeben habe. Dies stellt sich nun offenbar als Irrtum heraus. ... als die Temperaturen während eines Schweizer Hitzesommers im Jahre 1540 den Sommer von 2003 deutlich übertrumpften. |
||||||
| 2010 |
de
Rekord-Hitzewelle in Ost- und Nordosteuropa - Menetekel für die
Skeptiker? Kurz gesagt, Katastrophe ja, Klimakatastrophe eindeutig nein! en NOAA on the Russian heat wave: blocking high, not global warming |
||||||
| 2012 |
de Hitzewelle in den USA en USA Heat Wave fr Vague de chaleur aux Étas Unis |
||||||
| 2018 |
de Sommer 2018 en Summer 2018 fr Été 2018 |
||||||
⇧ 2018
↑ Sommerhitze 2018
-
Basler Zeitung / Martin A. Senn
2018-08-16 de Wenn das Denken baden gehtIm Zuge der Klima-Hysterie ist zu befürchten, dass noch vor den Gletschern das menschliche Denken den Hitzetod stirbt.
Bei 23 Grad Celsius, habe ich gelesen, sei die Denkfähigkeit der Leute am besten, dann nehme sie ziemlich rasch ab, und ab 27 Grad sacke sie regelrecht zusammen.
Nun ist es mit Studien zwar so eine Sache, aber diese liess sich ja in den letzten Wochen quasi in Echtzeit verifizieren.
Und was der Hitzesommer an intellektuellen Sonderleistungen hervorgebracht hat, schien den Befund der Studie glasklar zu belegen, ja es nährte gar die Befürchtung, dass noch vor den Gletschern das menschliche Denken den Hitzetod sterben könnte.
de Panik-Küche en Panic laboratory fr Marmite alarmiste
-
ntv
2018-07-30 de "Bestätigt" den Klimawandel: Für Latif ist Sommerhitze "außergewöhnlich"Mehr als 30 Grad und das seit Tagen:
Deutschland ächzt unter einer Hitzeperiode.
Für den Wissenschaftler und Klimaforscher Mojib Latif ist sie erst der Anfang: "Wir erleben immer mehr Hitzetage mit 30 Grad oder mehr."Die derzeitige Hitzewelle ist nach Auffassung des Wissenschaftlers Mojib Latif "außergewöhnlich, weil sie schon so lange anhält".
Es bestätige sich "mehr und mehr, was wir Klimaforscher lange vorausgesagt haben",
und zwar mit Blick auf den Klimawandel in Deutschland,
sagte der Meteorologe und Professor am Kieler Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung der "Passauer Neuen Presse"."Seit Beginn der Messungen hat sich die durchschnittliche Temperatur um 1,4 Grad erhöht.
Das ist mehr als im globalen Durchschnitt", erklärte Latif.
"Die Sommerhitze nimmt zu.
Wir erleben immer mehr Hitzetage mit 30 Grad oder mehr. Zugleich nimmt die Zahl der Tropennächte zu, in denen die Temperatur nicht mehr unter 20 Grad fällt."
Zugleich nehme die Zahl der Frosttage in Deutschland immer weiter ab.
"Das ist ein offensichtlicher Trend."
Kurzfristig lasse sich diese Entwicklung nicht aufhalten, sagte der Kieler Klimaforscher und betonte: "Die internationale Politik tut zu wenig, steuert nicht konsequent um. Der weltweite CO2-Ausstoß steigt immer weiter an, die Erderwärmung nimmt immer weiter zu."
Auch die Bundesregierung tue "zu wenig und wird ihrer Verantwortung nicht gerecht".
So habe beispielsweise die Automobilindustrie "die Selbstverpflichtungen zum Klimaschutz und zum Schadstoffausstoß nie eingehalten".
Latif bedauerte: "Diese kurzfristigen wirtschaftlichen Interessen dominieren die langfristigen Interessen der Umwelt und des Landes.
Je länger wir zögern und nichts tun, desto gefährlicher wird es."
▶Prognosen von Prof. Mojib Latif
▶
![]() Rückkehr der Sintflut: Schellnhuber, Latif, Rahmstorff
Rückkehr der Sintflut: Schellnhuber, Latif, Rahmstorff
| Mojib Latif |
Dr. rer. nat.,
Professor für Meteorologie am Leibniz-Institut für
Meereswissenschaften (IFM-GEOMAR) an der Universität Kiel.
▶Mojib Latif: Who is who (Aktivisten der anthropogenen Erwärmung) |
de Panik-Küche en Panic laboratory fr Marmite alarmiste
-
Die kalte Sonne (Fritz Vahrenholt & Sebastian Lüning)
2018-08-15 de Dürregeschichte Mitteleuropas: Klimaforscher Christian Pfister mit unerklärlichen GedächtnislückenAm 2. August 2018 brachte SRF ein längeres Radiointerview mit dem bekannten Berner Klima-Historiker Christian Pfister zur diesjährigen langen Dürreperiode in Mitteleuropa.
Pfister bezeichnet das Dürrejahr 1540 als Ausreißer, während die Dürre 2018 die zukünftige Norm darstellen könnte.
Eine steile These.
Zumal sie dem widerspricht, was der heute emeritierte Klimahistoriker Pfister noch im Jahr 2000 selber feststellte (pdf hier).
Dürresommer im Schweizer Mittelland seit 1525
Eine seltsame Gedächtnislücke.
Im Fazit der Arbeit lesen wir doch tatsächlich, dass beim Vergleich des Zeitraums von 1525 bis 2000 die häufigsten Dürren in Mitteleuropa während des Maunder-Minimum im 17. Jahrhundert auftraten und am wenigsten im 20. Jahrhundert:
...
Schussfolgerung
Man reibt sich verwundert die Augen.
Was passiert hier genau?
Will oder kann sich Pfister nicht mehr erinnern?
War alles falsch, was er früher gemacht hat?
Steht er lieber auf der Seite der vermeintlich Guten und verbiegt zu diesem Zweck sogar die Realitäten?
| SRF |
Schweizer Radio und Fernsehen
▶SRF: Who is who (Medien der Globalen Erwärmung) |
| de | en | fr |
|---|---|---|
|
Wetterphänomene Dürreperioden |
Weather phenomena Periods of Droughts |
Phénomènes météorologiques Periodes de sécheresses |
| de | en | fr |
|---|---|---|
|
Wetterphänomene Hitzewellen |
Weather phenomena Heat Waves |
Phénomènes météorologiques Canicules |
de Panik-Küche en Panic laboratory fr Marmite alarmiste
-
Tages-Anzeiger / Linus Schöpfer Redaktor Kultur
2018-08-11 de Wissenschaft vs. SVP«Von der Realität überholt», «schlicht falsch»: Klimaforscher kritisieren das Umweltprogramm der Volkspartei scharf.
Knutti bemängelt faktische Fehler.
Etwa die Aussage der SVP, seit 2005 habe es abgekühlt. Dieser «Mythos der Klimapause» sei schon lange widerlegt.
Die Behauptung, «dass in diesem Jahrhundert keine Klimaerwärmung stattgefunden und das Meer sich sogar abgekühlt hat», sei, so der ETH-Wissenschaftler, «schlicht falsch».
Knutti verweist auf den Stand der Forschung. Diesem zufolge sei der Mensch mit einer Wahrscheinlichkeit «von mehr als 95 Prozent der Hauptverursacher der globalen Erwärmung seit 1950».
Und die SVP?
Das Generalsekretariat erklärt, man überarbeite derzeit das Parteiprogramm, somit auch die klimapolitischen Positionen.
Deshalb wolle man die Beanstandungen der Forscher nicht kommentieren.
Der Clinch zwischen Wissenschaft und Volkspartei dürfte jedenfalls weiterbestehen:
Mit «Überraschungen» sei im neuen Papier nicht zu rechnen, so das Sekretariat.
| Reto Knutti |
Professor, Dr., Institut für Atmosphäre und Klima, ETH Zürich
Er erforscht den Einfluss des Menschen auf das Klimasystem.
Er ist Hauptautor des Berichts des Uno-Klimarats IPCC, der
2013 erschien.
▶Reto Knutti: Who is who (Anthropogene Globale Erwärmung) ▶Reto Knutti: Wikipedia (Profiteure) |
| de | en | fr |
|---|---|---|
| Neuste Informationen über den Klimawandel | News on Climate Change | Nouvelles informations sur le changement climatique |
| Die Erwärmungspause | The Hiatus | La pause du réchauffement climatique |
▶
SVP Schweiz: Für eine Klimapolitik mit Augenmass
L'UDC demande le retour à la raison en politique climatique
| TA |
Tages-Anzeiger
▶Tages-Anzeiger (Presse) ▶TA: Who is who (Medien der Globalen Erwärmung) |
de Panik-Küche en Panic laboratory fr Marmite alarmiste
-
2018-08-14 de
 Harald Lesch bei Markus Lanz, 14.08.2018
Harald Lesch bei Markus Lanz, 14.08.2018
-
EIKE Europäisches Institut für Klima und Energie
Stefan Kämpfe
2018-08-17 de Die Irrungen und Halbwahrheiten des ZDF-Fernsehprofessors Harald Lesch - eine Richtigstellung aus meteorologischer SichtDas am 14.08.2018 gesendete Interview von Herrn Lesch enthielt aus meteorologischer Sicht zahlreiche Irrungen und Halbwahrheiten, welche einer Klarstellung bedürfen.
Es wird nur auf die schlimmsten Fehler eingegangen; die Aussagen des Herrn Lesch sind sinngemäß wiedergegeben.
"Noch nie gab es im Sommer Brände diesen Ausmaßes in Deutschland, wie im Sommer 2018".
Das ist falsch- Ältere erinnern sich vielleicht an die verheerenden Brände in der Lüneburger Heide im Dürre-Sommer 1975.
Es brannten etwa 8.000 Hektar Wald. Näheres dazu hier bei Wikipedia.
Und sommerliche Dürren gab es schon immer.
Ältere erinnern sich sicher noch an 1911, 1947, 1959, 1975, 1976 und 1982.
Im Sommer 1969 blieb der Regen in Südschweden zwei Monate gänzlich aus.
Starkregen
"Das Wort Starkregen gibt es im Deutschen noch nicht lange.
90-jährige können sich an so was gar nicht erinnern."Da hätte ein Blick in ältere Aufzeichnungen gewiss geholfen - schwerste Sommer-Überschwemmungen in Deutschland gab es beispielsweise im Juli 1954.
Und auch lokale Ereignisse durch Unwetter traten leider immer wieder auf, so in Bruchstedt/Thüringen 1950, Näheres dazu hier.
Auch in früheren Jahrhunderten traten sie auf, und zwar viel schlimmer als die 2018er Ereignisse, man denke nur an die "Thüringer Sintflut" von Ende Mai 1613 hier und die vermutlich schwerste Naturkatastrophe Deutschlands, das Sommerhochwasser von 1342 hier.
"Wenn die Winter immer trockenen werden... dann bleibt das Grundwasser zu niedrig... ."
Der Langfristtrend der DWD-Niederschlagswerte (Flächenmittel Deutschland) zeigt eindeutig das Gegenteil - unsere Winter werden feuchter:
"Je wärmer die Arktis wird, desto instabiler wird der Jetstream... .
Dadurch kommt es unter anderem zu heißeren, extremeren Sommern."Das ist eine der ganz wenigen Aussagen des Herrn Lesch mit einem gewissen Wahrheitsgehalt.
Allerdings fehlen auch hierfür eindeutige Beweise, denn der Jetstream wird auch sehr stark von anderen Faktoren, wie etwa der Sonnenaktivität oder Vulkanausbrüchen, beeinflusst.
Die Datenlage hierfür ist dünn; der Zonalwind über Deutschland in der Mittleren Troposphäre (500hPa), welcher zumindest ein grobes Maß für die Stärke der Westwind-Zirkulation über Deutschland ist, wehte seit Aufzeichnungsbeginn (1948) sogar stärker;
eigentlich müsste er bei schwindendem Arktiseis schwächer werden:
Auf der Nordhalbkugel ist es zurzeit ungewöhnlich heiß... ."
Es ist, gemessen am Langjährigen Mittel, im Juli auf der Nordhalbkugel um etwa 0,4 bis 0,5 Kelvin (entspricht 0,4 bis 0,5°C) zu warm gewesen
dramatisch ist das nicht, wie ein Vergleich mit dem Juli 1994 zeigt.
(Bildquellen: IRI International Research Institute, siehe Artikel)
Und dass es im März 2018 in großen Regionen der Nordhalbkugel markant zu kalt war, erwähnt Herr Lesch lieber nicht;
auch hierzu die Karte im Artikel (Die Anomalien beziehen sich bei allen 3 Abbildungen auf die Mittelwerte der Normalperiode 1971 bis 2000):
"Die Nutzung der Windenergie ist noch lange nicht ausgeschöpft... ."
Das könnte falsch sein.
Untersuchungen zeigen, dass der Wind in Deutschland bereits schwächer wird;
hier eine Untersuchung mit DWD-Beaufort-Werten aus Norddeutschland:
Zum Abschluss ein Wort zu den Äußerungen über den Hurrikan OPHELIA.
Dass Hurrikane statt zur Karibik Richtung Europa ziehen; kommt immer mal wieder gelegentlich vor; wer alte Wetterkarten sichtet, wird fündig.
Eine "Hitzewelle", wie in dem Interview behauptet, löste OHELIA zumindest in Deutschland nicht aus - denn es war schon Oktober.
(Über den Lebenszyklus des Hurrikans OPHELIA gibt es hier beim EIKE eine gute Dokumentation).
Und dass es da noch mal so um 25 Grad warm wurde, hatte mit der großräumigen Zirkulation zu tun - übrigens kann es immer mal bei uns im Oktober nochmals sommerlich warm werden -
wer sucht, wird beispielsweise 2001, 1995 und 1985 fündig.
Und gibt es immer mehr schwere Wirbelstürme?
Die letzte Grafik zeigt keine Zunahme:
Übrigens - nach der intensiven 2017er Hurrikan-Saison wird eine sehr schwache 2018er Saison erwartet -
Grund sind unter anderem negative Wassertemperaturen im tropischen Nordatlantik.
Wieder einmal zeigt sich: ZDF bedeutet "Zwangsgebührenfinanzierte, desinformierende Falschmelder"
armes Deutschland, wenn Du dafür auch noch Gebühren zahlen musst.
| ZDF |
Zweites Deutsches Fernsehen
▶ZDF: Who is who (Medien der Globalen Erwärmung) |
▶
![]() Harald Lesch: Übrigens zur Klimakatastrophe
Harald Lesch: Übrigens zur Klimakatastrophe
| Harald Lesch |
Astrophysiker, Naturphilosoph, Wissenschaftsjournalist, Fernsehmoderator, Professor für Physik an der LMU München Lehrbeauftragter für Naturphilosophie an der Hochschule für Philosophie München. ▶Harald Lesch: Who is who (Aktivist der anthropogenen Globalen Erwärmung) ▶Harald Lesch: Wikipedia (Profiteure) |
de Fakten en Facts fr Faits
-
EIKE Europäisches Institut für Klima und Energie
Stefan Kämpfe
2018-08-01 de Juli 2018 in Deutschland - kein neuer RekordmonatAuch wenn dieser Juli 2018 vielen rekordverdächtig vorkam - er schaffte es nicht, den bisherigen Rekordhalter von 2006 auch nur annähernd zu gefährden.
Der Titel des "Vizemeisters" bleibt weiterhin dem 1994er Juli erhalten; Platz 3 belegt der Juli 1983.
Dieser Juli war speziell im letzten Monatsdrittel von Hitzewellen geprägt, weil es Ableger des Azorenhochs immer wieder schafften, sich nach Mittel- und Nordeuropa auszubreiten;
zeitweise entwickelten sich daraus kräftige Skandinavien-Hochs.
Dieser Umstand erklärt auch, warum es in diesem Monat, trotz meist positiver NAO- Werte, kaum feucht-kühles "Westwetter" gab.

 Enge "Verzahnung" von Sonnenscheindauer und Temperatur.
Enge "Verzahnung" von Sonnenscheindauer und Temperatur.
Sonnige Juli- Monate sind stets warm;
die Sonnenscheindauer vermag mehr als 70% der Temperaturvariabilität seit 1951 zu erklären;
in keinem anderen Monat besteht ein derart enger Zusammenhang.
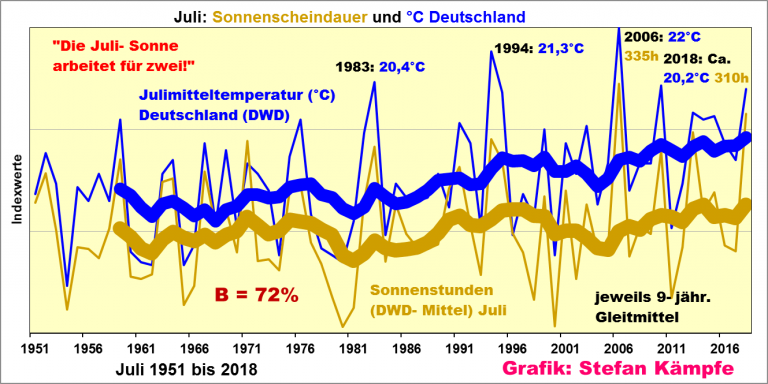
Zusammenfassung
Der 2018er Juli war dank einer hohen Sonnenscheindauer und vieler Hochdruckwetterlagen sehr warm, ohne es unter die drei wärmsten Juli-Monate in Deutschland seit Aufzeichnungsbeginn zu schaffen.
Auch langfristig lässt sich nahezu die gesamte Juli- Erwärmung in Deutschland mit geänderten Großwetterlagenhäufigkeiten und einer längeren Sonnenscheindauer erklären; hinzu kommen wachsende Wärmeinseleffekte, auf welche hier nicht näher eingegangen wird.
| EIKE |
Europäisches Institut für Klima und Energie European Institute for Climate and Energy ▶EIKE: Who is who (Skeptische Institute & Organisationen) ▶EIKE: Wikipedia (Opfer) ▶EIKE: Webseiten (Deutsch) |
-
Die kalte Sonne (Fritz Vahrenholt & Sebastian Lüning)
2018-08-11 de Deutschland hat kein Hitzeproblem - sondern ein HysterieproblemDie Hitzewelle ist in den meisten Teilen Deutschlands jetzt erstmal abgehakt.
Es war ein wahres Fest für alle Aktivisten.
Bei allem Warnen, Drohen und Qungeln vergaßen sie doch glatt, dass Klima das durchschnittliche Wetter von 30 Jahren ist.
Das war nun plötzlich ganz egal.
Es war heiß, da wollte man sich mit diesem dummen Ballast nicht mehr abgeben:
Die Hitze sei ein Vorbote der Hölle, in die alle Klimaalarm-Ungläubigen schnellstmöglich gelangen, wenn sie nicht die Forderungen der Klima-Gottheiten umgehend erfüllen.
Sonst drohe der Weltuntergang.
Zum Glück gab es in der Berichterstattung auch wenige Ausnahmen.
Zum eine wäre da Jörg Kachelmann am 3. August 2018 bei den t-online-Nachrichten:
Kachelmanns Donnerwetter: Kein Sommermärchen
Deutschland hat Angst vorm Klimawandel - und vor Ventilatoren.
Während im Winter die nächste Klimakatastrophe droht, tut die Regierung nichts.
Weil sie die vielen "Dummen" nicht verprellen will.
Manchmal bestimmt Mesut Özil nicht nur die Medienagenda für ein paar Tage, sondern für einen Sommer.
Natürlich nicht er alleine, sondern "Die Mannschaft".
Man kann das wunderbar vergleichen mit 2006.
Damals war der Juli noch mal zwei Grad wärmer als der Juli 2018, also noch mal 50 Prozent weiter über dem Durchschnitt,
aber das, was de facto viel schlimmer war als heute, war damals keine böse Hitzewelle, die alles kaputtmachte, sondern ein WM-Sommertraum oder meist das legendäre "Sommermärchen".
Der zweite Lichtblick zum Thema stammt von Torsten Krauel, der am 8. August 2018 in der Welt schrieb:
Deutschland hat kein Hitzeproblem - sondern ein Hysterieproblem
Sahara-Sommer?
Esst vegan, oder es kommt der Weltuntergang?
Von wegen.
Heiße Sommer hat es viele gegeben, regnerisch-kühle genauso. Deutschland hat kein Hitzeproblem, das zeigt ein Blick in die Vergangenheit.Deutscher Saharasommer 2018!
Glühende Landschaften!
Wer so etwa schreibt, war nie in der Sahara.36 Grad bei nur 55 oder 60 Prozent Luftfeuchtigkeit?
Das wäre in etlichen Weltregionen ein angenehm trockener Erholungstag.Um die 40 Grad bei 95 Prozent Luftfeuchte sind in weiten Teilen Chinas die Regel.
 Weiterlesen in der Welt: Deutschland hat kein Hitzeproblem -
sondern ein Hysterieproblem
Weiterlesen in der Welt: Deutschland hat kein Hitzeproblem -
sondern ein Hysterieproblem
Danke Herr Kachelmann, Danke Herr Krauel.
Sie sprechen das aus, was viele nur insgeheim denken.
Es ist wichtig, dass man in dieser politisierten Materie mitdenkt und sein Meinung kundtut, ansonsten glaubt die Alarmfraktion, die Nation prächtig geleimt zu haben.
| Die kalte Sonne | Die kalte Sonne (Fritz Vahrenholt & Sebastian Lüning) |
Positionspapier der SVP 2009:
Für eine Klimapolitik mit Augenmass
fr
Document de fond de l'UDC Suisse 2009:
Retour au bon sens en politique climatique
-
de
 Für eine Klimapolitik mit Augenmass
Für eine Klimapolitik mit Augenmass
Aus der Zusammenfassung:
Seit jeher ist das Klima auf der Erde Veränderungen unterworfen.
Heute gemessene Entwicklungen stellen daher keine neue Erscheinung dar.Im Verlauf des 20. Jahrhunderts sind die weltweiten Durchschnittstemperaturen um ungefähr 0.6 °C angestiegen.
Seit dem Jahr 1998 hat es weltweit keine Erwärmung mehr gegeben, seit 2005 kühlte es gar ab. In der Arktis, wo heutzutage das Schmelzen gewisser Eisgebiete mit grossem Medienspektakel verfolgt wird, hat bereits zwischen 1925 und 1945 eine ähnlich warme Periode wie heute geherrscht.
Auch in der Schweiz wurde das bisher wärmste Jahr 1994 seit nunmehr über einem Jahrzehnt nicht mehr übertroffen.
Man kann somit keinesfalls von einem kontinuierlichen, starken Anstieg der Temperaturen sprechen.
Die SVP fordert:
-
Das Kyoto-Protokoll regelt die weltweiten Bemühungen zur Senkung des CO2- Ausstosses bis zum Jahr 2010.
Nimmt man die volle Periode hinzu, welche für das Erreichen des Ziels massgebend ist, entfaltet das Kyoto-Protokoll bis spätestens 2012 Wirkung.
Das CO2-Gesetz dient der nationalen Umsetzung des Kyoto-Protokolls.
Es macht keinen Sinn, dass die Schweiz ohne internationale Abstützung dieses Gesetz weiterhin behält.
Wie oben dargelegt, ist die Schweiz nur für 0.1 % der weltweiten menschengemachten CO2-Emissionen verantwortlich und allein der jährliche Anstieg der chinesischen Emissionen übersteigt die schweizerischen Emissionen um ein Vielfaches.
In dieser Situation ist es absolut widersinnig, ohne internationale Abstützung weitere Reduktionsbemühungen zu unternehmen.
Das CO2-Gesetz ist deshalb per Ende 2010, spätestens per Ende 2012 aufzuheben.
Entsprechend ist auf die Erhebung der CO2-Abgabe nach 2010 bzw. 2012 zu verzichten.
-
Entsprechend der baldigen Beendigung der Fristen des Kyoto-Prozesses darf keine Teilzweckbindung eingeführt werden. Dies würde neue Abhängigkeiten schaffen und die bei einer Subventionierung üblichen Marktverzerrungen hervorrufen.
Gerade in der aktuellen Situation einer sich anbahnenden Wirtschaftskrise wäre es genau das Falsche, den Steuerzahlern noch mehr Geld aus der Tasche zu ziehen und die Kaufkraft von Privathaushalten und Unternehmungen zu schwächen.
Die SVP fordert, dass das Versprechen von Bundesrat und Parlament, die Erträge der CO2-Abgabe den Steuerzahlern zurückzuerstatten, auch wirklich eingehalten wird.
-
Das Versprechen, die CO2-Abgabe staatsquotenneutral zu realisieren, wurde bereits durch die Unterstellung dieser Abgabe unter die Mehrwertsteuerpflicht gebrochen.
Die CO2-Abgabe ist umgehend von der Mehrwertsteuer zu befreien.
Die jährlich 18 Millionen Franken, welche den Steuerzahlern damit aus der Tasche gezogen werden, sind zurückzuerstatten.
-
SVP - Schweizerische Volkspartei
Pressekonferenz vom 24. Februar 2009
Ideologie und Angstmacherei prägt nach wie vor die Klimadiskussion.
Wie damals beim Waldsterben überbieten sich Politiker von Links bis Rechts mit oftmals realitätsfremden Forderungen zu staatlichen Umverteilungs- und Fördermassnahmen.
Die SVP fordert eine Rückkehr zur Vernunft.
Ein neues internationales Klima-Abkommen darf es nur geben, wenn alle Länder mit grossem CO2-Ausstoss an Bord sind.
Die SVP erhebt folgende klimapolitischen Forderungen:
-
Aufhebung des CO2-Gesetzes zum Zeitpunkt der Beendigung der vom Kyoto-Protokoll geregelten Periode (2010, spätestens 2012).
-
Bis dahin Beibehaltung der vollständigen Rückgabe der CO2-Abgabe an die Steuerzahler und Verzicht auf die Einführung einer Teilzweckbindung.
-
Keine Beteiligung der Schweiz an einem Nachfolge-Protokoll, wenn sich nicht sämtliche Grossemittenten zu Begrenzungen verpflichten.
-
Keine nationale Regelung, welche weitergeht als die internationalen Verpflichtungen.
SVP - Schweizerische Volkspartei
Videos vom 25. Februar 2009
-
2009-02-25 de
 SVP fordert Klimapolitik mit Augenmass
SVP fordert Klimapolitik mit Augenmass
-
2009-02-25 fr
 L'UDC demande le retour à la raison en politique climatique
L'UDC demande le retour à la raison en politique climatique
Ideologie und Angstmacherei prägt nach wie vor die Klimadiskussion.
Wie damals beim Waldsterben überbieten sich Politiker von Links bis Rechts mit oftmals realitätsfremden Forderungen zu staatlichen Umverteilungs- und Fördermassnahmen.
Die SVP fordert eine Rückkehr zur Vernunft.
Ein neues internationales Klima-Abkommen darf es nur geben, wenn alle Länder mit grossem CO2-Ausstoss an Bord sind.
▶
SVP Schweiz: Für eine Klimapolitik mit Augenmass
L'UDC demande le retour à la raison en politique climatique
| SVP / UDC |
SVP - Schweizerische Volkspartei SVP - Swiss People's Party UDC - Union démocratique du centre |
NZZ: Trinkwasser ist im Kanton Zürich
Trotz Trockenheit wäre es gar nicht nötig, Wasser zu sparen
-
NZZ Neue Zürcher Zeitung / Jan Hudec
2018-08-07 de Trotz Trockenheit wäre es gar nicht nötig, Wasser zu sparenTrinkwasser ist im Kanton Zürich trotz Trockenheit in Hülle und Fülle vorhanden - man muss es nur richtig verteilen.
Dafür sorgt der kantonale Trinkwasserverbund.
Doch noch sind nicht alle Gemeinden an das Netz angeschlossen.
100 Schwimmbecken pro Tag
Rund 380 Millionen Liter Trinkwasser, also der Inhalt von 100 Olympia-Schwimmbecken, werden im Kanton Zürich täglich verbraucht -
pro Person entspricht dies über 250 Litern.
An Spitzentagen kann der Verbrauch aber bis auf über 600 Millionen Liter ansteigen.
Das System ist damit bei weitem nicht ausgereizt.
Mit den 700 Reservoirs im Kanton können pro Tag 800 Millionen Liter bereitgestellt werden.
Es handelt sich also eher um ein Verteil- als ein Mengenproblem, denn nicht alle Regionen sind gleichermassen mit grossen Wasservorkommen gesegnet.
| de | en | fr |
|---|---|---|
| Wasser, Land, Nahrung Wasser |
Water, Land, Food Water |
Eau, terre, nourrit Eau |
| Wassermangel | ||
-
Zürichsee-Zeitung / Martin Steinegger
2015-05-08 de Der Tag, an dem es einen ganzen Zürichsee regneteWie viel Wasser kann es in der Schweiz an einem Tag regnen?
Meteoschweiz gibt in einem aktuellen Blogbeitrag dazu die Antwort:
Einmal den ganzen Zürichsee.Der regenreichste Tag seit 1961 war der 7. August 1978.
An diesem Tag fielen gemäss der Berechnung von Meteoschweiz 3,6 km3 (Kubikkilometer) Wasser.
Das entspricht 3,6 Milliarden Kubikmeter. Oder anders umgerechnet:
es entspricht ziemlich genau dem Wasservolumen des Zürichsees, der etwa 3,9 Kubikkilometer fasst.Güterzug, 16-Mal um die Erde gewickelt
In der Schweiz kann es also an einem Tag einen ganzen Zürichsee regnen. Meteoschweiz bietet dazu eine anschauliche Umrechnung:
Würde man diese Wassermenge auf Kesselwagen der SBB verteilen, die 85000 Liter fassen und gut 15 Meter lang sind, benötigte man rund 42 Millionen Wagen.Aneinandergereiht würden diese einen 640000 Kilometer langen Zug bilden.
Diesen könnte man 16-Mal um die Erde «wickeln».
Auf Rang zwei der niederschlagsreichsten Tage folgen übrigens der 21. Dezember 1991 und der 8. August 2007.
An diesen beiden Tagen fielen aber gemäss Meteoschweiz deutlich geringere Wassermengen.
Oder anders ausgedrückte: es regnete keinen ganzen Zürichsee - sondern eher einen Walensee.
| de | en | fr |
|---|---|---|
|
Wetterphänomene Wassermenge |
Weather phenomena Water amount |
Phénomènes météorologiques Débit d'eau |
Prof. Dr. Werner Kirstein sagt Claus Kleber die Meinung
-
Prof. Dr. Werner Kirstein
2018-08-06 de Klimatologe sagt Claus Kleber die Meinung
Klimatologe sagt Claus Kleber die Meinung
Der Klimatologe und Physiker Prof. Dr. Werner Kirstein richtete am 04.08.2018 eine Mail an Claus Kleber vom 'heute-journal' im Zweiten, bzgl. des Beitrages
"Trockener Sommer: Woher kommt die Hitze?"
in der heute-journal-Sendung vom 03.08.2018.
Hier nach besagtem Beitrag aus der Sendung, verlesen.
Sehr aufschlussreich.
Quelle/Source:
-
EIKE Europäisches Institut für Klima und Energie
2018-08-07 de Dr. Claus Kleber (ZDF heute Journal 3.8.18): ".. sich die Atmophäre 'grundstürzend' ändert!"Am 3.8.18 brachte das ZDF im heute Journal angekündigt von seinem Moderator, dem bekannten Klimakatastrophenprediger und Sachbuchautor in nämlicher Sache, Dr. Claus Kleber einen Beitrag zur Hitzeperiode dieses Sommers.
Der Physiker und Klimatologe Prof. Dr. Werner Kirstein fühlte sich bemüßigt, diese permanent wiederholte Klimaktastrophenmeldung, diesmal
sogar als mögliche "grundstürzenden" Änderung der Atmosphäre angekündigt
zu widerlegen mehr Objektivität und Sachlichkeit anzumahnen. Wohl wissend, dass diese beiden Begriffe für das ZDF und Claus Kleber lästige Fremdworte sind.
Schauen und lesen Sie selbst
▶
![]() Prof. Dr. Werner Kirstein: Erdklima vs. Klimapolitik
Prof. Dr. Werner Kirstein: Erdklima vs. Klimapolitik
| Werner Kirstein |
Prof. Dr.
▶Werner Kirstein: Who is who (Skeptiker) ▶Werner Kirstein: Video (Präsentationen) ▶Ausschluss und Maulkorb für Kritiker (Uni Leipzig (Dekan Prof. Dr. Haase) ⬌ Prof. Dr. W. Kirstein) |
| ZDF |
Zweites Deutsches Fernsehen
▶ZDF: Who is who (Medien der Globalen Erwärmung) |
de
Die jahrelange beispiellose Hitze- und Dürreperiode in Europa um 1540
en
The year-long unprecedented European heat and drought of 1540
-
EIKE Europäisches Institut für Klima und Energie
Oliver Wetter, Christian Pfister, Johannes P. Werner, Eduardo Zorita und weitere
2018-08-04 de Die jahrelange beispiellose Hitze- und Dürreperiode in Europa um 1540 - ein Worst CaseAbstract
Die Hitzewellen der Jahre 2003 in Westeuropa und 2010 in Russland, welche allgemein als seltene klimatische Anomalien außerhalb bisheriger Erfahrungen apostrophiert werden, werden oftmals als Warnungen vor noch häufigeren Extremen in einer von der globalen Erwärmung beeinflussten Zukunft herangezogen.
Eine neue Rekonstruktion der Temperaturen in Westeuropa im Frühjahr und Sommer zeigt jedoch, dass es im Jahre 1540 signifikant höhere Temperaturen gegeben haben muss.
Um die Plausibilität dieses Ergebnisses zu überprüfen, untersuchten wir die Schwere der Dürre 1540, indem wir das Argument der bekannten Rückkopplung zwischen Austrocknung des Bodens und Temperatur untersuchten.
Quelle/Source:
-
Springer Nature
Oliver Wetter, Christian Pfister, Johannes P. Werner, Eduardo Zorita and others
2018-06-28 en The year-long unprecedented European heat and drought of 1540 - a worst caseAbstract
The heat waves of 2003 in Western Europe and 2010 in Russia, commonly labelled as rare climatic anomalies outside of previous experience, are often taken as harbingers of more frequent extremes in the global warming-influenced future.
However, a recent reconstruction of spring-summer temperatures for WE resulted in the likelihood of significantly higher temperatures in 1540.
In order to check the plausibility of this result we investigated the severity of the 1540 drought by putting forward the argument of the known soil desiccation-temperature feedback.
Based on more than 300 first-hand documentary weather report sources originating from an area of 2 to 3 million km2, we show that Europe was affected by an unprecedented 11-month-long Megadrought.
The estimated number of precipitation days and precipitation amount for Central and Western Europe in 1540 is significantly lower than the 100-year minima of the instrumental measurement period for spring, summer and autumn.
This result is supported by independent documentary evidence about extremely low river flows and Europe-wide wild-, forest- and settlement fires.
We found that an event of this severity cannot be simulated by state-of-the-art climate models.
Wie ungewöhnlich ist die aktuelle Trockenperiode?
-
EIKE Europäisches Institut für Klima und Energie
Prof. Dr. Horst-Joachim Lüdecke
2018-08-08 de Wie ungewöhnlich ist die aktuelle Trockenperiode?Kaum spielt das Wetter wieder einmal Kapriolen, kreisen auch schon die Krähen des Untergangs über unseren Häuptern und fordern CO2-Buße.
Ein nüchterner Blick auf die Daten beweist dagegen nur Eines:
"Das Gewöhnliche am Wetter ist seine Ungewöhnlichkeit".

 Summe der Niederschlagsmengen von Mai+Juni+Juli für Deutschland
und Mittelengland
Summe der Niederschlagsmengen von Mai+Juni+Juli für Deutschland
und Mittelengland
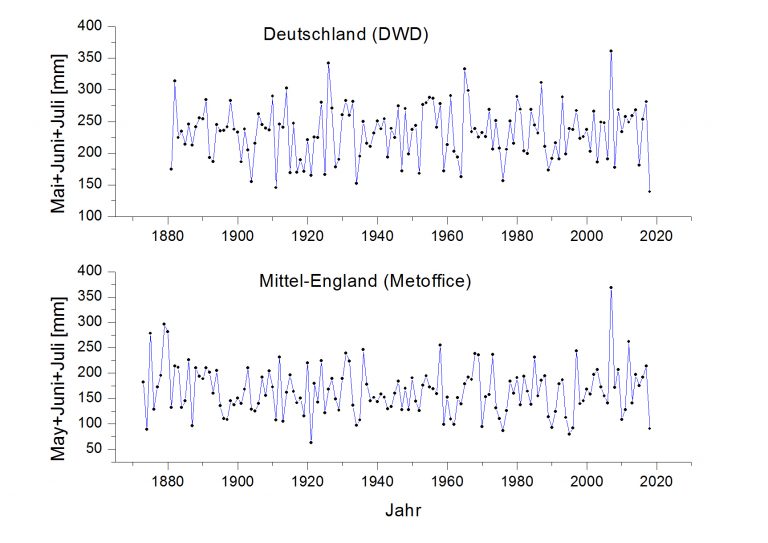
Was ist zu sehen?
Jedenfalls kein säkularer Trend, wie er seitens des IPCC durch den angestiegenen CO2-Gehalt in der Luft vermutet wird.
Wir sehen Wetterereignisse (zur Erinnerung: Klima ist definiert als der statistischen Mittelwert von Wetter über mindestens 30 Jahre).
Der Summenregenwert Mai+Juni+Juli von Deutschland in 2018 ist tatsächlich ein Wetterrekord, wenn auch nur knapp. Seine 139,4 mm Regensumme in 2018 unterbieten die 145,7 mm in 1911 nur geringfügig.
| de | en | fr |
|---|---|---|
|
Wetterphänomene Dürreperioden |
Weather phenomena Periods of Droughts |
Phénomènes météorologiques Periodes de sécheresses |
Es gibt keine "globale Hitzewellen"
-
EIKE Europäisches Institut für Klima und Energie
Michael Bastasch / Andreas Demmig
2018-08-04 de Es gibt keine "globale Hitzewellen""Globale Hitzewelle" ist ein nur Schlagwort, das in Überschriften verwendet wird
Was tatsächlich zutrifft, sind Hitzewellen, die gleichzeitig in verschiedenen Teilen der Welt auftreten.
"Globale Hitzewellen ist also weder ein wissenschaftlicher Begriff noch eine gute Beschreibung dessen, was passiert", sagt Cliff Mass, ein Klimawissenschaftler an der Universität von Washington.
In letzter Zeit Sie sind wahrscheinlich auf Schlagzeilen über die "globale Hitzewelle" gestoßen, die verheerende Schäden von Japan über Europa bis nach Nordafrika anrichtet.
Falls Sie den Begriff "globale Hitzewelle" zum ersten Mal hören, sind Sie damit nicht allein.
Das liegt daran, dass es sich um einen Begriff handelt, der in hanebüchenden Schlagzeilen verwendet wird, um die Aufmerksamkeit zu steigern.
"'Global Heat Wave' scheint ein neuer Begriff zu sein, den einige Leute in den Medien- und Klima-Lobbygruppen erfunden haben", sagte Cliff Mass, ein Klimawissenschaftler an der Universität von Washington, dem Daily Caller.
Der Juli scheint über einen Großteil der nördlichen Hemisphäre hinweg glühende Hitze zu haben, einschließlich Rekordhochs in Kalifornien und Kanada.
Dreistellige Wärmegrade (in Fahrenheit 100 F = 38°C) wurden mit Todesfällen in Japan in Verbindung gebracht und brutzelnde Temperaturen trugen zu massiven Waldbränden in Skandinavien bei - Es ist mal wieder richtig Sommer.
Aber der Begriff "globale Hitzewelle" weckt Bilder von Hitzeglocken, die den gesamten Planeten kochen.
Was gemeint ist, sind Hitzewellen, die gleichzeitig in verschiedenen Teilen der Welt auftreten.
"Hitzewellen sind zwangsläufig lokalisierte Angelegenheiten, die normalerweise mit anomal hohem Luftdruck verbunden sind", sagte Mass in einer E-Mail.
"Globale Hitzewellen sind also weder ein wissenschaftlicher Begriff noch eine gute Beschreibung dessen, was passiert ist."
Auch der Klimawissenschaftler des Cato-Instituts, Ryan Maue, kritisierte Schlagzeilen, in denen von einer "globalen Hitzewelle" die Rede ist und von Wissenschaftlern, die ihre Namen für solche haarstäubenden Behauptungen zur Verfügung stellen.
Abgesehen davon, dass es Winter in der südlichen Hemisphäre ist, bemerkte Maue,
dass die Temperatur der nördlichen Hemisphäre derzeit dem Durchschnitt der letzten 18 Jahre entspricht.
Er stellte außerdem fest,
dass die Landtemperaturen der nördlichen Hemisphäre derzeit insgesamt unter dem Normalwert lagen.
| de | en | fr |
|---|---|---|
|
Wetterphänomene Hitzewellen |
Weather phenomena Heat Waves |
Phénomènes météorologiques Canicules |
Schellnhuber-Evergreen: Und ewig kippt das Klima
-
EIKE Europäisches Institut für Klima und Energie
Dirk Maxeiner
2018-08-09 de Schellnhuber-Evergreen: Und ewig kippt das KlimaSeit vielen Jahren erfindet das PIK bis vor kurzem von Hans-Joachim Schellnhuber geleitet, neue Klima-Bedrohungen, in der nicht falschen Hoffnung dass die Medien diese verstärkend aufgreifen und so die hoch lukrative Klimafurcht-Politik weiter am Leben zu halten.
Dazu gehört auch seit einigen Jahren die durch nichts gestützte Hypothese, dass das "Weltklima" durch die menschlichen CO2 Emissionen zum "kippen" gebracht werden könne.
Natürlich ins dann unvermeidbare Elend. Weltuntergang à la Schellnhuber.
Bisher war dieser apokalyptischen Weissagung nicht viel mediale Aufmerksamkeit beschieden.
Das müsse sich nun ändern befand das rührige Meidienteam.
Motto: Lasse keine (und sei sie noch so dürftig) Krise ungenutzt.
Also flugs alten Wein in neue Schläuche gegossen und an die derzeitige Hitzewelle angehängt.
Die Journos werden schon den Rest erledigen.
Dirk Maxeiner berichtet die ganze Story
-
Süddeutsche Zeitung
2018-08-06 de Studie: Klimasystem könnte in Heißzeit kippende Panik-Küche en Panic laboratory fr Marmite alarmiste
Die Gefahr einer Heißzeit kann aus Sicht von Klimaforschern selbst beim Einhalten des Pariser-Klimaabkommens nicht ausgeschlossen werden.
Dabei würde sich die Erde langfristig um etwa vier bis fünf Grad Celsius erwärmen und der Meeresspiegel um 10 bis 60 Meter ansteigen.
Das schreibt das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK).
Ein internationales Team von Wissenschaftlern diskutiert diese Möglichkeiten in den "Proceedings" der US-nationalen Akademie der Wissenschaften ("PNAS") und blickt dabei insbesondere auf Kippelemente im Klimasystem.
Dazu gehören laut Studie etwa die auftauenden Permafrostböden in Russland, die sich erwärmenden Methanhydrate auf dem Meeresboden und die großen Ökosysteme wie der Amazonas-Regenwald.
Sie könnten sich wie eine Reihe von Dominosteinen verhalten, sagte Mitautor Johan Rockström, Direktor des Stockholm Resilience Centre und designierter Ko-Direktor des PIK.
"Wird einer von ihnen gekippt, schiebt dieses Element die Erde auf einen weiteren Kipppunkt zu."
"Der Mensch hat als geologische Kraft bereits seine Spuren im Erdsystem hinterlassen", sagte Mitautor und PIK-Gründungsdirektor Hans Joachim Schellnhuber.
"Werden dadurch empfindliche Elemente des Erdsystems gekippt, könnte sich die Erwärmung durch Rückkoppelungseffekte selbst weiter verstärken.
Das Ergebnis wäre eine Welt, die anders ist, als alles, was wir kennen", ergänzte er.
"Die Forschung muss sich daran machen, dieses Risiko schnellstmöglich besser abzuschätzen."
Nach Angaben der Autoren könnte es schwieriger werden als bislang angenommen, die globale Erwärmung wie im Pariser Klimaabkommen vereinbart zwischen 1,5 und unter 2 Grad Celsius zu stoppen.
Man könne sich nicht darauf verlassen, dass das Erdsystem bei 2 Grad langfristig sicher "geparkt" werden könne, sagte Schellnhuber.
Derzeit ist die Erde im Durchschnitt bereits gut 1 Grad wärmer als noch vor Beginn der Industrialisierung.
Selbst bei vorläufiger Begrenzung der menschengemachten Erderwärmung auf maximal 2 Grad könnten kritische Prozesse im Klimasystem angestoßen werden, die eine noch stärkere Erwärmung - auch ohne weiteres menschliches Zutun - bewirken, erläuterte Erstautor Will Steffen von der Australian National University (ANU) und dem Stockholm Resilience Centre (SRC).
Nach PIK-Angaben könnte das bedeuten, dass sich der Klimawandel dann selbst verstärkt - "auf lange Sicht, über Jahrhunderte und vielleicht Jahrtausende".
Kippelemente im Erdsystem seien mit schweren Felsbrocken am Strand vergleichbar, erläuterte Schellnhuber.
Würden diese langsam, aber unaufhörlich unterspült, könnte irgendwann schon die Landung einer Fliege an einer neuralgischen Stelle ausreichen, um die Brocken kippen zu lassen.
"Wir weisen in unserem Artikel darauf hin, dass es im planetarischen System bereits derart unterspülte Felsbrocken gibt, die wir als Kippelemente bezeichnen.
Ist die Erderwärmung weit genug fortgeschritten, reicht vielleicht schon eine kleine Veränderung aus, um diese Elemente in einen ganz anderen Zustand zu stoßen."
In Teilen der Westantarktis seien bereits einige Kipppunkte überschritten worden. "Der Verlust des Eises in einigen Regionen könnte dort schon ein weiteres, noch umfangreicheres Abschmelzen über lange Zeiträume vorprogrammiert haben", sagte Schellnhuber.
Und der Kollaps des grönländischen Eisschildes könnte bereits bei einer Temperaturerhöhung um 2 Grad einsetzen.
"Die roten Linien für einige der Kippelemente liegen wohl genau im Pariser Korridor zwischen 1,5 und 2 Grad Erwärmung."
| de | en | fr |
|---|---|---|
|
Klima: Fragen Klima-Kipp-Punkte |
Climate: Questions Climate Tipping Points |
Climat: Questions Points de non retour dans le climat |
|
Hans-Joachim Schellnhuber *1950-06-07 |
Professor, Bis September 2018 war er Direktor des 1992 von ihm gegründeten Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung (PIK) ▶Hans-Joachim Schellnhuber: Who is who (Aktivisten der anthropogenen Erwärmung) |
| SZ |
Süddeutsche Zeitung
▶SZ: Who is who (Medien der Globalen Erwärmung) |
de
'Heiß-Haus Erde': Extrem fragwürdig
en
Hothouse Earth: It's extremely dodgy
-
EIKE Europäisches Institut für Klima und Energie
Dr. David Whitehouse, GWPF Science Editor / Chris Frey
2018-08-09 de 'Heiß-Haus Erde': Extrem fragwürdigKeine neue Wissenschaft, kein neues Szenario und folglich kein neuer Grund für Panik.
Es war eine lange Hitzewelle in weiten Teilen Europas, die Fragen ausgelöst hat wie "welche Rolle spielt der Klimawandel bei der diesjährigen Hitzewelle"?
Einige behaupten, dass es zweimal so oft dazu kommt, andere behaupten, dass der Klimawandel alles immer schlimmer macht.
"So sieht Klimawandel aus!", sagt Prof. Michael Mann.
Es wird das Gefühl verbreitet, dass dieser Sommer zeigt, wie es in Zukunft aussehen könnte.
"Man erwarte so etwas immer öfter!", lautet der Aufschrei.
-
The Global Warming Policy Forum (GWPF)
Dr. David Whitehouse, GWPF Science Editor
2018-08-07de Hothouse Earth: It's extremely dodgyNo new science, no new data, no new scenario and consequently no new cause for panic.
It's been a long heatwave in much of Europe which has prompted questions like 'what is the influence of climate change on this year's heatwave?'
Some claim that it's twice as likely to occur, while others claim that climate change is making it worse.
"This is the face of climate change," says Professor Michael Mann.
There is a feeling in the hot air that this summer is showing the way of the future.
'Expect this kind of thing more often', is the cry.
| de | en | fr |
|---|---|---|
| Klimawandel: Diskussionen | Climate change: Discussions | Changement climatique: Discussions |
| Hiobs-Prognosen | ||
Woher kommt die Dürre und Wärme des Sommers 2018?
-
EIKE Europäisches Institut für Klima und Energie
Hartmut Hüne
2018-08-09 de Woher kommt die Dürre und Wärme des Sommers 2018?
 Die Sonne ist mehr als die sichtbare Strahlung
Die Sonne ist mehr als die sichtbare Strahlung

Die aktuelle extreme Hitze und länger dauernde Trockenheit, die wir derzeit erleben, lässt sich gut mit ungewöhnlichen Koronaentladungen auf der Sonne erklären, meint unser Autor Hartmut Hüne und liefert auch den passenden Mechanismus dazu.
Die diesjährige Trockenheit und grosse Wärme darf man zu Recht als ein besonderes "Naturereignis" klassifizieren.
Die diesjährigen Wetterverhaeltnisse werden wirklich durch "natürliche" und nicht voraussehbare Vorgänge bewirkt.
Nämlich:
Auf der Sonne sind, wie es öfter passiert, Plasmaringe (die Zigaretten-Rauchringen in ihrer Physik als "Wirbelschlauchringe" verwandt sind ) aufgebrochen. Siehe Abb. 1

 Abb. 1 Geschlossene Plasmaringe (A) brechen auf (B)
Abb. 1 Geschlossene Plasmaringe (A) brechen auf (B)
und bewirken einen starken Parttikelstrom (Rot)
Magnetfeldlinien sind (Schwarz) dargestellt

Das wirkt so als ob man einen Wasserschlauch aufschneidet.
Aus dessen Enden spritzt dann das Wasser heraus.
Nach dem Aufbrechen der solaren Plasmaringe wird dann Materie aus den tieferen Schichten der Sonne, d. h. hochenergetische, ionisierte Teilchen (sonst Sonnenwind genannt) mit hoher Geschwindigkeit in gewaltigen Mengen ausgestoßen.
Die Röntgenaufnahmen der Sonne dieses Jahres zeigen die Enden der aufgebrochenen Plasmaschläuche dunkel, sogenannte "Koronarlöcher".

 Abb. 2 Röntgenbilder der Sonne im Frühjahr 2018 zeigen die
"Koronalen Löcher"
Abb. 2 Röntgenbilder der Sonne im Frühjahr 2018 zeigen die
"Koronalen Löcher"
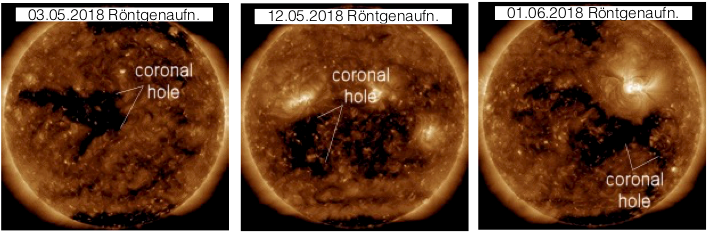

Meistens brechen die Plasmaringe in den Polregionen der Sonne.
Der Teilchenstrom geht dann senkrecht zur Ebene, in der die Planeten umlaufen, und trifft und beeinflusst die Planeten nicht.
Wie aber in Abb. 2 zu sehen, brachen dieses Jahr Ringe vorzugsweise in der Äquatorialregion, so dass der Teilchenstrom die Planeten, und eben auch die Erde, sozusagen "volle Breitseite" trifft.
Derzeit liegt der Teilchenstrom, der die Erde trifft, bei 600% (!!) des gewöhnlichen.
Das mit dem Teilchenstrom mitgeführte Magnetfeld von der Sonne hat das Erdmagnetfeld so gestört, dass es über dem Nordpol in Millionen von Quadratkilometern aufgerissen (d. h. sehr schwach) ist.
Das Erdmagnetfeld leitet gewöhnlich den Teilchenstrom um die Erde herum.
Da es jetzt fehlt, trifft der Teilchenstrom ungehindert die Erdatmosphäre.
Die gewaltige Energie der Sonnenwindteilchen trifft die Arktis und erwärmt diese massiv.
Weiterhin verdrängt der starke Sonnenwind die noch höher-energetische Höhenstrahlung aus dem Kosmos ("Forbush-Effekt"), welche auf Grund ihrer hohen Energie die Kondensationskeime für die Wolkenbildung stellen.
Folglich wird Wolkenbildung und Niederschlag signifikant reduziert.
Weniger Wolken, viel Sonnenschein, der die Erde erwärmt, und Ausfall von Regen.
Dies ist der Mechanismus, der das ungewöhnliche Wetter dieses Jahr unser Wetter bestimmt.
Was können wir aus dieser Einsicht lernen?
Nicht all zu viel.
Eine Voraussage, wie lange Koronarlöcher existieren werden, die in Richtung Erde emittieren, ist auf Grund unserer beschränkten Kenntnisse der Sonnenphysik nicht möglich.
Das Erdwetter kann also durchaus noch ins nächste Jahr fort dauern , aber auch abrupt aussetzen.
Immerhin lehrt uns dies Jahr, dass wir, und das heißt das gesamte organische Leben auf der Erde, Naturereignissen, die wir nicht beeinflussen können, relativ hilflos ausgeliefert sind.
Dies gibt uns eine etwas realistischere Sicht der Welt, als die politische Propaganda, welche uns, entgegen allen Forschungsergebnissen (!), einreden will, der Mensch beherrsche die Natur schon so intensiv, dass bereits ein "Antroprozän" angebrochen sei, indem der Mensch die Erde so stark forme, dass sie zerstört zu werden drohe.
Zum Vergleich:
Die am weitesten zurückreichende Temperatur Messreihe ist die von Mittelengland, von 1659 bis Juni 2018 - mit den zwei höchsten Monatsmittel-Temperaturwerten von 18 und 18.2 Grad C. für den Juni.
Im Juli wurden Werte von 18 bis über 19 Grad C. ca. 25 mal gemessen.
Nach dieser Tabelle war der wärmste Juni 1846!
Das diesjährige Sommerwetter ist also, obwohl für unsere Erinnerung ungewöhnlich, im historischen Kontext nicht so selten.
Auch in Zeiten, wo es eine industrielle Emission praktisch noch nicht gab.
Die historischen Daten über Niederschläge vermitteln ein ähnliches
▶ Weizenpreise und Sonnentätigkeit
| de | en | fr |
|---|---|---|
|
Die Sonne Sonnenaktivität |
The Sun Solar Activity |
Le soleil Activité solaire |
↑
Die jahrelange beispiellose Hitze- und Dürreperiode in Europa um 1540
en
The year-long unprecedented European heat and drought of 1540
-
EIKE Europäisches Institut für Klima und Energie
Oliver Wetter, Christian Pfister, Johannes P. Werner, Eduardo Zorita und weitere
2018-08-04 de Die jahrelange beispiellose Hitze- und Dürreperiode in Europa um 1540 - ein Worst CaseAbstract
Die Hitzewellen der Jahre 2003 in Westeuropa und 2010 in Russland, welche allgemein als seltene klimatische Anomalien außerhalb bisheriger Erfahrungen apostrophiert werden, werden oftmals als Warnungen vor noch häufigeren Extremen in einer von der globalen Erwärmung beeinflussten Zukunft herangezogen.
Eine neue Rekonstruktion der Temperaturen in Westeuropa im Frühjahr und Sommer zeigt jedoch, dass es im Jahre 1540 signifikant höhere Temperaturen gegeben haben muss.
Um die Plausibilität dieses Ergebnisses zu überprüfen, untersuchten wir die Schwere der Dürre 1540, indem wir das Argument der bekannten Rückkopplung zwischen Austrocknung des Bodens und Temperatur untersuchten.
Quelle/Source:
-
Springer Nature
Oliver Wetter, Christian Pfister, Johannes P. Werner, Eduardo Zorita and others
2018-06-28 en The year-long unprecedented European heat and drought of 1540 - a worst caseAbstract
The heat waves of 2003 in Western Europe and 2010 in Russia, commonly labelled as rare climatic anomalies outside of previous experience, are often taken as harbingers of more frequent extremes in the global warming-influenced future.
However, a recent reconstruction of spring-summer temperatures for WE resulted in the likelihood of significantly higher temperatures in 1540.
In order to check the plausibility of this result we investigated the severity of the 1540 drought by putting forward the argument of the known soil desiccation-temperature feedback.
Based on more than 300 first-hand documentary weather report sources originating from an area of 2 to 3 million km2, we show that Europe was affected by an unprecedented 11-month-long Megadrought.
The estimated number of precipitation days and precipitation amount for Central and Western Europe in 1540 is significantly lower than the 100-year minima of the instrumental measurement period for spring, summer and autumn.
This result is supported by independent documentary evidence about extremely low river flows and Europe-wide wild-, forest- and settlement fires.
We found that an event of this severity cannot be simulated by state-of-the-art climate models.
↑ Es gibt keine "globale Hitzewellen"
-
EIKE Europäisches Institut für Klima und Energie
Michael Bastasch / Andreas Demmig
2018-08-04 de Es gibt keine "globale Hitzewellen""Globale Hitzewelle" ist ein nur Schlagwort, das in Überschriften verwendet wird
Was tatsächlich zutrifft, sind Hitzewellen, die gleichzeitig in verschiedenen Teilen der Welt auftreten.
"Globale Hitzewellen ist also weder ein wissenschaftlicher Begriff noch eine gute Beschreibung dessen, was passiert", sagt Cliff Mass, ein Klimawissenschaftler an der Universität von Washington.
In letzter Zeit Sie sind wahrscheinlich auf Schlagzeilen über die "globale Hitzewelle" gestoßen, die verheerende Schäden von Japan über Europa bis nach Nordafrika anrichtet.
Falls Sie den Begriff "globale Hitzewelle" zum ersten Mal hören, sind Sie damit nicht allein.
Das liegt daran, dass es sich um einen Begriff handelt, der in hanebüchenden Schlagzeilen verwendet wird, um die Aufmerksamkeit zu steigern.
"'Global Heat Wave' scheint ein neuer Begriff zu sein, den einige Leute in den Medien- und Klima-Lobbygruppen erfunden haben", sagte Cliff Mass, ein Klimawissenschaftler an der Universität von Washington, dem Daily Caller.
Der Juli scheint über einen Großteil der nördlichen Hemisphäre hinweg glühende Hitze zu haben, einschließlich Rekordhochs in Kalifornien und Kanada.
Dreistellige Wärmegrade (in Fahrenheit 100 F = 38°C) wurden mit Todesfällen in Japan in Verbindung gebracht und brutzelnde Temperaturen trugen zu massiven Waldbränden in Skandinavien bei - Es ist mal wieder richtig Sommer.
Aber der Begriff "globale Hitzewelle" weckt Bilder von Hitzeglocken, die den gesamten Planeten kochen.
Was gemeint ist, sind Hitzewellen, die gleichzeitig in verschiedenen Teilen der Welt auftreten.
"Hitzewellen sind zwangsläufig lokalisierte Angelegenheiten, die normalerweise mit anomal hohem Luftdruck verbunden sind", sagte Mass in einer E-Mail.
"Globale Hitzewellen sind also weder ein wissenschaftlicher Begriff noch eine gute Beschreibung dessen, was passiert ist."
Auch der Klimawissenschaftler des Cato-Instituts, Ryan Maue, kritisierte Schlagzeilen, in denen von einer "globalen Hitzewelle" die Rede ist und von Wissenschaftlern, die ihre Namen für solche haarstäubenden Behauptungen zur Verfügung stellen.
Abgesehen davon, dass es Winter in der südlichen Hemisphäre ist, bemerkte Maue,
dass die Temperatur der nördlichen Hemisphäre derzeit dem Durchschnitt der letzten 18 Jahre entspricht.
Er stellte außerdem fest,
dass die Landtemperaturen der nördlichen Hemisphäre derzeit insgesamt unter dem Normalwert lagen.
⇧ 2016
↑ en The Incredible Heatwave Of January 1896 In Australia
![]()
![]() The Incredible Heatwave Of January 1896 In Australia
The Incredible Heatwave Of January 1896 In Australia
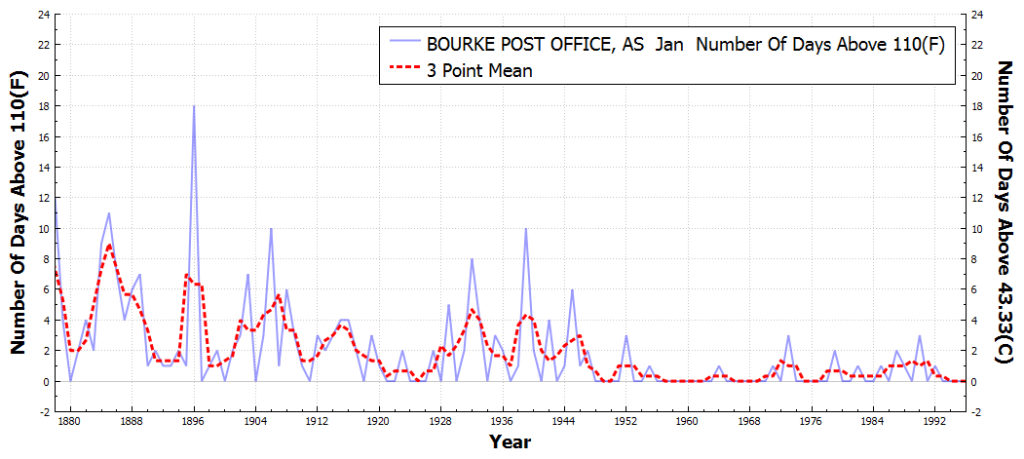
-
Real Science (Tony Heller alias Steven Goddard)
2016-02-10 en The Incredible Heatwave Of January 1896 In Australia
⇧ 2015
↑ en Building The Hockey Stick Ahead Of Paris
-
Real Science (Steven Goddard)
2015-09-22 en Building The Hockey Stick Ahead Of ParisNASA 2001:
In 2001, NASA showed little if any global warming from 1991 to 2001
NASA 2015:
Now they show a hockey stick of warming during that same period.
de Effektive Temperaturen
en Real TemperaturesThe planet has not warmed for almost 20 years, so NASA and NOAA are simply making up fake data to keep the president's fraudulent "climate legacy" on track ahead of Paris.
The Left Half Of NASA's Temperature Fraud
Half of NASA temperature fraud is manufactured by cooling the past. In 1981, Hansen showed a little over 0.3C surface warming from 1880 to 1980
The other half of their fraud is accomplished by warming recent years, which I will cover in a later post.
Make no mistake about it, NASA and NOAA are engaged in the biggest fraud in science history. Quelle/Source
More From America's Very Hot Past
One of the primary functions of both NASA and NOAA is to make America's hot past disappear. Quelle/Source
| de | en | fr |
|---|---|---|
|
Klimawandel: Probleme Temperatur-Manipulationen Skandal Manipulationen Teil I, II, III Climategate Institute, Who's who, Mails |
Climate change: Problems Temperature Manipulations Scandal Manipulations Part I, II, III Climategate Institutes, Who's who, Mails |
Climat: Problèmes Manipulation des températures Scandale Manipulations partie I, II, III Climategate Instituts, Qui est qui, Méls |
↑ en Minnesota's Extreme Past
-
Real Science (Tony Heller alias Steven Goddard)
2015-10-02 en Minnesota's Extreme PastOn February 15, 1936 Ada Minnesota set their all-time cold record of -53°F.
Less than five months later they set their all-time hot record of 111°F on July 6, 1936. That is a spread of 164 degrees.
On this date in 1922, Ada was 99°F. Today's forecast high is 35 degrees cooler at 64°F.
One hundred degree days were very common in Ada when CO2 was below 350 PPM, but they almost never happen any more.
There has only been one 100 degree day in Ada since 1988. but in 1936 they had twelve consecutive 100 degree days and eighteen during the summer.
↑ en Iowa Summers Used To Be Much Hotter And Longer
-
Real Science (Tony Heller alias Steven Goddard)
2015-10-02 en Iowa Summers Used To Be Much Hotter And LongerOn this date in 1953, it was an unbelievable 101 degrees at Indianola, Iowa
September days over 100 degrees used to be fairly common there, but they haven't had one in over 60 years.
↑ en September In Indiana Used To Be Hot
-
Real Science (Tony Heller alias Steven Goddard)
2015-09-30 en September In Indiana Used To Be HotOne hundred degree temperatures used to be common in Indiana during September prior to 1960, but they almost ne
↑
en
The World's Top Climate Scientist Is A Complete Moron
Heatwaves have been on the decline in Texas since the 1920s
-
Real Science (Tony Heller alias Steven Goddard)
en The World's Top Climate Scientist Is A Complete MoronThe 2011 heatwave in Texas was a one shot anomaly.
Heatwaves have been on the decline in Texas since the 1920s.
↑ en Hot Days Are A Thing Of The Past In Michigan
-
Real Science (Tony Heller alias Steven Goddard)
2015-09-25 en Hot Days Are A Thing Of The Past In MichigantNinety degree days used to be common in Michigan, but rarely happen any more.
The last really hot summer they had was 1988, when CO2 was still below 350 PPM.
↑ en Hot Weather Is A Thing Of The Past In South Dakota
-
Real Science (Tony Heller alias Steven Goddard)
2015-09-24 en Hot Weather Is A Thing Of The Past In South DakotaNinety degree days used to be common in Michigan, but rarely happen any more.
The last really hot summer they had was 1988, when CO2 was still below 350 PPM.
↑ en Hot Weather Is A Thing Of The Past
-
Real Science (Tony Heller alias Steven Goddard)
2015-09-24 en Hot Weather Is A Thing Of The PastDuring the 1930's two-thirds of the US would reach 100 degrees every summer.
In recent years, that number has been closer to one third.
⇧ 2012
↑
Ist das noch normal? Die extrem schwierige Analyse von Extremwetter
Anzahl der jährlichen Hitzetage in Zürich für die vergangenen 50 Jahre
![]()
![]() Anzahl der jährlichen Hitzetage in Zürich für die vergangenen 50 Jahre
Anzahl der jährlichen Hitzetage in Zürich für die vergangenen 50 Jahre
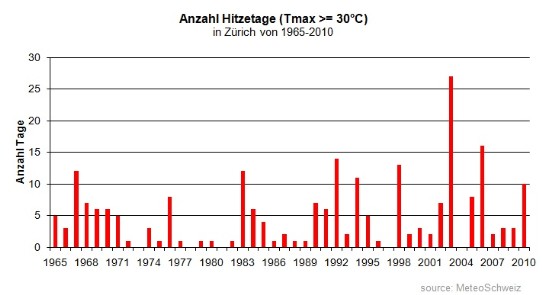
-
Die kalte Sonne (Fritz Vahrenholt & Sebastian Lüning)
2012-04-24 de Ist das noch normal? Die extrem schwierige Analyse von Extremwetter
⇧
13 Kälteperioden
en Cold periods
fr Periodes frodes
Mit folgenden Links wird von anderen Webseiten auf diese Seite verwiesen:
▶Kälteperioden / Cold periods / Periodes frodes
| de | en | fr |
|---|---|---|
|
Wetterphänomene Kälteperioden |
Weather phenomena Cold periods |
Phénomènes météorologiques Periodes frodes |
Links zur Klimaschau
|
|
▶Kälteperioden / Cold periods / Periodes frodes |
- Verzeichnis │ Allgemein │ Text
⇧ de Verzeichnis en Contents fr Sommaire
⇧ de Allgemein en General fr Générale
▶Energiearmut ▶Energie & Zivilisation
| de | en | fr |
|---|---|---|
|
Neue Kälteperiode Kaltzeit |
New Cold Period Cold Period |
Nouvelle periode froide Periode froide |
| Voraussagen | Predictions | Prédictions |
| Kälte: Warnungen | Cooling: Warnings | Refroidissement: Avertissements |
| Erwärmung: Entwarnung | Warming: All-Clear | Réchauffement: Fin de l'alerte |
| Eiszeiten | Ice Ages | Glaciations |
⇧ de Text en Text fr Texte
↑
Kälteperioden
en Cold periods
fr Periodes froides
Kälteperioden / Cold periods / Periodes froides
![]()
![]() Average near-surface temperatures of the northern hemisphere
during the past 11.000 years
Average near-surface temperatures of the northern hemisphere
during the past 11.000 years


|
|
|
1350 - ca. 1850 |
|
||||||||||||||||||||||||
| 1430 |
Cold Kills: The coldest decade of the millennium
How the cold 1430s led to famine and disease The climate simulations ran by Keller and her team showed that, while there were some volcanic eruptions and changes in solar activity around that time, these could not explain the climate pattern of the 1430s. The climate models showed instead that these conditions were due to natural variations in the climate system, a combination of natural factors that occurred by chance and meant Europe had very cold winters and normal to warm summers. |
||||||||||||||||||||||||
| 1816 |
The year wihout a summer A weak solar maximum, a major volcanic eruption, and possibly even the wobbling of the Sun conspired to make the summer of 1816 one of the most miserable ever recorded. |
||||||||||||||||||||||||
|
1970 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
1974 |
de Spiegel 1974: Die Wüste wächst Das Klima auf der nördlichen Halbkugel, so erklärte Dr. Reid Bryson, Direktor des Instituts für Umweltstudien an der University of Wisconsin, kühlt langsam, aber stetig ab. Auf ein stufenweises Ansteigen der Durchschnittswerte seit der Jahrhundertwende folgte in den letzten 20 Jahren ein vergleichsweise rasches Absinken der Temperaturen: Im Mittel sanken sie von 16 auf 15,7 Grad.
Regional sackten die Quecksilbersäulen noch tiefer. Als Grundlage dienten dabei Temperatur-Register und überlieferte Seewetter-Berichte des alten Fischervolks. Ergebnis: Seit Mitte dieses Jahrhunderts fielen die Durchschnittstemperaturen schneller als jemals zuvor in den letzten 1000 Jahren, um insgesamt ein Celsiusgrad. Zugleich wurde das Klima in den gewaltigen Kältezonen des Nordens, Kanada und Sibirien, immer frostiger. Über "anomal tiefe Temperaturen", die von den kanadischen Wetterstationen 19 Monate nacheinander aufgezeichnet wurden, berichtete Dr. Kenneth Hare, Meteorologe und Vorsitzender des Rockefeller-Meetings. Das gleiche gilt für Zentralrußland, wo vorletztes Jahr die "niedrigsten Temperaturen seit mehreren hundert Jahren" registriert wurden (so Dr. Jewgenij K. Fjodorow, Leiter des sowjetischen Wetterdienstes). The climate in the northern hemisphere, explained Dr. Reid Bryson, Director of the Institute for Environmental Studies at the University of Wisconsin, is cooling slowly but steadily. After the the mean temperature made a step upwards since the turn of the century, there's been a comparably rash temperature drop over the last 20 years: On average temperature dropped from 16 to 15,7°C.
For Iceland, which is considered to be a sensitive climate indicator,
Bryson and Icelandic meteorologist Berg Torssen calculated the climate
changes back to 900 A.D. ... Since the middle of this century, average temperatures dropped faster than at any time over the last 1000 years, by around 1°C. At the same time the climate in the huge cold zones of the North, Canada and Siberia are getting frostier ... for Central Russia, where the year before last the 'coldest temperature in several hundred years' was registered. |
||||||||||||||||||||||||
|
de
Eine neue Eiszeit
en
Another Ice Age? Spiegel 1974 - Kommt eine neue Eiszeit? Nicht gleich, aber der verregnete Sommer in Nordeuropa, so befürchten die Klimaforscher, war nur ein Teil eines weltweiten Wetterumschwungs -- ein Vorgeschmack auf kühlere und nassere Zeiten. |
|||||||||||||||||||||||||
|
de
Die CIA dokumentiert die Forschung zur globalen Abkühlung in den
siebziger Jahren en The CIA documents the global cooling research of the 1970's |
|||||||||||||||||||||||||
| 1975 |
de
Warnungen vor neuer Eiszeit
en
Warnings: The Comming Ice Age In dieser Periode wurde der Mensch für die Abkühlung verantwortlich gemacht. (mit dem gleichen, vom Mensch verursachten "Treibhauseffekt", mit dem heute vor der globalen Erwärmung gewarnt wird) |
||||||||||||||||||||||||
| 1977 |
Die gegenwärtige Wärmeperiode geht zu Ende Spiegel 1977 - Klima-Forscher haben die Hauptursache der Eiszeiten erkannt: Unregelmäßigkeiten im Lauf der Erde um die Sonne. Die gegenwärtige Wärmeperiode, sagen sie vorher, geht zu Ende. |
||||||||||||||||||||||||
| 1979 |
Es ist ein Winter-Sturm, der aus dem Nichts zu kommen scheint. |
||||||||||||||||||||||||
|
2000 |
Neue Kälteperiode / New Cold Period / Nouvelle periode froide |
||||||||||||||||||||||||
|
2007 |
|
||||||||||||||||||||||||
⇧ 2017
↑ Rekord-Minusgrade in den USA
-
Spiegel-Online
2017-12-31 de Rekord-Minusgrade in den USA Kältewarnungen für 70 Millionen Amerikaner an SilvesterFrierend ins neue Jahr:
Für Millionen Amerikaner wird es die kälteste Silvesternacht seit Jahrzehnten.
Selbst Südstaaten-Metropolen könnten Temperaturen um den Gefrierpunkt erleben.
In der Gemeinde Cotton im nördlichen Bundesstaat Minnesota wurden minus 40 Grad Celsius vermeldet.
In Watertown im Norden des Bundesstaats New York waren es am Donnerstag minus 36 Grad.
Auch weiter im Süden, bis hin zu Oklahoma, drohen am Neujahrstag bis zu minus 17 Grad.
Sogar die texanische Metropole Dallas und Georgias Hauptstadt Atlanta könnten Temperaturen um den Gefrierpunkt erleben.
Der kanadische Wetterdienst sagte für Ottawa am Silvesterabend minus 24 Grad Celsius voraus.
Bei der traditionellen Silvesterfeier am New Yorker Times Square werden laut Veranstalter trotz Kälte Hunderttausende Menschen erwartet.
Wenn der berühmte Leuchtball zu Mitternacht herabgelassen wird, könnten die Temperaturen dem Wetterdienst zufolge bei minus zwölf Grad Celsius liegen.
Laut CNN wäre es der drittkälteste Jahreswechsel seit der ersten Feier auf dem Times Square im Jahr 1907.
Wie es aussieht, wird es in vielen Teilen der USA bis Ende der Woche ungewöhnlich kalt bleiben, teilweise sogar bis zum 8. Januar, wie der Wetterdienst sagt.
Erst dann soll es etwas milder werden.
-
Blick
2017-12-31 de Kälte-Wahnsinn in den USAInsgesamt 70 Millionen Menschen werden Silvester in den USA bei Kältewarnungen feiern:
Vor allem für den Mittleren Westen und Osten der USA sagte der nationale Wetterdienst teils Rekord-Minustemperaturen voraus.
-
Basler Zeitung
2017-12-28 de Schneechaos, Eiseskälte und kein Ende in SichtDer Norden der USA und Teile Kanadas erleben derzeit einen äusserst harten Winter.
Mancherorts purzeln nicht nur die Temperaturen, sondern auch die Rekorde.
-
NoTricksZone (Pierre L. Gosselin)
2017-12-31 en The Great New Year's Freeze Of 2017 Setting Cold Records ...And Leading To Outlandish 'Climate' ClaimsMeteorologist Joe Bastardi warned of a cold snap gripping the Eastern US many weeks ago, in October, at his Weatherbell Analytics site.
Today it's all over the news: The Great Freeze of 2017 is smashing through the entire North American East, bringing with it a wave of record temperatures.
President Trump put his patented sense of humor on display at Twitter, provoking climate alarmists
"In the East, it could be the COLDEST New Year's Eve on record.
Perhaps we could use a little bit of that good old Global Warming that our Country, but not other countries,
was going to pay TRILLIONS OF DOLLARS to protect against. Bundle up!"
| de | en | fr |
|---|---|---|
|
Neue Kälteperiode Meldungen |
New Cold Period News |
Nouvelle periode froide Actualités |
⇧
14 Überlebensstrategien
en Survival strategies
fr Stratégies de survie
-
Die Weltwoche / Herbert Cerutti
2022-10-29 de Überlebensstrategien: Sie trotzen Kälte, Schnee und EisWerden bei uns die Tage kälter und fällt bald schon Schnee, beginnt für die Tiere in der freien Natur der saisonale Kampf gegen Hunger und Erfrieren.
Eine beliebte Strategie ist die Flucht.
Schwalben und Stare ziehen in den wärmeren Süden.
Tiere des Hochgebirges wie Hirsch und Steinadler verlegen ihren Lebensraum in tiefere Regionen, wo der Schnee weniger hoch liegt.
Wer aber in der Kälte bleibt, muss die meteorologische Prüfung trickreich meistern.
So fressen sich Gämse und Steinbock im üppigen Bergsommer dicke Fettpolster an, die schliesslich einen Fünftel des Körpergewichts ausmachen können.
Damit die Reserven bis zum Frühjahr reichen, müssen die Tiere rigoros Energie sparen:
Sie verharren tagelang fast unbeweglich an Ort.
Oder sie suchen Futter an Stellen, wo der Wind die Schneefracht weggeblasen hat.
Auch ein Winterpelz kann Wärmeverluste reduzieren.
So ist das Winterfell der Gämse eine Kombination langer, steifer Haare an der Oberfläche mit einer dichten Wollschicht darunter.
Die so im Fell eingefangene Luft isoliert wie ein Doppelfenster.
Bei der Gämse ist der Kälteschutz derart effizient, dass frischgefallener Schnee stundenlang ohne zu schmelzen auf dem Rücken bleibt.
Manche Tiere nutzen auch das Prinzip des Wärmetauschers:
Die in die Extremitäten führenden Arterien sind eng von Venen umgeben, wodurch das zurückfliessende venöse Blut vom warmen arteriellen Herzblut vorgeheizt wird.
Ein Meister der Anpassung ist das Schneehuhn.
Sein Daunenkleid lässt es Minustemperaturen von 40 Grad unbeschadet überstehen.
Auch Nasenlöcher und Beine sind mit Federn geschützt.
Und zur Winterausrüstung gehören Schneeschuhe:
An den Zehen wachsen im Herbst abstehende Hornplättchen, die den zierlichen Fuss gegen das Einsinken wappnen. /p>
Saisonale Askese
Zur Ernährung muss sich das Huhn aber Tag für Tag hundert Gramm Futter suchen, was das Sammeln von 15 000 Pflanzenteilchen erfordert.
Nach der Futterarbeit und für die Nacht graben sich Schneehühner Höhlen in den lockeren Schnee.
Herrschen draussen eiskalte minus 30 Grad, sind es in vierzig Zentimetern Schneetiefe noch minus 18 Grad.
Und mit der eigenen Körperwärme bringt das Huhn sein Iglu auf behagliche null Grad.
Eine Winterstrategie ist auch ein Leben als biologischer Kühlschrank.
Das Murmeltier kriecht in eine gutgeschützte Erd- oder Baumhöhle, rollt den Körper zu einer Kugel und fällt in einen lebensrettenden Winterschlaf.
Die Körpertemperatur sinkt von 34 auf 3 Grad, das Herz schlägt pro Minute anstatt achtzig- nur mehr drei- bis viermal, und geatmet wird noch alle paar Minuten.
Das Leben auf Sparflamme bringt Energieeinsparungen von gegen 95 Prozent.
Wer allerdings ganzjährig in einer Gletscherwelt existieren muss, braucht einen biologischen Gefrierschutz.
Der Gletscherfloh lebt vorwiegend knapp unter der eisigen Oberfläche in den Haarspalten und Schmelzlöchern der Gletscher.
Als Nahrung dienen die von Wind und Wasser aus der umliegenden Moränenwelt auf den Gletscher transportierten Blütenpollen.
Bei starkem Frost braucht der winzige Körper allerdings einen speziellen Schutz.
Indem das Insekt seine Körperflüssigkeit mit Zucker und Alkohol anreichert, wird der Gefrierpunkt markant gesenkt.
Neben solchem Frostschutz produziert der Körper spezielle Eiweissmoleküle.
Sobald sich in der Flüssigkeit erste Eiskristalle bilden, heften sich die Eiweissmoleküle an die Kristalloberfläche und blockieren die weitere Eisbildung.
Mit einem solchen «Supercooling» bleibt die im Körper zirkulierende Hämolymphe noch bei minus 20 Grad flüssig.
⇧
15 Todesfälle wegen Extremwetter
en Death Rates Due to Extreme Weather Events
fr Décès dus à des intempéries extrèmes
Mit folgenden Links wird von anderen Webseiten auf diese Seite verwiesen:
▶Todesfälle wegen Extremwetter
| de | en | fr |
|---|---|---|
|
Wetterphänomene Todesfälle wegen Extremwetter |
Weather phenomena Death Rates Due to Extreme Weather Events |
Phénomènes météorologiques Décès dus à des intempéries extrèmes |
Links zur Klimaschau
|
|
▶Wetterphänomene ▶Extremwetter ▶Dürre ▶Niederschläge ▶Waldbrände ▶Wintersturm ▶Tropischer Wirbelsturm ▶Hurrikan ▶Blockierte Wetterlagen ▶Todesfälle wegen Extremwetter |
-
Watts UP With That? (Antony Watts)
2008-07-05 en Death Rates Due to Extreme Weather Events
en Table of supporting data
⇧
16 Auswirkungen von und auf Erdbeben
en Earthquake
fr Séisme
Mit folgenden Links wird von anderen Webseiten auf diese Seite verwiesen:
▶Auswirkungen von und auf Erdbeben
| de | en | fr |
|---|---|---|
|
Wetterphänomene Auswirkungen von und auf Erdbeben |
Weather phenomena Earthquake |
Phénomènes météorologiques Séisme |
- Verzeichnis │ Allgemein │ Text
⇧ de Verzeichnis en Contents fr Sommaire
⇧ de Allgemein en General fr Générale
-
Wikipedia
de
Erdbeben
en Earthquake
fr Séisme
⇧ de Text en Text fr Texte
↑ a Panik-Meldung von Dr. Tom J. Chalko
Panik-Meldung
en Panic
fr Panique
- en Today's Quakes Deadlier Than In Past - Story - 06/18/2008
- New research compiled by Australian scientist Dr. Tom Chalko shows that global seismic activity on Earth is now five times more energetic than it was just 20 years ago
-
von Dr. Tom J. Chalko, MSc, PhD, Vorsitzender der Geophysics
Division, Scientific E Research P/L, Melbourne, Australien 2001-04-08
de Es gibt keine zweite Chance: Kann die Erde als Resultat globaler Erwärmung explodieren?
en No second chance: can Earth explode as a result of Global Warming?
fr Pas de deuxième chance: la terre peut-elle éclater en raison du réchauffement global?
- Wikipedia en Thiaoouba Prophecy
- Dr. Tom J. Chalko en Homepage: Global Warming: Can Earth EXPLODE?
-
CBS News
2008-06-16 en Today's Quakes Deadlier Than In Past
Entwarnung
en All-clear
fr Fin de l'alerte
-
Watts Up With That? (Antony Watts)
2008-06-19 en Quake n' Bake: Global Warming Causes More Energetic Earthquakes?
2008-06-19 en CBS News sinks to new low; publishes crackpot global warming story, attributes it to Associated Press, kills it with no retraction
⇧
17 Vulkane
en Volcanos
fr Volcans
Mit folgenden Links wird von anderen Webseiten auf diese Seite verwiesen:
| de | en | fr |
|---|---|---|
|
Wetterphänomene Vulkane |
Weather phenomena Volcanos |
Phénomènes météorologiques Volcans |
- Verzeichnis │ Allgemein │ Text
⇧ de Verzeichnis en Contents fr Sommaire
⇧ de Allgemein en General fr Générale
⇧ de Text en Text fr Texte
↑
a Geschichte der Vulkane
en History of Volcanos
fr Histoire des volcans
Vulkane / Volcano / Volcan
| ⇒ Google Web | ⇒ Google Video | ⇒ Wikipedia | |||
| de | vulkan | de | vulkan | de | Vulkan |
| en | volcano | en | volcano | en | Volcano |
| fr | volcan | fr | volcan | fr | Volcan |
-
Naturgewalt.de
de Vulkanausbrüche, chronologisch
| 79 BC |
Vesuvius Erupts Pompeii Destroyed in Italy
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1815 |
Mt. Tambora, Indonesia
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1991 |
Mt. Pinatubo, Philippines
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
↑ b Einfluss von Vulkanen auf das Klima
| de | en | fr |
|---|---|---|
|
Einflüsse auf das Klima Vulkane |
Impacts on Climate Change Volcanos |
Impacts sur le climat Volcans |
↑ c Auswirkungen des Klimas auf Vulkane
-
Klimaskeptiker Info
de Dipl.-Geologe Frank Möckel: Hat die Klimahysterie nun auch die Vulkanforschung erreicht?
↑
d Untermeerische Vulkane
en Sub-oceanic volcanoes
|
|
|
|
|
|
|
|
de Die Erde / Vulkane
en The Earth / Volcanos |
⇧
18 Blitz
en Lightning
fr Foudre
Mit folgenden Links wird von anderen Webseiten auf diese Seite verwiesen:
| de | en | fr |
|---|---|---|
|
Wetterphänomene Blitz |
Weather phenomena Lightning |
Phénomènes météorologiques Foudre |
-
Die kalte Sonne (Fritz Vahrenholt & Sebastian Lüning)
2017-12-10 de Deutschland atmet auf: Zahl der Blitzeinschläge in den letzten 10 Jahren rückläufig
-
Die kalte Sonne (Fritz Vahrenholt & Sebastian Lüning)
2013-11-30 de Blitzhäufigkeit in Brasilien pulsierte während der vergangenen 60 Jahre im Takt der Sonne
⇧
19 Bergstürze
en Landslides
fr Glissements de terrain
Mit folgendem Link wird von anderen Webseiten auf diese Seite verwiesen.
| de | en | fr |
|---|---|---|
|
Wetterphänomene Bergstürze |
Weather phenomena Landslides |
Phénomènes météorologiques Glissements de terrain |
-
Wikipedia
de
Bergsturz
en Sturzstrom
fr Glissement de terrain
-
2014-07-15 de
 Gefahr aus den Bergen
Gefahr aus den Bergen
-
2014-07-23 de
 Erdrutsch - Die unterschätzte Gefahr
Erdrutsch - Die unterschätzte Gefahr
Die Erdrutsch-Katastrophen in den vergangenen Jahren wie in Nachterstedt und in Köln haben die Bevölkerung stark verunsichert.
Betroffene, Gutachter und Forscher suchen nach Erklärungen.
![]() Hochwasserereignisse & Überschwemmungen
Hochwasserereignisse & Überschwemmungen
- 2017: Der Bergsturz von Bondo
- de
Der Klimawandel von Bondo
Markus Häring (Basler Zeitung)
Dass die Klimaerwärmung eine Destabilisierung im vergletscherten Gebirgsbereich hat, trifft schon zu.
Doch das kann genauso eine gleichmässigere Erosion fördern und ganz grosse Abbrüche verhindern, wie eine zunehmende Vergletscherung den Abbruch kleiner Bergstürze verhindern kann, um sich in grösseren katastrophalen Ereignissen zu akkumulieren.
Aus dem Klimawandel ein höheres Gefahrenpotenzial abzuleiten, ist nicht richtig. - de
Die Busspredigerin
Markus Somm (Basler Zeitung)
Wie Linkspopulisten uns verführen. Eine Serie. Heute: Doris Leuthard. - de
Aus den Fugen
Dominik Feusi (Basler Zeitung)
Wie der Bergsturz von Bondo für links-grüne Politik instrumentalisiert wird und wer dabei welche Rolle spielt. - 1806: Bergsturz von Goldau
- Vor ca. 10'000 Jahren: Bergsturz von Flims
↑ 2017 Der Bergsturz von Bondo (Schweiz)
⇧ Der Klimawandel von Bondo
-
Basler Zeitung / Markus Häring
2017-09-08 de Der Klimawandel von BondoDass die Klimaerwärmung eine Destabilisierung im vergletscherten Gebirgsbereich hat, trifft schon zu.
Doch das kann genauso eine gleichmässigere Erosion fördern und ganz grosse Abbrüche verhindern, wie eine zunehmende Vergletscherung den Abbruch kleiner Bergstürze verhindern kann, um sich in grösseren katastrophalen Ereignissen zu akkumulieren.
Aus dem Klimawandel ein höheres Gefahrenpotenzial abzuleiten, ist nicht richtig.
⇧ Die Busspredigerin
-
Basler Zeitung / Markus Somm Feusi
2017-09-02 de Die BusspredigerinWie Linkspopulisten uns verführen. Eine Serie. Heute: Doris Leuthard.
Leuthard gibt den Startschuss für eine einzigartige Medienkampagne.
Populismus in Vollendung. Um ihre untaugliche Energiepolitik durchzusetzen, nutzt Bundesrätin Doris Leuthard jede Tragödie und zwingt das Publikum dazu, sich ihre Argumente anzuhören.
In Zeiten der Krise
«Witwenschütteln» nennt man unter Journalisten die etwas unappetitliche Methode, nach einem Unglück bei den Angehörigen aufzukreuzen und sie unter Tränen dazu zu bringen, Informationen preiszugeben.
Man nutzt die seelische Erschütterung aus, um Dinge zu erhalten, die man sonst nur schwer bekäme.
Was Leuthard tut, erinnert daran.
Um ihre untaugliche Energiepolitik durchzusetzen, nutzt sie jede Tragödie und bringt das erschütterte Publikum dazu, sich ihre Argumente anzuhören.
Es ist Linkspopulismus in Vollendung,
was uns die Bundespräsidentin hier bietet, nicht zum ersten Mal.
Statt die Menschen zu beruhigen und zu helfen, zieht die Katholikin wie einst Savonarola, der humorlose Bussprediger in Florenz, von Katastrophe zu Katastrophe, sie klagt an, tröstet Gemeindepräsidentinnen, warnt vor weiteren Katastrophen und ermahnt uns Bürger und Steuerzahler zur Umkehr,
ansonsten wir in der Hölle verbrennen.
1806 ereignete sich der Bergsturz von Goldau.
40 Millionen Kubikmeter Nagelfluhgestein rutschten in die Tiefe und begruben mehrere Dörfer.
457 Menschen kamen um.
Es war eine der grössten Naturkatastrophen der Schweizer Geschichte.
Manche sahen darin ein Zeichen Gottes, der uns zur Umkehr aufforderte, andere untersuchten es wissenschaftlich.
Die Politiker hingegen riefen zu nationaler Solidarität auf, keiner behauptete, er hätte die Lösung, um Bergstürze einzudämmen.
Vom Klimawandel war keine Rede. Man glaubte noch an Gott.
⇧ Aus den Fugen
-
Basler Zeitung / Dominik Feusi
2017-08-30 de Aus den FugenWie der Bergsturz von Bondo für links-grüne Politik instrumentalisiert wird und wer dabei welche Rolle spielt.
Leuthard gibt den Startschuss für eine einzigartige Medienkampagne.
«Es wird weitergehen mit solchen Zwischenfällen.»
Es sei ja nicht das erste Mal, dass sie vom Klimawandel rede.
«Es ist halt eine Realität, auch wenn einige das immer noch nicht glauben.»
Damit ist von höchster Stelle der direkte Zusammenhang hergestellt zwischen der Katastrophe im Bergell und dem Klimawandel.
Am Tag darauf schreibt Stefan Häne im Tages-Anzeiger prompt,
die Ursache des Unglückes sei der Klimawandel.
Und obwohl die Berge immer schon in Bewegung gewesen seien, «das Tempo, die Häufigkeit, das Ausmass» seien neu.
In Bondo würden die «brachialen Folgen» des Klimawandels sichtbar.
Häne hofft, was vermutlich auch Leuthard hofft, dass dies die Parlamentarier im Bundeshaus aufwecke.
Die sollen, so Häne, «bei der anstehenden Revision des CO2-Gesetzes die Schweiz klimapolitisch auf Kurs bringen».
Die umstrittene Vorlage will die CO2-Abgabe, die schon heute ein Vielfaches höher ist als jene in unseren Nachbarländern, noch einmal mehr als verdoppeln.
«Tausende von Jahren»
In der NZZ versucht Christian Speicher einen Tag später, dem Geologen vom Amt für Wald und Naturgefahren des Kantons Graubünden mit Suggestivfragen zu entlocken
, dass es der Klimawandel sei, der den Bergsturz ausgelöst habe und dass sich solche Ereignisse häufen werden.
Doch Huwiler sagt, dass die Prozesse, die zu einem Bergsturz führen, «Tausende von Jahren» bräuchten.
Vielleicht komme es zu einer leichten Zunahme solcher Katastrophen, aber er bezweifle, dass dies statistisch signifikant sein werde.
Der Eindruck, solche Ereignisse würden sich häufen, hänge mit unserer Wahrnehmung zusammen.
Neben dem Interview schreibt Speicher dann allerdings trotzdem von «wachsenden Naturgefahren».
Immerhin gibt Speicher auch noch zu, dass es zu einfach sei, jeden Felssturz mit dem Klimawandel in Verbindung zu bringen.
Wenn Tamedia und NZZ in die gleiche Kerbe hauen, dann darf der Blick nicht fehlen,
zumal es um die gute Beziehung zu Medienministerin Doris Leuthard geht.
Marco Latzer schreibt am letzten Samstag auf Blick online unter dem Titel
«Geologe warnt vor weiteren Katastrophen»,
dass sich die Politiker und Experten «einig» seien:
«Mit den veränderten klimatischen Bedingungen und dem Abschmelzen unserer Gletscher werden diese Gefahren zunehmen.»
Welche Politiker und Experten er befragt hat, sagt uns Latzer natürlich nicht.
Klimaheldin Leuthard
Huwiler, der die Gefahrenstelle schon seit Untersuchungen 2011 genaustens kennt, dürfte es nicht sein.
Auch Simon Löw, Leiter der Professur für Ingenieurgeologie an der ETH Zürich, kann es nicht sein, denn der sagt Blick auf Anfrage das Gegenteil von dem, was das Blatt erhofft:
«Grosse Bergstürze stehen weniger in Verbindung mit dem Klimawandel.»
Ähnliches sagt auch der Geologe Hans-Rudolf Keusen.
Bondo sei ein «aussergewöhnliches Ereignis».
Doch «einig» sind sich gemäss Blick die Experten trotzdem.
Erst einen Tag später hat Blick-online-Journalist Reza Rafi endlich einen «Experten» gefunden, der - wiederum auf eine Suggestivfrage - den Bezug zwischen der Katastrophe und dem Klimawandel doch noch herstellt.
Es ist Christoph Graf von der vom Bund finanzierten Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL).
Und er sagt, was Doris Leuthard sicher freut.
Die Schweiz müsse sich klimapolitisch «deutlich stärker engagieren».
Graf macht dabei, was eigentlich kein seriöser Klimaforscher tut:
Er verweist auf die «Stürme der letzten Tage und Wochen», die ebenfalls auf den Klimawandel zurückzuführen seien.
Er bringt also Wetterphänomene direkt mit Klima in Verbindung.
Damit nicht genug: Gleichentags wird auf Blick online die Regierung und ihre derzeit oberste Repräsentantin gefeiert:
«Das tut Leuthard gegen den Klimawandel»
steht da und wir erfahren, dass sich eines von 31 Projekten des Bundes der «Vorbereitung der Milchviehbetriebe auf den Klimawandel» widmet.
Dieser Artikel wird dann im Sonntagsblick zweitverwertet.
Diese Woche geht die Alarmstimmung auf Blick.ch unvermindert weiter:
«Wir müssen uns wappnen - So hart trifft der Klimawandel die Schweiz».
Darunter befindet sich ein Filmchen der teilweise durch Bundesgeld finanzierten Schweizerischen Depeschenagentur (SDA), bei der ein Apfelbauer Larven in seinen Früchten zeigt, die von «Schädlingen aus Südeuropa» stammen sollen.
Die SDA ist es auch, die übers Wochenende die Forderung des Direktors des Bundesamtes für Umwelt und Direktunterstellten von Doris Leuthard, Marc Chardonnens, verbreitet, die Schweiz müsse sich an den Klimawandel anpassen.
Auch er betont, solche Ereignisse würden zunehmen.
Und auch SRF legt nach: 10vor10 bringt am Montag wieder Wetterphänomene direkt mit dem Klimawandel in Verbindung,
«Die Welt scheint aus den Fugen»,
sagt die Stimme bedrohlich aus dem Hintergrund.
Und «Waldbrände wüten in ganz Südeuropa».
SRF-Moderator Arthur Honegger konfrontiert den anwesenden Klimaforscher natürlich nicht mit den Aussagen der Kenner der Verhältnisse in Bondo und auch nicht mit der Vermischung von Wetter und Klima.
Doch damit nicht genug:
Gestern wurde im «Club» diskutiert, was wir gegen «immer mehr» solcher Ereignisse denn tun müssten.
Die entscheidende Frage fehlt
Sind es tatsächlich «immer mehr»?
Es ist komplizierter, als es uns dargestellt wird.
Dass sich das Klima ändert, ist unbestritten.
Aber ob das tatsächlich zum Bergsturz von Bondo geführt hat, bezweifeln selbst ausgewiesene Fachleute.
In der Schweiz gibt es eine gute Datenbasis über derartige Ereignisse.
Eine Auswertung dieser Daten hielt schon 2009 fest, dass es keinen Trend zu immer mehr Katastrophen gebe.
Ähnliches zeigt eine Auswertung von 2016.
Weder Tages-Anzeiger noch NZZ, Blick oder SRF haben zudem die entscheidende politische Frage gestellt:
Nämlich ob die Erwärmung tatsächlich etwas mit dem Menschen zu tun hat.
Nur dann macht das CO2-Gesetz Sinn.
Wenn der Klimawandel nur zu einem Teil oder gar nicht vom Menschen gemacht wäre, müssten wir uns ihm zwar anpassen, aber wir könnten nichts dagegen tun.
Die Frage kommt nirgends vor, und wer sie stellt, auch nicht.
Die Medien-Karawane zieht derweilen weiter.
Kaum zufällig berichteten Blick, Tages-Anzeiger und SRF am Montag gleichzeitig, dass sich Schweizer Städte auf dem Balkan nach neuen Baumarten für ihre Pärke umschauen würden.
Wegen dem Klimawandel.
↑ 1806 Der Bergsturz von Goldau (Schweiz)
- Wikipedia de Bergsturz von Goldau
-
2017-06-06 de
 Der Bergsturz von Goldau
Der Bergsturz von Goldau
Der Bergsturz von Goldau ist eine der bisher grössten Katastrophen der Schweiz.
Gegen 40 000 000 Kubikmeter Nagelfluh rutschten im Jahre 1806 vom Rossberg zu Tal und begruben das Dorf Goldau.
Geologen warnen davor, dass noch weitere grosse Abbrüche drohen.
↑ Vor ca. 10'000 Jahren: Der Bergsturz von Flims (Schweiz)
-
Wikipedia
de
Flimser Bergsturz
en Flims rockslide
⇧
20 Sturm (Wintersturm)
en Storm
fr Tempête
Mit folgenden Links wird von anderen Webseiten auf diese Seite verwiesen:
| de | en | fr |
|---|---|---|
|
Wetterphänomene Sturm (Wintersturm) |
Weather phenomena Storm |
style="vertical-align:top">
Phénomènes météorologiques Tempête |
Links zur Klimaschau
|
|
▶Wintersturm ▶Tropischer Wirbelsturm ▶Sturmflut |
⇧ de Verzeichnis en Contents fr Sommaire
- 2017
- de University of Toronto: Vielleicht sogar weniger Stürme durch Klimaerwärmung
- de
Lehren aus der Klimageschichte:
Kälte und schwache Sonne befeuern Sturmtätigkeit in Europa
Die Sturmtätigkeit in Europa hat sich stets während Kältephasen verstärkt - 2016
- de Mojib Latif liegt bei den englischen Stürmen daneben: Stürmischte Phase war während der Kleinen Eiszeit
- de PIK endlich einmal mit guten Nachrichten: Sturmaktivität der nördlichen mittleren Breiten hat signifikant abgenommen
- 2014
- de Helmholtz-Zentrum Geesthacht: Winterstürme in Nordwesteuropa bisher nicht vom Klimawandel beeinflusst
- 2012
- de Stürme an der englischen Kanalküste wüteten im 1500-Jahres-Takt: Je kälter, desto stürmischert
- de Eine unbequeme Wahrheit: Während der Kleinen Eiszeit waren die Stürme in Europa stärker als heute
- de Wann gab es die schlimmsten Stürme an der französischen Mittelmeerküste? Immer wenn die Sonne schwächelte und die Temperaturen fielen!
- de Die kräftigsten Stürme gab es in Holland während der Kleinen Eiszeit
⇧ Welt-Info
|
|
Stürme / Storm / Tempête |
| ▷Die Kalte Sonne Blog‑Themen Vahrenholt/Lüning ▶Die kalte Sonne | de ▷Stürme |
| EIKE | de Hurrikan, Taifun. |
| WUWT | en Tornado Page, Tropical Cyclone Page |
| NoTricksZone | en Hurricanes / Tornados |
| Popular Technology | en Hurricanes, Storms, Tornadoes. |
| Wikipedia |
de
Meeresspiegel en Sea level fr Niveau de la mer |
| Vademecum |
▶Wintersturm
▶Welt-Info |
| Siehe auch | ▶Extremwetter |
|
|
|
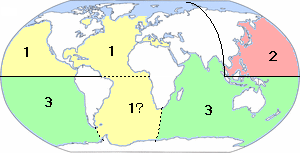
|
1 Hurrikan (Orkan) |
| de | en | fr |
|---|---|---|
| Wetterphänomene (Teil 2) | Weather phenomena (Part 2) | Phénomènes météorologiques (partie 2) |
| Sturm (Wintersturm) | Storm | Tempête |
| Tropischer Wirbelsturm | Tropical cyclone | Cyclone tropical |
| Hurrikan | Hurricane | Ouragan (Cyclone tropical) |
| Medicane | Mediterranean tropical-like cyclone | Cyclone subtropical méditerranéen |
| Taifun | Typhoon | Typhon |
| Tornado | Tornado | Tornade |
| Zyklon | Cyclone | Cyclone |
| Sturmflut | Storm surge | Onde de tempête |
| Blizzard | Blizzard | Blizzard (météorologie) |
| Wind | Wind | Vent |
| Jetstream | Jet stream | Courant-jet |
| Monsun | Monsoon | Mousson |
| Blockierte Wetterlagen | Block (meteorology) | Blocage (météorologie) |
⇧ de Allgemein en General fr Générale
⇧ de Text en Text fr Texte
⇧ 2017
↑ University of Toronto: Vielleicht sogar weniger Stürme durch Klimaerwärmung
-
Die kalte Sonne (Fritz Vahrenholt & Sebastian Lüning)
2017-12-30 de University of Toronto: Vielleicht sogar weniger Stürme durch KlimaerwärmungUnser Thema heute:
Stürme in mittleren Breiten, also dort, wo die meisten unserer Leser wohnen.Die University of Toronto meldete 2015, dass der Klimawandel wohl nicht zu mehr Stürmen führen wird, aber möglicherweise die Intensitäten veschieben könnte.
Schwere Stürme könnten seltener werden.
↑ Lehren aus der Klimageschichte: Kälte und schwache Sonne befeuern Sturmtätigkeit in Europa
-
Die kalte Sonne (Fritz Vahrenholt & Sebastian Lüning)
2017-10-22 de Lehren aus der Klimageschichte: Kälte und schwache Sonne befeuern Sturmtätigkeit in EuropaFazit
Die Sturmtätigkeit in Europa hat sich stets während Kältephasen verstärkt.
Kälte und Stürme ereigneten sich im Zuge von solaren Schwächeperioden, die sich als Auslöser der Variabilität anbieten.
Der übegeordnete Zyklus beträgt hier 1000 Jahre (Eddy-Zyklus), der wohl den Wechsel zwischen Römischer, Mittelalterlicher und Moderner Wärmeperiode und den dazwischengeschalteten Kältephasen gebracht hat.
Ozeanzyklen modulieren das Geschehen im Jahrzehntmaßstab, mit einer Zyklendauer von 60 Jahren.
Die Sturmrekonstruktionen aus Europe zeigen ein einheitliches Bild, das die Klimamodellierer und Attributions-Forscher nun aufgreifen, erklären und in ihre Simulationen aufnehmen müssen.
Angesichts der starken und systematischen solaren Signatur wird es schwer werden, den verschwindend gering angenommenen Strahlungsantrieb für solare Schwankungen in der Klimagleichung aufrechtzuerhalten.
⇧ 2016
↑ Mojib Latif liegt bei den englischen Stürmen daneben: Stürmischte Phase war während der Kleinen Eiszeit
-
Die kalte Sonne (Fritz Vahrenholt & Sebastian Lüning)
2016-01-07 de Mojib Latif liegt bei den englischen Stürmen daneben: Stürmischte Phase war während der Kleinen Eiszeit
↑ PIK endlich einmal mit guten Nachrichten: Sturmaktivität der nördlichen mittleren Breiten hat signifikant abgenommen
-
Die kalte Sonne (Fritz Vahrenholt & Sebastian Lüning)
2016-10-03 de PIK endlich einmal mit guten Nachrichten: Sturmaktivität der nördlichen mittleren Breiten hat signifikant abgenommen
⇧ 2014
↑ Helmholtz-Zentrum Geesthacht: Winterstürme in Nordwesteuropa bisher nicht vom Klimawandel beeinflusst
-
Die kalte Sonne (Fritz Vahrenholt & Sebastian Lüning)
2014-10-30 de Helmholtz-Zentrum Geesthacht: Winterstürme in Nordwesteuropa bisher nicht vom Klimawandel beeinflusst
⇧ 2012
↑ Stürme an der englischen Kanalküste wüteten im 1500-Jahres-Takt: Je kälter, desto stürmischert
-
Die kalte Sonne (Fritz Vahrenholt & Sebastian Lüning)
2012-12-13 de Stürme an der englischen Kanalküste wüteten im 1500-Jahres-Takt: Je kälter, desto stürmischert
↑ Eine unbequeme Wahrheit: Während der Kleinen Eiszeit waren die Stürme in Europa stärker als heute
-
Die kalte Sonne (Fritz Vahrenholt & Sebastian Lüning)
2012-08-05 de Eine unbequeme Wahrheit: Während der Kleinen Eiszeit waren die Stürme in Europa stärker als heute
↑ Wann gab es die schlimmsten Stürme an der französischen Mittelmeerküste? Immer wenn die Sonne schwächelte und die Temperaturen fielen!
-
Die kalte Sonne (Fritz Vahrenholt & Sebastian Lüning)
Daniel Albig und Sebastian Lüning
2012-07-12 de Wann gab es die schlimmsten Stürme an der französischen Mittelmeerküste? Immer wenn die Sonne schwächelte und die Temperaturen fielen!
↑ Die kräftigsten Stürme gab es in Holland während der Kleinen Eiszeit
-
Die kalte Sonne (Fritz Vahrenholt & Sebastian Lüning)
2012-02-06 de Die kräftigsten Stürme gab es in Holland während der Kleinen Eiszeit
⇧
21 Tropischer Wirbelsturm
en Tropical cyclone
fr Cyclone tropical
Mit folgenden Links wird von anderen Webseiten auf diese Seite verwiesen:
| de | en | fr |
|---|---|---|
|
Wetterphänomene Tropischer Wirbelsturm |
Weather phenomena Tropical cyclone |
style="vertical-align:top">
Phénomènes météorologiques Cyclone tropical |
Links zur Klimaschau
|
|
▶Wintersturm ▶Tropischer Wirbelsturm ▶Sturmflut |
⇧ de Verzeichnis en Contents fr Sommaire
- 2016
- de AWI: Ostküsten Südafrikas, Asiens, Australiens und Südamerikas werden vielleicht stürmischer
- 2015
- de Schwerer Wirbelsturm verwüstet Vanuatu. Premierminister sieht es realistisch: "Stürme sind kein neues Phänomen, wir Insulaner leider darunter seit Besiedelung Vanuatus vor 5000 Jahren"
- 2014
- de Neue Arbeit in Nature: Noch nie waren die australischen Wirbelstürme in den letzten 1500 Jahren schwächer als heute
- 2013
- de
Vorindustrielle Zeit war verrückter als gedacht:
Tropische Wirbelstürme in den letzten 5000 Jahren weltweit auf
wilder Achterbahnfahrt.
Außerdem: Eine weitere Arbeit sagt Abnahme der tropischen Wirbelsturmtätigkeit vorher - de Die Süddeutsche Zeitung will mehr Sturm, doch die Natur weigert sich standhaft
- de Studie der Universität Utrecht: Keine Zunahme der tropischen Wirbelstürme im australischen Queensland während der letzten 200 Jahre
- 2012
- de Björn Lomborg: Wirbelstürme lassen sich nicht durch Senkung der CO2-Emissionen bändigen
- de Neue Klimamodellierung findet langfristige Abnahme der Hurrikan-Häufigkeit
- de Hurrikanen scheint die Erwärmung egal zu sein: Keine Zunahme der tropischen Wirbelstürme in den letzten Jahrzehnten
- 2011
- en Tropical Storm Activity Hits A 40-Year Low - Possibly "Unprecedented"!
⇧ Welt-Info
|
|
Stürme / Storm / Tempête |
| ▷Die Kalte Sonne Blog‑Themen Vahrenholt/Lüning ▶Die kalte Sonne | de ▷Stürme |
| EIKE | de Hurrikan, Taifun. |
| WUWT | en Tornado Page, Tropical Cyclone Page |
| NoTricksZone | en Hurricanes / Tornados |
| Popular Technology | en Hurricanes, Storms, Tornadoes. |
| Wikipedia |
de
Meeresspiegel en Sea level fr Niveau de la mer |
| Vademecum |
▶Wintersturm
▶Welt-Info |
| Siehe auch | ▶Extremwetter |
|
|
|
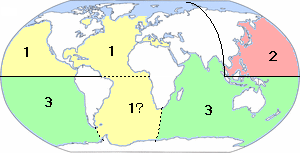
|
1 Hurrikan (Orkan) |
| de | en | fr |
|---|---|---|
| Wetterphänomene (Teil 2) | Weather phenomena (Part 2) | Phénomènes météorologiques (partie 2) |
| Sturm (Wintersturm) | Storm | Tempête |
| Tropischer Wirbelsturm | Tropical cyclone | Cyclone tropical |
| Hurrikan | Hurricane | Ouragan (Cyclone tropical) |
| Medicane | Mediterranean tropical-like cyclone | Cyclone subtropical méditerranéen |
| Taifun | Typhoon | Typhon |
| Tornado | Tornado | Tornade |
| Zyklon | Cyclone | Cyclone |
| Sturmflut | Storm surge | Onde de tempête |
| Blizzard | Blizzard | Blizzard (météorologie) |
| Wind | Wind | Vent |
| Jetstream | Jet stream | Courant-jet |
| Monsun | Monsoon | Mousson |
| Blockierte Wetterlagen | Block (meteorology) | Blocage (météorologie) |
⇧ de Allgemein en General fr Générale
-
Wikipedia de
Tropischer Wirbelsturm
en Tropical cyclone
fr Cyclone tropical
![]()
![]() Schematischer Querschnitt durch einen tropischen Wirbelsturm
Schematischer Querschnitt durch einen tropischen Wirbelsturm
 w
w
![]()
![]() Die Verlaufsbahnen der tropischen Wirbelstürme von 1985 bis 2005
Die Verlaufsbahnen der tropischen Wirbelstürme von 1985 bis 2005

Benennung
Tropische Wirbelstürme mit einer Windgeschwindigkeit, die einem Orkan entspricht - Windstärke 12 auf der Beaufortskala (das entspricht mehr als 64 Knoten oder 118 km/h) - tragen je nach ihrem Entstehungsgebiet unterschiedliche Bezeichnungen:
|
|
|
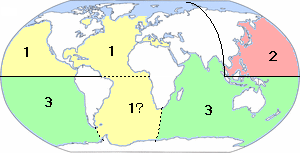
|
1 Hurrikan (Orkan) |
Hurrikan
Als Hurrikane werden tropische Wirbelstürme im Atlantik, Nordpazifik östlich von 180° Länge und im Südpazifik östlich von 160° Ost, im Karibischen Meer und im Golf von Mexiko bezeichnet, wenn sie eine maximale Mittelwindstärke von über 64 Knoten erreichen.
| de | en | fr |
|---|---|---|
|
Wetterphänomene Hurrikan |
Weather phenomena Hurricane |
Phénomènes météorologiques Ouragan |
Medicane
Auf dem Mittelmeer werden gelegentlich Stürme beobachtet, die tropischen Wirbelstürmen ähneln.
Ein solcher Sturm wird auch Medicane genannt, eine Kombination aus den Ausdrücken Mediterranean Sea (englisch für Mittelmeer) und Hurricane (englisch für Hurrikan).
| de | en | fr |
|---|---|---|
|
Wetterphänomene Medicane |
Weather phenomena Mediterranean tropical-like cyclone |
Phénomènes météorologiques Cyclone subtropical méditerranéen |
Taifun
Als Taifune werden tropische Wirbelstürme in Ost- und Südostasien sowie im nordwestlichen Teil des Pazifischen Ozeans, westlich der internationalen Datumsgrenze und nördlich des Äquators bezeichnet.
| de | en | fr |
|---|---|---|
|
Wetterphänomene Taifun |
Weather phenomena Typhoon |
Phénomènes météorologiques Typhon |
Zyklon
Ein Zyklon ist ein heftiger Wirbelsturm im Indischen Ozean und im südlichen Pazifischen Ozean, genauer im Golf von Bengalen und im Arabischen Meer.
Auch die im Indischen Ozean südlich des Äquators vorkommenden heftigen Wirbelstürme im Bereich von Mauritius, La Réunion, Madagaskar und der afrikanischen Ostküste sowie in der australischen Region werden als Zyklone bezeichnet.
Die Einstufung eines tropischen Wirbelsturms in verschiedene Stärken erfolgt über die Saffir-Simpson-Skala, die allerdings nur für den Atlantik sowie den Nordpazifik östlich der Datumsgrenze gilt.
| de | en | fr |
|---|---|---|
|
Wetterphänomene Zyklon |
Weather phenomena Cyclone |
Phénomènes météorologiques Cyclone |
⇧ de Text en Text fr Texte
⇧ 2016
↑ AWI: Ostküsten Südafrikas, Asiens, Australiens und Südamerikas werden vielleicht stürmischer
-
Die kalte Sonne (Fritz Vahrenholt & Sebastian Lüning)
2016-07-25 de AWI: Ostküsten Südafrikas, Asiens, Australiens und Südamerikas werden vielleicht stürmischerDas Alfred-Wegener-Institut (AWI) gab am 28. Juni 2016 im Rahmen einer Pressemitteilung bekannt, dass man in Zukunft an den Ostküsten Südafrikas, Asiens, Australiens und Südamerikas mit mehr Stürmen zu rechnen habe.
Die gute Nachricht: Europa ist nicht betroffen
⇧ 2015
↑ Schwerer Wirbelsturm verwüstet Vanuatu. Premierminister sieht es realistisch: "Stürme sind kein neues Phänomen, wir Insulaner leider darunter seit Besiedelung Vanuatus vor 5000 Jahren"
-
Die kalte Sonne (Fritz Vahrenholt & Sebastian Lüning)
2015-04-09 de Schwerer Wirbelsturm verwüstet Vanuatu. Premierminister sieht es realistisch: "Stürme sind kein neues Phänomen, wir Insulaner leider darunter seit Besiedelung Vanuatus vor 5000 Jahren"
⇧ 2014
↑ Neue Arbeit in Nature: Noch nie waren die australischen Wirbelstürme in den letzten 1500 Jahren schwächer als heute
-
Die kalte Sonne (Fritz Vahrenholt & Sebastian Lüning)
2014-04-03 de Neue Arbeit in Nature: Noch nie waren die australischen Wirbelstürme in den letzten 1500 Jahren schwächer als heute
⇧ 2013
↑
Vorindustrielle Zeit war verrückter als gedacht:
Tropische Wirbelstürme in den letzten 5000 Jahren weltweit auf
wilder Achterbahnfahrt.
Außerdem: Eine weitere Arbeit sagt Abnahme der tropischen
Wirbelsturmtätigkeit vorher
-
Die kalte Sonne (Fritz Vahrenholt & Sebastian Lüning)
2013-10-18 de Vorindustrielle Zeit war verrückter als gedacht: Tropische Wirbelstürme in den letzten 5000 Jahren weltweit auf wilder Achterbahnfahrt. Außerdem: Eine weitere Arbeit sagt Abnahme der tropischen Wirbelsturmtätigkeit vorher
↑ Die Süddeutsche Zeitung will mehr Sturm, doch die Natur weigert sich standhaft
-
Die kalte Sonne (Fritz Vahrenholt & Sebastian Lüning)
2013-05-31 de Die Süddeutsche Zeitung will mehr Sturm, doch die Natur weigert sich standhaft
↑ Studie der Universität Utrecht: Keine Zunahme der tropischen Wirbelstürme im australischen Queensland während der letzten 200 Jahre
-
Die kalte Sonne (Fritz Vahrenholt & Sebastian Lüning)
2013-12-22 de Studie der Universität Utrecht: Keine Zunahme der tropischen Wirbelstürme im australischen Queensland während der letzten 200 Jahre
⇧ 2012
↑ Björn Lomborg: Wirbelstürme lassen sich nicht durch Senkung der CO2-Emissionen bändigen
-
Die kalte Sonne (Fritz Vahrenholt & Sebastian Lüning)
2012-12-17 de Björn Lomborg: Wirbelstürme lassen sich nicht durch Senkung der CO2-Emissionen bändigen
↑ Neue Klimamodellierung findet langfristige Abnahme der Hurrikan-Häufigkeit
-
Die kalte Sonne (Fritz Vahrenholt & Sebastian Lüning)
2012-11-23 de Neue Klimamodellierung findet langfristige Abnahme der Hurrikan-Häufigkeit
↑ Hurrikanen scheint die Erwärmung egal zu sein: Keine Zunahme der tropischen Wirbelstürme in den letzten Jahrzehnten
-
Die kalte Sonne (Fritz Vahrenholt & Sebastian Lüning)
2012-08-01 de Hurrikanen scheint die Erwärmung egal zu sein: Keine Zunahme der tropischen Wirbelstürme in den letzten Jahrzehnten
⇧ 2011
↑ Tropical Storm Activity Hits A 40-Year Low - Possibly "Unprecedented"!
![]()
![]() Global Tropical Storms and Hurricanes
Global Tropical Storms and Hurricanes
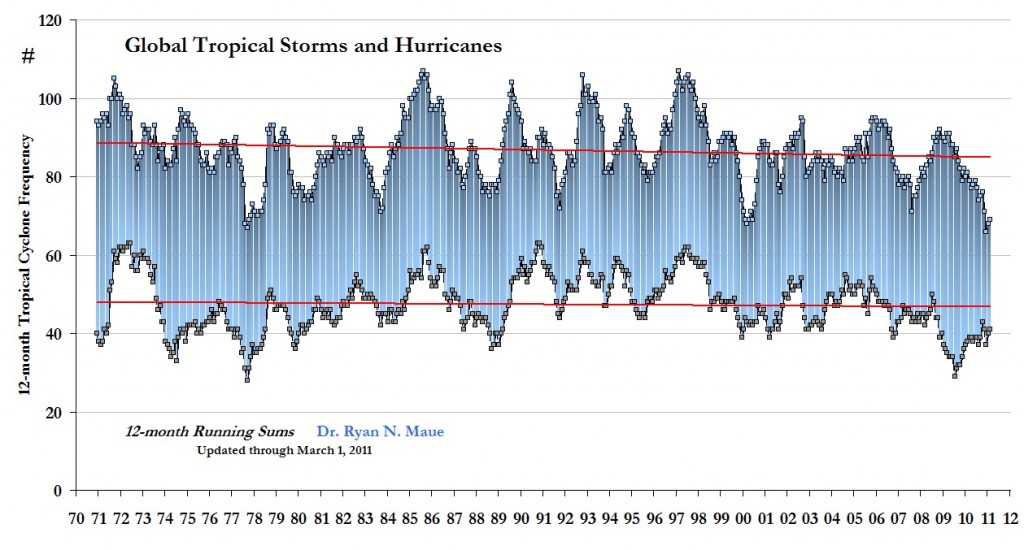
-
NoTricksZone (P Gosselin )
2011-03-21 en Tropical Storm Activity Hits A 40-Year Low - Possibly "Unprecedented"!
⇧
22 Hurrikan
en Hurricane
fr Ouragan
Mit folgenden Links wird von anderen Webseiten auf diese Seite verwiesen:
| de | en | fr |
|---|---|---|
|
Wetterphänomene Hurrikan |
Weather phenomena Hurricane |
Phénomènes météorologiques Ouragan |
⇧ de Verzeichnis en Contents fr Sommaire
- de
Hurrikane in der Vergangenheit
en History of Tropical Cyclones
fr Cyclones tropicals dans le passé - 2018
- de
Hurrikanaktivität hat während der vergangenen 65 Jahre
abgenommen
en An Energetic Perspective on United States Tropical Cyclone Landfall Droughts
en An Overview of Current Research Results - 2017
- de
Es reicht! Hört auf, Harvey und Irma auszuschlachten!
en Enough is Enough! Stop hyping Harvey and Irma! - en
Correlation of Accumulated Cyclone Energy and Atlantic Multidecadal
Oscillations
Mittelfristig lässt sich die Hurrikanaktivität ganz gut vorhersagen, denn sie ist eng an den AMO-Ozeanzyklus gekoppelt, die Atlantische Multidekadenoszillation, die eine Periodizität von 60 Jahren besitzt. - de Flut in Houston: Das menschengemachte Desaster
- en
CFAN's forecast for the 2017 Atlantic hurricane season
Wenn das auch im nächsten Jahr so gut klappt, dann gäbe es eine wichtige neue Vorhersagemethode, die für die Gesellschaft zwecks Vorsorge überaus nützlich wäre. - de Hurrikan-Gefahr an der US-Atlantikküste war während der Mittelalterlichen Wärmephase besonders hoch
- 2016
- de Neue Prognose auf Basis der natürlichen Ozeanzyklik: Hurrikanflaute an der US-Ostküste setzt sich vermutlich noch mindestens zwei Jahrzehnte fort
- 2015
- de Häufigkeiten der Hurrikane und Taifune seit 1990
- en University of Southampton: Kühlender Ozeanzyklus lässt Atlantik in den kommenden Jahrzehnten um ein halbes Grad abkühlen, globaler Erwärmungshiatus setzt sich fort und Hurrikane werden seltener
- en Predicting which African storms will intensify into hurricanes
- 2014
- de Wer hätte das gedacht: Weibliche Hurrikane fordern mehr Opfer als männliche
- 2013
- de Wie der New Yorker Hurrikan Sandy zum Wahlhelfer von Barack Obama wurde: Rückblick zum ersten Jahrestag eines ganz normalen Sturms
- de Studien der letzten Jahre zeigen: Häufigkeit von Hurrikanen eng an Ozeanzyklen und El Nino gekoppelt
- de Hurrikane halten sich nicht an die NOAA-Prognose einer "besonders sturmreichen Saison": 2013 entpuppt sich als sechst-schwächstes atlantisches Hurrikanjahr seit 1950
- de Studie in Nature Climate Change: Keine signifkante Veränderung der Sturmhäufigkeit in den USA während der vergangenen 100 Jahre
- de Neue geologische Studie schafft überraschenden Kontext: Heutige Hurrikanaktivität in Florida eher unterdurchschnittlich ausgeprägt
- de Natürliche Variabilität: Wirbelstürme an der mexikanischen Pazifikküste pusteten im Takt des solaren Schwabe-Zyklus
- 2012
- de Björn Lomborg: Wirbelstürme lassen sich nicht durch Senkung der CO2-Emissionen bändigen
- en Global accumulated cyclone energy
-
de
Neue Klimamodellierung findet langfristige Abnahme der
Hurrikan-Häufigkeit
en Decreasing trend of tropical cyclone frequency in 228-year high-resolution AGCM simulations - en Normalized US Hurricane Damage 1900-2012, Including Sandy
- en Historical Storm Surges, South Rhode Island
- de
Ein unerwarteter Rekord: Noch nie mussten die Vereinigten Staaten
während der letzten 100 Jahre so lange auf einen starken Hurrikan
warten!
Vorhersage für die Atlantische Hurrikansaison 2012: Die Hurrikan-Flaute hält wohl weiter an - de
Die atlantische Hurrikan-Aktivität (ACE) der vergangenen 60 Jahre
verlief parallel zur Entwicklung der Atlantisch Multidekaden
Oszillation (AMO)
Munich Re rührt wieder kräftig die Werbetrommel für Sturm- und Dürreversicherungen
- en Hurricane drought days at an all time high - Katrina Karma?
- en Vorhersage für die Atlantische Hurrikansaison 2012: Die Hurrikan-Flaute hält wohl weiter an
- 2011
- en Tropical Storm Activity Hits A 40-Year Low - Possibly "Unprecedented"!
- 2010
- de Weltklimarat gerät erneut ins Zwielicht
- de Weitere IPCC-Behauptung in Frage - Globale Hurrikan-Aktivität ist nicht gestiegen
- en Now IPCC hurricane data is questioned
- en IPCC Gate Du Jour - now IPCC hurricane data questioned
- en WMO: "... we cannot at this time conclusively identify anthropogenic signals in past tropical cyclone data."
- 2009
- de
Wo sind die Hurrikane, Mr. Gore?
en Where are the Hurricanes, Mr. Gore? - de Atlantische Wirbelstürme: Ein Beitrag von Dipl.-Meteorologen Klaus-Eckart Puls, sowie die erstaunliche Wandlung des US-Klimaforschers Michael Mann
- de Viel Wind um Nichts!
- en Employment slump at NHC
- en Global hurricane activity has decreased to the lowest level in 30 years
- 2008
- en Increased hurricanes to global warming link: blown away
- en
 Climate Change & Hurricane frequency
Climate Change & Hurricane frequency
Stan Goldenberg from the Hurricane centre in Florida explains the facts and issues of hurricane frequency in the climate change debate. - en
NOAA: Warm Seas May Mean Fewer Hurricanes
de Weniger Hurrikane bei wärmeren Meeren
en Warm Seas May Mean Fewer Hurricanes
fr Les ouragans intenses prospèrent dans une mer froide - 2007
- de Les ouragans intenses prospèrent dans une mer froide
- 2006
- en
 Inconvenient Truths for Al Gore - Hurricane Catarina
Inconvenient Truths for Al Gore - Hurricane Catarina
Marlo Lewis explains the flaws in Al Gore's "An Inconvenient Truth." - en Atlantic Hurricanes
- de Hurrikan-Saison 2006: Prognose war völlig falsch
- fr Autres calamités qui devraient s'amplifier, dit-on, mais qui ne le font pas : Les ouragans !
⇧ Welt-Info
|
|
Stürme / Storm / Tempête |
| ▷Die Kalte Sonne Blog‑Themen Vahrenholt/Lüning ▶Die kalte Sonne | de ▷Stürme |
| EIKE | de Hurrikan, Taifun. |
| WUWT | en Tornado Page, Tropical Cyclone Page |
| NoTricksZone | en Hurricanes / Tornados |
| Popular Technology | en Hurricanes, Storms, Tornadoes. |
| Wikipedia |
de
Meeresspiegel en Sea level fr Niveau de la mer |
| Vademecum |
▶Wintersturm
▶Welt-Info |
| Siehe auch | ▶Extremwetter |
|
|
|
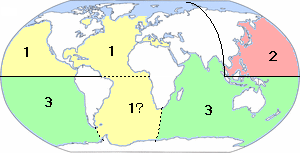
|
1 Hurrikan (Orkan) |
| de | en | fr |
|---|---|---|
| Wetterphänomene (Teil 2) | Weather phenomena (Part 2) | Phénomènes météorologiques (partie 2) |
| Sturm (Wintersturm) | Storm | Tempête |
| Tropischer Wirbelsturm | Tropical cyclone | Cyclone tropical |
| Hurrikan | Hurricane | Ouragan (Cyclone tropical) |
| Medicane | Mediterranean tropical-like cyclone | Cyclone subtropical méditerranéen |
| Taifun | Typhoon | Typhon |
| Tornado | Tornado | Tornade |
| Zyklon | Cyclone | Cyclone |
| Sturmflut | Storm surge | Onde de tempête |
| Blizzard | Blizzard | Blizzard (météorologie) |
| Wind | Wind | Vent |
| Jetstream | Jet stream | Courant-jet |
| Monsun | Monsoon | Mousson |
| Blockierte Wetterlagen | Block (meteorology) | Blocage (météorologie) |
⇧ de Allgemein en General fr Générale
-
Wikipedia de
Hurrikan
en Atlantic hurricane
fr -
- Wikipedia fr Cyclone tropical
⇧ de Text en Text fr Texte
↑
Hurrikane in der Vergangenheit
en History of Tropical Cyclones
fr Cyclones tropicals dans le passé
|
|
1565 1640 1666 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1893 |
1890er Jahre: Schwere Zeiten für die US-Ostküste Auch vor rund 120 Jahren war die Ostküste der USA nicht vor schweren Stürmen gefeit. Besonders stürmisch ging es in den 90er Jahren des 19. Jahrhunderts zu. Vier große Hurrikane trafen die Küste vom US-Bundesstaat Georgia und weiter nördlich. Darunter 1893 der Kategorie 3 Sea Islands Hurrikan in Georgia und South Carolina, im selben Jahr ein weiterer Kategorie 3 Hurrikan der South- und North-Carolina traf sowie 1898 ein Kategorie 4 Hurrikan wieder in Georgia und ein Jahr später, 1899, ein Kategorie 3 Hurrikan in North-Carolina. Diese Dekade war für die Ostküste der Vereinigten Staaten die zweit schwerste seit regelmäßiger Wetteraufzeichnungen und wurde nur von dem Sturmjahrzehnt der 1950er Jahre übertroffen. ( Quelle) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1954 |
Die 1950er Jahre: Eine Hurrikan-Jahrzent für die US-Ostküste Die 1950er Jahre waren für die US-Ostküste ein stürmisches Zeitalter,
1954: Der tödlichste war wohl Hurrikan Hazel. Auf seinem Weg tötete der Sturm der Kategorie 5 über 1000 Menschen in Haiti. Doch auch in den USA fielen dem Hurrikan immer noch knapp 100 Menschen zum Opfer. Die Gesamtschäden wurden mit rund 420 Millionen US-Dollar beziffert. ( Quelle) 1955: Eine Hurrikantrilogie 1955, nur ein Jahr später, trafen gleich drei Hurrikane hintereinander auf die US-Ostküste: Besonders in North-Carolina sorgten die Stürme Connie, Diane und Ione für schwere Überschwemmungen und forderten insgesamt rund 240 Menschenleben.
1960: Große Ausdauer zeigte der Hurrikan
Donna. Er gilt bis heute als einer der Hurrikane, der seine Stärke am längsten aufrecht erhalten konnte. Der Sturm wütete 17 Tage lang vom 29. August bis 14. September 1960 und hinterließ von den karibischen Inseln Kuba oder Hispaniola (Haiti/Dominikanische Republik) bis zum südlichen Quebec in Kanada eine Spur der Verwüstung. Teilweise erreichte der Sturm eine Stärke der Kategorie 5. Noch in Long Island hatte er Hurrikanstärke 1. Donna forderte nach ungenauen Schätzungen bis zu 370 Menschenleben und verursachte rund 900 Millionen US-Dollar Schaden. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2005 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2012 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datenquellen
-
NOAA National Weather Service / National Hurricane Center
en Home
en U.S. Hurricane Strikes by Decade
en NHC Data Archive
en Past Track Maps of U.S. Landfalling Major Hurricanes
-
WEST ISLAND WEATHER STATION
en Home
en Hurricane Photo Books
-
Roger A. Pielke Jr.; Joel Gratz; Christopher W. Landsea; Douglas Collins; Mark A. Saunders; and Rade Musulin
2008-02 en Normalized Hurricane Damage in the United States: 1900-2005
Normalized Hurricane Damage in the United States: 1900-2005
-
Nachrichtenpolizei
2012-10-31 de Sandy entzaubert: Historie schwerer Hurrikane an der Ostküste der USA
-
Die kalte Sonne
2013-11-18 de Klimaaktivisten missbrauchen Taifun Haiyan für eigene Zwecke: Studien fanden für die vergangenen Jahrzehnte keine Zunahme der Taifunaktivität
⇧ 2018
↑
Hurrikanaktivität hat während der vergangenen 65 Jahre abgenommen
en
An Energetic Perspective on United States Tropical Cyclone
Landfall Droughts
en
An Overview of Current Research Results
-
Die kalte Sonne (Fritz Vahrenholt & Sebastian Lüning)
2018-02-05 de Hurrikanaktivität hat während der vergangenen 65 Jahre abgenommenDie Hurrikansaison ist erstmal vorbei.
Das bietet eine gute Gelegenheit, unaufgeregt in die Fachliteratur hineinszuschauen.
Was gibt es Neues?
Am 8. Dezember 2017 erschien in den Geophysical Research Letters eine Arbeit von Ryan Truchelut und Erica Staehling.
Sie untersuchten die Entwicklung der nordamerikanischen Hurrikane auf Basis der sogenannten "angehäuften Zyklonenergie" (accumulated cyclone energy, ACE).
Die Forscher fanden eine statistisch signifikante Abnahme der Hurrikanaktivität während der vergangenen 65 Jahre.
Die Hurrikanflaute der letzten Jahre (mit Ausnahme des sehr aktiven Jahres 2017) stellte dabei die inaktivste Phase des gesamten Untersuchungszeitraums dar. Abstract:
Geophysical Research Letters
2017-12-08 en An Energetic Perspective on United States Tropical Cyclone Landfall DroughtsAbstract:
An Energetic Perspective on United States Tropical Cyclone Landfall Droughts.
The extremely active 2017 Atlantic hurricane season concluded an extended period of quiescent continental United States tropical cyclone landfall activity that began in 2006, commonly referred to as the landfall drought.
We introduce an extended climatology of U.S. tropical cyclone activity based on accumulated cyclone energy (ACE) and use this data set to investigate variability and trends in landfall activity.
The drought years between 2006 and 2016 recorded an average value of total annual ACE over the U.S. that was less than 60% of the 1900-2017 average.
Scaling this landfall activity metric by basin-wide activity reveals a statistically significant downward trend since 1950, with the percentage of total Atlantic ACE expended over the continental U.S. at a series minimum during the recent drought period.
Das CO2 in der Atmosphäre steigt unablässig, die Hurrikanaktivität sinkt.
Offenbar haben die beiden Trends wenig miteinander zu tun.
Angesichts der klaren Faktenlage wundert es nicht, dass die NOAA (über das Geophysical Fluid Dynamics Laboratory, GFDL) in einem offiziellen Statement vor einer Verknüpfung von Treibhausgasen und Hurrikanen dringend warnt:
NOAA/GFDL
2018-01-24 en An Overview of Current Research ResultsIt is premature to conclude that human activities - and particularly greenhouse gas emissions that cause global warming - have already had a detectable impact on Atlantic hurricane or global tropical cyclone activity.
That said, human activities may have already caused changes that are not yet detectable due to the small magnitude of the changes or observational limitations, or are not yet confidently modeled (e.g., aerosol effects on regional climate).
In Potsdam nimmt man es mit den Fakten nicht ganz so genau.
Hauptsache schrill.
Anlässlich des Hurrikan Harvey trat Anders Levermann in einem Rundfunkinterview am 1.9.2017 bei Radio Eins auf.
Dort sagte er:
Wenn es wärmer wird kommt mehr Wasserdampf in die Atmosphäre und es gibt mehr Regen und dann passiert so ein Hurrikan mit Flutkatastrophe in Houston.
Radio Eins
2017-09-01 en Hurrikan "Irma" verwüstet KaribikinselnGanz einfach, oder?
Etwas später im Interview fügt Levermann übrigens noch ein "vielleicht" hinzu.
Was Levermann hier macht ist eine schlimme Irreführung der Hörer, denn die Abnahme der Hurrikanaktivität während der letzten 65 Jahre spricht eindeutig gegen den simplistischen Ansatz.
Wer da mal so einfach behauptet, dass ein (gewisser..welcher?) Teil des Desasters dem menschgemachten Klimawandel zuzuschreiben ist und auch die Freud'sche Fehlleistung eines relativierenden "vielleicht" korrigiert, macht es sich viel zu einfach.
Der Versprecher offenbart übrigens, dass Levermann es besser weiß.
Das "vielleicht" war nur kontraproduktiv für die Propagandamission.
Alle Katastrophen müssen zwanghaft dem menschgemachten Klimawandel zugewiesen werden.
Ein "vielleicht" stört da nur.
Die Auflösung der Frage wo das Problem in Houston lag, findet man übrigens auch im Artikel von BBC:
"Climate change did not make people build along a vulnerable coastline so the disaster itself is our choice and is not linked to climate change."
Bei der BBC geht man seriöser an die Sache und verschweigt die Komplexität nicht.
BBC
2017-08-29 en Hurricane Harvey: The link to climate changeGerade die Verbindung von Hurrikanen und Klimawandel ist sehr schwierig herzustellen denn es gibt viele Effekte die zu beachten sind.
Neben den thermodynamischen kommen strömungstechnische hinzu und die Zuweisung des Ereignisses zum Klimawandel ist kaum möglich da sich die beteiligten Faktoren verstärken oder auslöschen können.
Eine genügend auflösende Modellierung ist auch nicht möglich.
In Houston kam eine blockierende Wetterlage hinzu, sie bewirkte das lange Verharren des Regens über einem kleinen städtischen Raum.
Auch bei der ARD ist man vorsichtig geworden.
Der TV-Meteorologe Donald Bäcker erteilte den Postdamer Schnellschüssen eine klare Absage.
NoTricksZone (Pierre L. Gosselin)
2017-09-22 en German ARD Meteorologist: "Can't Blame Climate Change" For This Year's Hurricanes... "Many Factors"Last Tuesday morning German flagship ARD public television meteorologist Donald Bäcker surprised some climate-realist viewers here with a very level-headed look at the factors behind hurricane development.
Im Juni 2017, zu Beginn der Hurrikansaison, veröffentlichten Judith Curry und CFAN eine Prognose.
Darin gingen sie von einer überdurchschnittlichen Aktivität aus.
Sie hatten Recht.
Wenn das auch im nächsten Jahr so gut klappt, dann gäbe es eine wichtige neue Vorhersagemethode, die für die Gesellschaft zwecks Vorsorge überaus nützlich wäre.
-
Climate Etc. / Judith Curry
2017-06-08 en CFAN's forecast for the 2017 Atlantic hurricane seasonClimate Forecast Applications Network (CFAN)'s first seasonal forecast for Atlantic hurricanes is based on a breakthrough in understanding of the impact of global climate dynamics on Atlantic hurricane activity.
Research conducted by Senior Scientist Jim Johnstone at my company Climate Forecast Applications Network (CFAN) has identified skillful new predictors for seasonal Atlantic Accumulated Cyclone Energy (ACE) and the number of U.S. landfalling hurricanes.
CFAN's prediction for the 2017 Atlantic hurricane season:
ACE: 134 (average value 103 since 1982)
# of U.S. landfalling hurricanes: 3 (average value 1.7 since 1900)
CFAN's research team has long-standing expertise in climate dynamics and tropical meteorology research and in developing operational forecasts of tropical cyclones on timescales from 1-30 days. This seasonal forecast reflects the first time that this expertise has been integrated into a seasonal prediction of Atlantic hurricane activity.
Noch mehr Prognosen:
Hurrikane haben einen gewissen Vorlauf.
Auf Satellitenbildern kann man die Entstehung der Stürme vor Westafrika verfolgen.
Aber nicht alle afrikanischen Babyhurrikane schaffen es über den Atlantik nach Amerika.
Die Tel Aviv University hat jetzt ein Modell entwickelt, mit dem man bestimmen kann, welche Stürme gefährlich und welche sich auflösen werden.
Pressemitteilung:
-
ScienceDaily
2015-03-12 en Predicting which African storms will intensify into hurricanesSummary
Most hurricanes over the Atlantic that eventually make landfall in North America actually start as intense thunderstorms in Western Africa one or two weeks earlier, research indicates.
This research may help cities and towns better prepare for these hurricanes with far more warning.
Hurricanes require moisture, the rotation of Earth, and warm ocean temperatures to grow from a mere atmospheric disturbance into a tropical storm.
But where do these storm cells originate, and exactly what makes an atmospheric disturbance amp up full throttle?
A new study published in Geophysical Research Letters by Tel Aviv University's Prof. Colin Price and his graduate student Naama Reicher of the Department of Geosciences at TAU's Faculty of Exact Sciences finds most hurricanes over the Atlantic that eventually make landfall in North America actually start as intense thunderstorms in Western Africa.
"85 percent of the most intense hurricanes affecting the U.S. and Canada start off as disturbances in the atmosphere over Western Africa," says Prof. Price.
"We found that the larger the area covered by the disturbances, the higher the chance they would develop into hurricanes only one to two weeks later."
Mittelfristig lässt sich die Hurrikanaktivität ganz gut vorhersagen, denn sie ist eng an den AMO-Ozeanzyklus gekoppelt, die Atlantische Multidekadenoszillation, die eine Periodizität von 60 Jahren besitzt.
Michel de Rougemont erinnerte daran in einem Aufsatz in WUWT.
-
Watts UP With That? (Antony Watts) / Michel de Rougemont
2017-09-04 en Correlation of Accumulated Cyclone Energy and Atlantic Multidecadal OscillationsVarious sources, scientists publishing their opinion in the media, claim that Tropical Storm Harvey, recently landed in Texas, is one more signal of the influence of global warming on such catastrophic events.
These claims are based on model calculations.
Let's examine the facts.

 In the Atlantic Ocean, sea surface temperature oscillations are
observed as a multidecadal cycle (AMO).
In the Atlantic Ocean, sea surface temperature oscillations are
observed as a multidecadal cycle (AMO).


 The total energy accumulated each year by tropical storms and
hurricanes (ACE) is also showing such a cyclic pattern.
The total energy accumulated each year by tropical storms and
hurricanes (ACE) is also showing such a cyclic pattern.


 A correlation between ACE and AMO is confirmed by regression
analysis.
A correlation between ACE and AMO is confirmed by regression
analysis.

In der FAZ wies Winand von Petersdorff am 31. August 2017 auf einen wichtigen Schadensfaktor von Hurrikan Harvey hin:
-
Frankfurter Allgemeine Zeitung / Winand Von Petersdorf
2017-08-17 de Flut in Houston: Das menschengemachte DesasterFlut in Houston: Das menschengemachte Desaster
Der Großraum Houston boomt seit Jahren.
Der Preis: Viele Häuser entstanden in klassischem Hochwassergebiet.
Das Risiko dafür trägt der amerikanische Steuerzahler. [...]
Die gewaltigen Kosten entstehen vor allem, weil der seit Jahren boomende Großraum Houston mit seinen 6,5 Millionen Menschen im großen Stil Bebauungen in Niederungen zugelassen hat, die regelmäßig von Überflutungen und Hochwasser heimgesucht werden.
Nicht umsonst ist Houston für seine liberale Baugesetzgebung im ganzen Land bekannt.
Die Bebauungen, des Seeblicks wegen oft rund um kleine Buchten errichtet, produzieren gleich mehrere Probleme.
Die Häuser werden häufiger als üblich von Naturkatastrophen getroffen.
-
⇧ 2017
↑
Es reicht! Hört auf, Harvey und Irma auszuschlachten!
en
Enough is Enough! Stop hyping Harvey and Irma!
-
EIKE Europäisches Institut für Klima und Energie
Dr. Neil Frank, ehemaliger Direktor des National Hurricane Center / Chris Frey
2017-09-28 de Es reicht! Hört auf, Harvey und Irma auszuschlachten!Während der letzten Wochen seit deren Auftreten waren zahlreiche Artikel erschienen des Inhalts, dass Harvey und Irma die Folge der globalen Erwärmung seien.
Getreu dem Konzept, dass sich auf einer wärmeren Erde stärkere und regenreichere Hurrikane entwickeln.
Eine ganze Reihe von Leuten hat gesagt, dass Irma der stärkste Hurrikan jemals war in der Historie des Atlantiks, während Harvey der regenreichste war; und dass beide exemplarische Beispiele dafür sind, was wir in Zukunft aufgrund der globalen Erwärmung erwarten können.
Was aber ergibt ein Faktencheck hinsichtlich dieser beiden Hurrikane?
Schlussfolgernd lässt sich sagen, dass die Hurrikane Harvey und Irma typische starke atlantische Hurrikane waren.
Beide entwickelten sich aus aus Afrika auf den Atlantik hinaus ziehende Störungen während des Höhepunktes der Hurrikan-Saison.
Die Stärke von Irma, wie sie sich aus dem Kerndruck ergibt, war konsistent mit einer ganzen Reihe anderer Hurrikane in der Vergangenheit.
Der starke Regen im Zuge von Harvey war die Folge des zum Stehen gekommenen Sturmes und nicht die Folge einer höheren atmosphärischen Feuchtigkeit in Assoziation mit globaler Erwärmung.
Es gibt nichts an diesen beiden Hurrikanen, was die Dringlichkeit sofortiger Maßnahmen zur Begrenzung der globalen Erwärmung rechtfertigen würde.
Es ist traurig, dass jene, die diese Maßnahmen fordern und unterstützen, so brutal und rücksichtslos gegen die zerrissenen Gefühle hunderttausender Menschen in Texas, Louisiana und Florida sind, haben diese doch soeben alptraumhafte Verluste erlitten - und jetzt werden sie für die Hurrikane verantwortlich gemacht, weil sie nicht die Maßnahmen zur Reduktion von CO2 unterstützt haben.
Da wir gerade von CO2 sprechen, es gibt eine intensive Debatte über die Gründe der Erwärmung der Erde.
Diese erwärmt sich seit über 150 Jahren, das ist unstrittig.
Strittig ist die Ursache. Ist CO2 für das "Wärmste" verantwortlich, oder sind es andere natürliche Zyklen?
Solarexperten in Asien, dem Nahen Osten und Teilen von Europa sehen die Sonne als Ursache.
Während der letzten dreieinhalb Jahre haben sie über 400 Studien veröffentlicht, die das CO2 als Ursache verwerfen und stattdessen natürliche Zyklen der Sonne anführen.
Falls dies so ist, warum gibt es dann den intensiven Druck, Milliarden über Milliarden Dollar für grüne Energie aufzuwenden? [Von den verheerenden Umweltschäden ganz zu schweigen. Anm. d. Übers.]
Zu was will sie das "Wärmste" also bringen?
Zuerst und am dringlichsten fordern sie, dem Pariser Klima-Abkommen vom Dezember 2015 zu folgen, dem 194 Länder zugestimmt haben.
Präsident Trump hat die USA aus diesem Abkommen zurückgezogen, und das "Wärmste" schäumt vor Wut.
Das ausdrückliche Ziel des Abkommens ist es, CO2 zu reduzieren und grüne Energie zu entwickeln.
Eines der Ziele des Abkommens ist die Einrichtung eines Green Climate Fund, dessen Gelder an Entwicklungsländer verteilt werden sollen, um diesen beim Übergang zu grüner Energie zu helfen.
Es ist beabsichtigt, bis zum Jahr 2020 100 Milliarden Dollar in diesem Fund zu haben.
Woher soll das Geld kommen?
Etwa 45 Nationen waren als Geldgeber ausersehen, was bedeutet, dass es rund 150 Empfängernationen gibt, darunter auch China.
Auf dem Pariser Treffen versprachen die Gebernationen 10 Milliarden Dollar, wovon über 80% aus 6 Nationen kommen sollten: England, Deutschland, Frankreich, Schweden, Japan und die USA.
Die USA versprachen den größten Betrag mit 3,5 Milliarden Dollar, die anderen 5 Länder jeweils zwischen 1 und 1,5 Milliarden Dollar.
Bis heute haben die USA 1 Milliarden Dollar als Anzahlung an die UN überwiesen, die anderen 5 Nationen jeweils rund 0,5 Milliarden Dollar.
Die UN hat 156 Mitarbeiter eingestellt, um den Plan zu überwachen. Jährliche Lohnkosten: 29 Millionen Dollar.
Und das ist erst der Anfang.
Christiana Figueires, Leiterin der Pariser Konferenz, sagte kürzlich, dass der Plan während der nächsten 3 Jahre über 1,5 Billionen kosten würde, falls jede Nation dem Programm folgt.
Sollte Präsident Trump wirklich seine Entscheidung widerrufen und die USA erneut in das Paris-Abkommen einfügen, würden wir den UN unserem Versprechen folgend augenblicklich 2,5 Milliarden Dollar schulden.
Da wäre es höchstwahrscheinlich besser, mit diesem Geld den 150.000 Menschen zu helfen, deren Wohnungen in SE-Texas im Zuge von Harvey weggespült worden sind.
Noch eine letzte Anmerkung.
Was ist der wirkliche Grund für das Paris-Abkommen?
Eine der aufschlussreichsten Bemerkungen, die ich gesehen habe, stammt von einem führenden UN-Funktionär.
Ottmar Edenhofer sagte: "De facto verteilen wir den Wohlstand der Welt völlig neu. Man muss sich von der Illusion freimachen, dass internationale Klimapolitik Umweltpolitik ist".
Mit anderen Worten, es handelt sich um ein internationales Programm zur Umverteilung von Wohlstand. Wessen Wohlstand? Unser Wohlstand!
-
Watts UP With That? (Antony Watts)
Dr. Neil Frank, former Director National Hurricane Center
2017-09-25 en Enough is Enough! Stop hyping Harvey and Irma!Over the past several weeks numerous articles suggest Harvey and Irma were the result of global warming.
The concept is a warmer earth will generate stronger and wetter hurricanes.
A number of people have said Irma was the most intense hurricane in the history of the Atlantic while Harvey was the wettest and both were good examples of what we can expect in the future because of global warming.
What does a fact check reveal about these two hurricanes?
In conclusion, Harvey and Irma were typical intense Atlantic hurricanes.
They both developed from African disturbances during the peak of the hurricane season.
The strength of Irma as determined by central pressure was consistent with a number of other past intense hurricanes.
The heavy rain in Harvey was the result of a stalled hurricane and was not caused by increased atmospheric moisture associated with global warming.
There was nothing identifiable with these two hurricanes that would justify an urgent request to support actions that would limit global warming.
It is sad that those promoting these actions are so insensitive to the shredded emotions of hundreds of thousands of people in Texas, Louisiana and Florida who have just experienced nightmarish losses and now they are being blamed for causing the hurricanes because they did not support actions to reduce CO2.
Speaking of CO2, there is a very intense controversy over what is causing the earth to warm.
The earth has been warming for over 150 years.
That is not debatable.
What is debatable is the cause.
Is it CO2 as "warmest" proclaim or other natural cycles?
Solar experts in Asia, the Middle East and parts of Europe believe it is the sun.
Over the past 3 1/2 years they have published over 400 papers that discredit CO2 and support natural cycles of the sun.
If this is true, why is there intense pressure to spend billions and billions of dollars on green energy?
So what do "warmest" want you to do?
First and foremost they demand you endorse the Paris Climate Accord made in December 2015 and agreed to by 194 countries.
President Trump withdrew from this agreement earlier this year and the "warmest" are livid.
The stated purpose of the plan is to reduce CO2 and develop Green Energy.
One of the objectives of the agreement is to establish a Green Climate Fund that will be distributed to developing nations to help them convert to green energy.
The goal is to have $100 billion in this fund by 2020.
Where is the money coming from?
Approximately 45 nations have been designated donor countries which means there will be about 150 receiver nations including China.
At the original Paris meeting donor nations pledged about $10 billion of which over 80% would come from 6 nations; England, Germany, France, Sweden, Japan and the U.S..
The U.S. made the biggest pledge of $3.5 billion with the other 5 nations pledging between $1 and $1.5 billion each.
To date the U.S. has sent $1 billion to the U.N. as a down payment on our pledge and the other 5 nations around $1/2 billion each.
The U.N. has hired 156 employees to monitor the plan with an annual salary of $29 million.
This only the beginning.
Christiana Figueres, the U.N. Chairperson of the Paris Conference said recently the Paris plan will cost $1.5 trillion over the next 3 years if every nation complied with the program.
If President Trump were to reverse his decision and once again have the U.S. participate in the Paris Accord, we would immediately owe the U.N. $2.5 billion against our pledge.
Just maybe it would be better to take that money and help the 150,000 whose homes were flooded in SE Texas during Harvey.
One last comment, what is the real reason for the Paris Accord?
One of the most revealing statements I have seen comes from a top official in the U.N. climate change program.
Ottmar Odenhofer said "We redistribute de facto the world's wealth by climate policy. One has to free oneself from the illusion that international climate policy is environmental policy".
In other words, it an international program to redistribute wealth: Whose wealth? Our wealth!
↑ en Correlation of Accumulated Cyclone Energy and Atlantic Multidecadal Oscillations
Mittelfristig lässt sich die Hurrikanaktivität ganz gut vorhersagen, denn sie ist eng an den AMO-Ozeanzyklus gekoppelt, die Atlantische Multidekadenoszillation, die eine Periodizität von 60 Jahren besitzt.
Michel de Rougemont erinnerte daran in einem Aufsatz in WUWT.
-
Watts UP With That? (Antony Watts) / Michel de Rougemont
2017-09-04 en Correlation of Accumulated Cyclone Energy and Atlantic Multidecadal OscillationsVarious sources, scientists publishing their opinion in the media, claim that Tropical Storm Harvey, recently landed in Texas, is one more signal of the influence of global warming on such catastrophic events.
These claims are based on model calculations.
Let's examine the facts.

 In the Atlantic Ocean, sea surface temperature oscillations are
observed as a multidecadal cycle (AMO).
In the Atlantic Ocean, sea surface temperature oscillations are
observed as a multidecadal cycle (AMO).


 The total energy accumulated each year by tropical storms and
hurricanes (ACE) is also showing such a cyclic pattern.
The total energy accumulated each year by tropical storms and
hurricanes (ACE) is also showing such a cyclic pattern.


 A correlation between ACE and AMO is confirmed by regression
analysis.
A correlation between ACE and AMO is confirmed by regression
analysis.

↑ FLUT IN HOUSTON: Das menschengemachte Desaster
In der FAZ wies Winand von Petersdorff am 31. August 2017 auf einen wichtigen Schadensfaktor von Hurrikan Harvey hin:
-
Frankfurter Allgemeine Zeitung / Winand Von Petersdorf
2017-08-17 de Flut in Houston: Das menschengemachte DesasterFlut in Houston: Das menschengemachte Desaster
Der Großraum Houston boomt seit Jahren.
Der Preis: Viele Häuser entstanden in klassischem Hochwassergebiet.
Das Risiko dafür trägt der amerikanische Steuerzahler. [...]
Die gewaltigen Kosten entstehen vor allem, weil der seit Jahren boomende Großraum Houston mit seinen 6,5 Millionen Menschen im großen Stil Bebauungen in Niederungen zugelassen hat, die regelmäßig von Überflutungen und Hochwasser heimgesucht werden.
Nicht umsonst ist Houston für seine liberale Baugesetzgebung im ganzen Land bekannt.
Die Bebauungen, des Seeblicks wegen oft rund um kleine Buchten errichtet, produzieren gleich mehrere Probleme.
Die Häuser werden häufiger als üblich von Naturkatastrophen getroffen.
↑ en CFAN's forecast for the 2017 Atlantic hurricane season
Im Juni 2017, zu Beginn der Hurrikansaison, veröffentlichten Judith Curry und CFAN eine Prognose.
Darin gingen sie von einer überdurchschnittlichen Aktivität aus.
Sie hatten Recht.
Wenn das auch im nächsten Jahr so gut klappt, dann gäbe es eine wichtige neue Vorhersagemethode, die für die Gesellschaft zwecks Vorsorge überaus nützlich wäre.
-
Climate Etc. / Judith Curry
2017-06-08 en CFAN's forecast for the 2017 Atlantic hurricane seasonClimate Forecast Applications Network (CFAN)'s first seasonal forecast for Atlantic hurricanes is based on a breakthrough in understanding of the impact of global climate dynamics on Atlantic hurricane activity.
Research conducted by Senior Scientist Jim Johnstone at my company Climate Forecast Applications Network (CFAN) has identified skillful new predictors for seasonal Atlantic Accumulated Cyclone Energy (ACE) and the number of U.S. landfalling hurricanes.
CFAN's prediction for the 2017 Atlantic hurricane season:
ACE: 134 (average value 103 since 1982)
# of U.S. landfalling hurricanes: 3 (average value 1.7 since 1900)
CFAN's research team has long-standing expertise in climate dynamics and tropical meteorology research and in developing operational forecasts of tropical cyclones on timescales from 1-30 days. This seasonal forecast reflects the first time that this expertise has been integrated into a seasonal prediction of Atlantic hurricane activity.
↑ Hurrikan-Gefahr an der US-Atlantikküste war während der Mittelalterlichen Wärmephase besonders hoch
-
Die kalte Sonne (Fritz Vahrenholt & Sebastian Lüning)
2017-01-03 de Hurrikan-Gefahr an der US-Atlantikküste war während der Mittelalterlichen Wärmephase besonders hoch
⇧ 2016
↑ Neue Prognose auf Basis der natürlichen Ozeanzyklik: Hurrikanflaute an der US-Ostküste setzt sich vermutlich noch mindestens zwei Jahrzehnte fort
-
Die kalte Sonne (Fritz Vahrenholt & Sebastian Lüning)
2016-10-04 de Neue Prognose auf Basis der natürlichen Ozeanzyklik: Hurrikanflaute an der US-Ostküste setzt sich vermutlich noch mindestens zwei Jahrzehnte fort
⇧ 2015
↑ Häufigkeiten der Hurrikane und Taifune seit 1990
- Aus der Häufigkeit der Hurrikane kann nicht auf einen Klimawandel geschlossen werden.
- Auch hier irrt sich Al Gore.
-
Heinz Thieme
2015 de Häufigkeiten der Hurrikane und Taifune seit 1990
↑ University of Southampton: Kühlender Ozeanzyklus lässt Atlantik in den kommenden Jahrzehnten um ein halbes Grad abkühlen, globaler Erwärmungshiatus setzt sich fort und Hurrikane werden seltener
-
Die kalte Sonne (Fritz Vahrenholt & Sebastian Lüning)
2015-06-08 de University of Southampton: Kühlender Ozeanzyklus lässt Atlantik in den kommenden Jahrzehnten um ein halbes Grad abkühlen, globaler Erwärmungshiatus setzt sich fort und Hurrikane werden seltener
↑ en Predicting which African storms will intensify into hurricanes
Hurrikane haben einen gewissen Vorlauf.
Auf Satellitenbildern kann man die Entstehung der Stürme vor Westafrika verfolgen.
Aber nicht alle afrikanischen Babyhurrikane schaffen es über den Atlantik nach Amerika.
Die Tel Aviv University hat jetzt ein Modell entwickelt, mit dem man bestimmen kann, welche Stürme gefährlich und welche sich auflösen werden.
Pressemitteilung:
-
ScienceDaily
2015-03-12 en Predicting which African storms will intensify into hurricanesSummary
Most hurricanes over the Atlantic that eventually make landfall in North America actually start as intense thunderstorms in Western Africa one or two weeks earlier, research indicates.
This research may help cities and towns better prepare for these hurricanes with far more warning.
Hurricanes require moisture, the rotation of Earth, and warm ocean temperatures to grow from a mere atmospheric disturbance into a tropical storm.
But where do these storm cells originate, and exactly what makes an atmospheric disturbance amp up full throttle?
A new study published in Geophysical Research Letters by Tel Aviv University's Prof. Colin Price and his graduate student Naama Reicher of the Department of Geosciences at TAU's Faculty of Exact Sciences finds most hurricanes over the Atlantic that eventually make landfall in North America actually start as intense thunderstorms in Western Africa.
"85 percent of the most intense hurricanes affecting the U.S. and Canada start off as disturbances in the atmosphere over Western Africa," says Prof. Price.
"We found that the larger the area covered by the disturbances, the higher the chance they would develop into hurricanes only one to two weeks later."
⇧ 2014
↑ Wer hätte das gedacht: Weibliche Hurrikane fordern mehr Opfer als männliche
-
Die kalte Sonne (Fritz Vahrenholt & Sebastian Lüning)
2014-07-01 de Wer hätte das gedacht: Weibliche Hurrikane fordern mehr Opfer als männliche
⇧ 2013
↑ Wie der New Yorker Hurrikan Sandy zum Wahlhelfer von Barack Obama wurde: Rückblick zum ersten Jahrestag eines ganz normalen Sturms
-
Die kalte Sonne (Fritz Vahrenholt & Sebastian Lüning)
2013-12-25 de Wie der New Yorker Hurrikan Sandy zum Wahlhelfer von Barack Obama wurde: Rückblick zum ersten Jahrestag eines ganz normalen Sturms
↑ Studien der letzten Jahre zeigen: Häufigkeit von Hurrikanen eng an Ozeanzyklen und El Nino gekoppelt
-
Die kalte Sonne (Fritz Vahrenholt & Sebastian Lüning)
2013-12-24 de Studien der letzten Jahre zeigen: Häufigkeit von Hurrikanen eng an Ozeanzyklen und El Nino gekoppelt
↑ Hurrikane halten sich nicht an die NOAA-Prognose einer "besonders sturmreichen Saison": 2013 entpuppt sich als sechst-schwächstes atlantisches Hurrikanjahr seit 1950
-
Die kalte Sonne (Fritz Vahrenholt & Sebastian Lüning)
2013-12-23 de Hurrikane halten sich nicht an die NOAA-Prognose einer "besonders sturmreichen Saison": 2013 entpuppt sich als sechst-schwächstes atlantisches Hurrikanjahr seit 1950
↑ Studie in Nature Climate Change: Keine signifkante Veränderung der Sturmhäufigkeit in den USA während der vergangenen 100 Jahre
-
Die kalte Sonne (Fritz Vahrenholt & Sebastian Lüning)
2013-09-08 de Studie in Nature Climate Change: Keine signifkante Veränderung der Sturmhäufigkeit in den USA während der vergangenen 100 Jahre
↑ Neue geologische Studie schafft überraschenden Kontext: Heutige Hurrikanaktivität in Florida eher unterdurchschnittlich ausgeprägt
-
Die kalte Sonne (Fritz Vahrenholt & Sebastian Lüning)
2013-09-05 de Neue geologische Studie schafft überraschenden Kontext: Heutige Hurrikanaktivität in Florida eher unterdurchschnittlich ausgeprägt
↑ Natürliche Variabilität: Wirbelstürme an der mexikanischen Pazifikküste pusteten im Takt des solaren Schwabe-Zyklus
-
Die kalte Sonne (Fritz Vahrenholt & Sebastian Lüning)
2013-03-18 de Natürliche Variabilität: Wirbelstürme an der mexikanischen Pazifikküste pusteten im Takt des solaren Schwabe-Zyklus
⇧ 2012
↑ Björn Lomborg: Wirbelstürme lassen sich nicht durch Senkung der CO2-Emissionen bändigen
-
Die kalte Sonne (Fritz Vahrenholt & Sebastian Lüning)
2012-12-17 de Björn Lomborg: Wirbelstürme lassen sich nicht durch Senkung der CO2-Emissionen bändigenDer dänische Wissenschaftler Björn Lomborg hat in der Vergangenheit mehrfach an die Vernunft aller Beteiligten appelliert, sich nicht blind von der vermeintlichen Klimaangst leiten zu lassen und verstärkt auf das Kosten/Nutzen-Verhältnis zu achten.
Mit seinem Buch "Cool it!" sprach er vielen aus der Seele.
In der Tageszeitung Die Welt kommentierte Lomborg am 14.11.2102 in einem Beitrag mit dem Titel "CO2-Senkungen sind keine Antwort auf 'Sandy' " die aufgeregte Klima-Debatte um den Hurrikan, der kürzlich New York verwüstete.
Wie lassen sich Katastrophen wie "Sandy" in Zukunft vermeiden? Klimawandel-Experten fordern CO2-Senkungen.
Das ist jedoch unglaublich teuer und würde Sturmfluten nur um wenige Millimeter verringern.
Es ist nicht das erste Mal, dass eine Naturkatastrophe eine Wahl beeinflusste.
Man erinnere sich zum Beispiel an Gerhard Schröder und die Flutkatastrophe in Deutschland.
Der Versuch, Hurrikan Sandy als Indiz für eine herannahende Klimakatastrophe zu werten, ist wissenschaftlicher Unsinn.
Löst man sich einmal von dem nicht sehr aussagekräftigen Einzelfall, so spricht die Statistik eine klare Sprache:
In den letzten Jahrzehnten haben die tropischen Wirbelstürme weltweit nicht zugenommen
(siehe unseren Blogartikel
"Hurrikanen scheint die Erwärmung egal zu sein: Keine Zunahme der tropischen Wirbelstürme in den letzten Jahrzehnten").Neue Modellierungen finden sogar eine Abnahme der Hurrikan-Häufigkeit (siehe unseren Blogartikel
"Neue Klimamodellierung findet langfristige Abnahme der Hurrikan-Häufigkeit").
↑ Global accumulated cyclone energy

|
|
↑
Neue Klimamodellierung findet langfristige Abnahme der
Hurrikan-Häufigkeit
en
Decreasing trend of tropical cyclone frequency in 228-year
high-resolution AGCM simulations
-
Die kalte Sonne (Fritz Vahrenholt & Sebastian Lüning)
2012-11-23 de Neue Klimamodellierung findet langfristige Abnahme der Hurrikan-Häufigkeit
-
Watts UP With That? (Antony Watts)
2012-10-16 en Dueling papers on Tropical Cyclone Frequency
Quelle / Source:
-
GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS
2012-10-10 en Decreasing trend of tropical cyclone frequency in 228-year high-resolution AGCM simulationsKey Points
- Model simulations indicate a clear decreasing trend of TC frequency
- The same model projects a decrease of TC frequency in the future
- The decresing trend of TC is closely related to that of upward mass flux
↑ Normalized US Hurricane Damage 1900-2012, Including Sandy
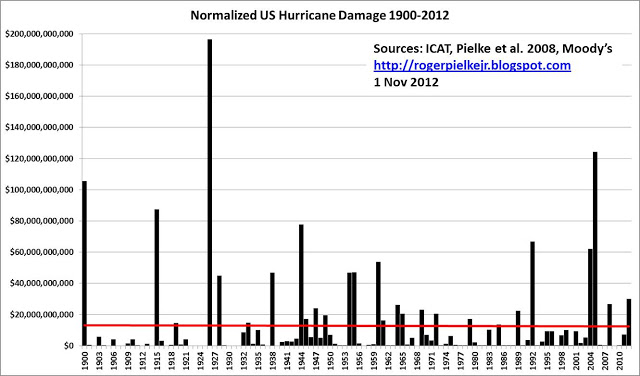
|
|
↑ Historical Storm Surges, South Rhode Island
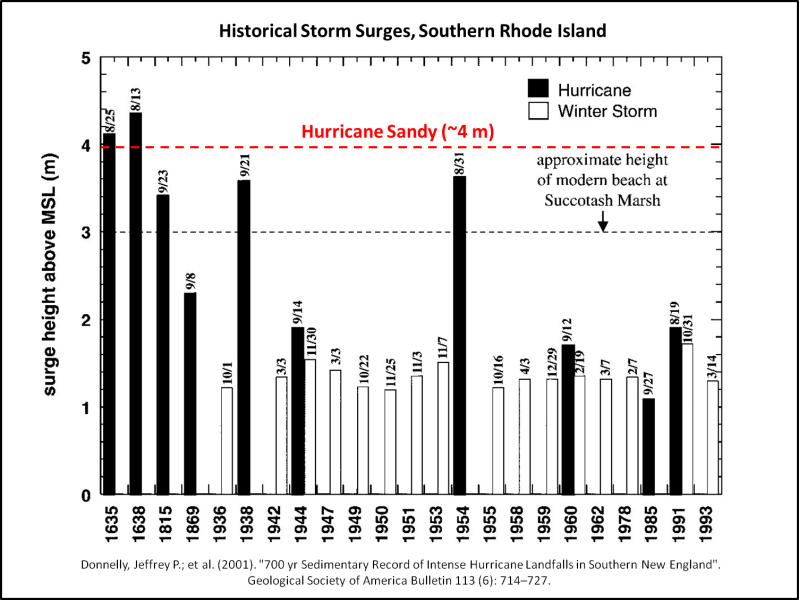
|
|
↑ Ein unerwarteter Rekord: Noch nie mussten die Vereinigten Staaten während der letzten 100 Jahre so lange auf einen starken Hurrikan warten!
-
Die kalte Sonne (Fritz Vahrenholt & Sebastian Lüning)
2012-08-02 de Ein unerwarteter Rekord: Noch nie mussten die Vereinigten Staaten während der letzten 100 Jahre so lange auf einen starken Hurrikan warten!
(mit neuem Diagramm)In den USA wird man langsam unruhig.
Noch vor wenigen Jahren hatte der IPCC vorhergesagt, dass die Hurrikane durch die Klimaerwärmung immer häufiger und auch stärker werden würden.Aber die Realität hat offenbar andere Pläne:
Seit nunmehr fast 2500 Tagen hat das Land jetzt keinen Monster-Hurrikan mehr erlebt.Das ist absoluter Rekord seit Beginn des 20. Jahrhunderts.
Noch nie musste man in dieser Zeit länger auf einen starken Hurrikan der Kategorie 3-5 warten.
2012-08-03 de Vorhersage für die Atlantische Hurrikansaison 2012: Die Hurrikan-Flaute hält wohl weiter an
↑ Die atlantische Hurrikan-Aktivität (ACE) der vergangenen 60 Jahre verlief parallel zur Entwicklung der Atlantisch Multidekaden Oszillation (AMO)
|
|
|
| de | en | fr |
|---|---|---|
|
Klimawandel: Wissenschaft Ozeanzyklen & Ozeanische Oszillationen |
Climate change: Science Ocean Cycles & Ocean Oscillations |
Changement climatique: Science Cycles et oscillations océaniques |
| Ozeanzyklen steuern das Klima / El Niño (der Knabe/warm) & La Niña (das Mädchen/kalt) / ENSO: El Niño-Southern Oscillation / AMO: Atlantic Multidecadal Oscillation / NAO: North Atlantic Oscillation / AO: Arctic Oscillation / IOD: Indischer Ozean Dipol / PDO: Pacific decada oscillation | ||
↑ Hurricane drought days at an all time high - Katrina Karma?
-
Watts Up With That? (Antony Watts)
2012-05-16 en Hurricane drought days at an all time high - Katrina Karma?
↑ Vorhersage für die Atlantische Hurrikansaison 2012: Die Hurrikan-Flaute hält wohl weiter an
-
Die kalte Sonne (Fritz Vahrenholt & Sebastian Lüning)
2012-08-03 de Vorhersage für die Atlantische Hurrikansaison 2012: Die Hurrikan-Flaute hält wohl weiter an
⇧ 2011
↑ Tropical Storm Activity Hits A 40-Year Low - Possibly "Unprecedented"!
![]()
![]() Global Tropical Storms and Hurricanes
Global Tropical Storms and Hurricanes
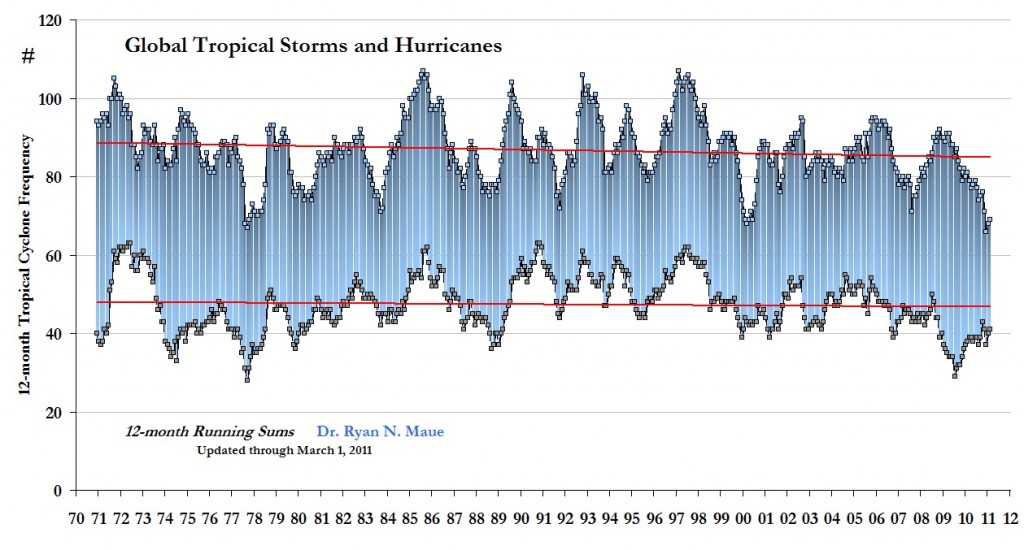
-
NoTricksZone (P Gosselin )
2011-03-21 en Tropical Storm Activity Hits A 40-Year Low - Possibly "Unprecedented"!
⇧ 2010
↑ Weltklimarat gerät erneut ins Zwielicht
-
Welt Online
2010-01-25 de Weltklimarat gerät erneut ins Zwielicht
↑ Weitere IPCC-Behauptung in Frage - Globale Hurrikan-Aktivität ist nicht gestiegen
-
Klimaskeptiker Info
2010-02-15 de Weitere IPCC-Behauptung in Frage - Globale Hurrikan-Aktivität ist nicht gestiegen
Neuer Ärger kommt auf das IPCC zu. Diesmal werden die Behauptungen des "Weltklimarats" über die angebliche globale Zunahme der Hurrikan-Aktivität in Frage gestellt.
Eine statistische Analyse der Rohdaten zeigt, daß die Behauptung, die globale Hurrikan-Aktivität habe zugenommen, nicht haltbar ist.
↑ en Now IPCC hurricane data is questioned
-
The Register
2010-02-15 en Now IPCC hurricane data is questioned
↑ en IPCC Gate Du Jour - now IPCC hurricane data questioned
-
Watts Up With That? (Antony Watts)
2010-02-16 en IPCC Gate Du Jour - now IPCC hurricane data questioned
↑ en WMO: "... we cannot at this time conclusively identify anthropogenic signals in past tropical cyclone data."
-
Watts Up With That? (Antony Watts)
2010-02-24 en WMO: "... we cannot at this time conclusively identify anthropogenic signals in past tropical cyclone data."
⇧ 2009
↑
Wo sind die Hurrikane, Mr. Gore?
en
Where are the Hurricanes, Mr. Gore?
|
-
Klimaskeptiker Info
2009-10-23 de Wo sind die Hurrikane, Mr. Gore?
-
Warning Signs (Alan Caruba)
2009-10-23 en Where are the Hurricanes, Mr. Gore?
-
Watts UP With That? (Antony Watts)
2009-10-23 en Where are the Hurricanes, Mr. Gore?
↑ Atlantische Wirbelstürme: Ein Beitrag von Dipl.-Meteorologen Klaus-Eckart Puls, sowie die erstaunliche Wandlung des US-Klimaforschers Michael Mann
-
EIKE Europäisches Institut für Klima und Energie
2009-08-14 de Atlantische Wirbelstürme: Ein Beitrag von Dipl.-Meteorologen Klaus-Eckart Puls, sowie die erstaunliche Wandlung des US-Klimaforschers Michael MannEtwas anderes ist aber höchst bemerkenswert:
Der Wirbelsturm-Aufsatz von Michael Mann et al. erwähnt den Begriff "CO2" oder gar "anthropogenes CO2" mit keinem Sterbenswort.
Als Ursache von tropischen Wirbelstürmen werden ausschließlich natürliche Fluktuationen, wie z.B. die NOA, der El Nino etc. angesehen.
Mit anderen Worten: Die von M. Mann in seiner Einleitung erwähnte Zunahme von Hurrikanen wird mit menschgemachtem CO2 nicht mehr in Verbindung gebracht.
Wir haben hier also neben vielem anderen den allerjüngsten Beleg dafür, dass die seriöse Klimawissenschaft sich längst von der ehemaligen Arbeitshypothese einer maßgebenden Beeinflussung von Extremwetterereignissen durch anthropogene CO2-Emissionen verabschiedet hat.
Und noch ein weiteres gibt zu denken:
In einer kleineren Wiener Klima-Fachkonferenz in 2009 hat M. Mann einen Vortrag gehalten, in dem er von 60% Sonneneinfluss auf Klimawerte sprach (persönliche Mitteilung eines Konferenzteilnehmers an den Autor).
Bekanntlich sind die wissenschaftlichen IPCC-Berichte dem inzwischen wohl unbestrittenen Einfluss der Sonne auf Klimawerte nicht sonderlich freundlich gesonnen.
Was ist von all dem zu halten?
Beginnt etwa M. Mann die Fronten zu wechseln?
Wie auch immer: Wenn die Entwicklung des ehemaligen IPCC-Advokaten Michael Mann in dieser Geschwindigkeit weitergeht, werden wir ihn in spätestens zwei Jahren bei EIKE als neues Mitglied begrüßen dürfen.
↑ Viel Wind um Nichts!
-
EIKE Europäisches Institut für Klima und Energie
Klaus-eckart Puls
2009-08-14 de Viel Wind um Nichts!
↑ Employment slump at NHC
-
Watts Up With That? (Antony Watts)
2009-07-19 en Employment slump at NHCGlobal (Northern Hemisphere) tropical cyclone ACE for the months May - June - July is the lowest in at least the past 30-years or more.
↑ Global hurricane activity has decreased to the lowest level in 30 years
-
Watts UP With That? (Antony Watts)
2009-03-12 en Global hurricane activity has decreased to the lowest level in 30 years
⇧ 2008
↑ Increased hurricanes to global warming link: blown away
-
Watts UP With That? (Antony Watts)
2008-05-19 en Increased hurricanes to global warming link: blown awaySo two questions remain:
- Will Al Gore issue a retraction or correction to his movie and claims of a GW to hurricane link?
- Will the American Meteorological Society abandon their draft policy statement which links Hurricane Katrina and climate?
It would be irresponsible for either Gore or AMS not to acknowledge this sea change in the realization that there is no linkage between global warming and increased hurricane frequency.
↑ Climate Change & Hurricane frequency
-
Stanley (Stan) Goldenberg
2008-05-05 en Climate Change & Hurricane frequency
Climate Change & Hurricane frequency
Stan Goldenberg from the Hurricane centre in Florida explains the facts and issues of hurricane frequency in the climate change debate.
↑ NOAA: Warm Seas May Mean Fewer Hurricanes
-
UnderwaterTimes.com
2008-01-22 en NOAA: Warm Seas May Mean Fewer Hurricanesde Weniger Hurrikane bei wärmeren Meeren
en Warm Seas May Mean Fewer Hurricanes
fr Les ouragans intenses prospèrent dans une mer froideHurricane Katrina on Aug. 28, 2005
(bei relativ kalter Meerestemperatur)-
de Hurrikane treten vermehrt bei tiefen Meeres-Oberflächentemperaturen auf.
Bei hohen Meerestemperaturen gibt es weniger Hurrikane.Genau das Gegenteil, was Al Gore sagt.
-
en Warm Seas May Mean Fewer Hurricanes
Just the contrary of what Al Gore says.
-
⇧ 2007
↑ Les ouragans intenses prospèrent dans une mer froide
-
Skyfal / Changement Climatique
2007-05-27 fr Les ouragans intenses prospèrent dans une mer froide
⇧ 2006
↑ Inconvenient Truths for Al Gore - Hurricane Catarina
-
2006-11-22 en
 Inconvenient Truths for Al Gore - 2: Hurricane Catarina (01:27)
Inconvenient Truths for Al Gore - 2: Hurricane Catarina (01:27)
Marlo Lewis explains the flaws in Al Gore's "An Inconvenient Truth."
↑ Atlantic Hurricanes
-
Envirotruth
2006-04-21 en Atlantic Hurricanes
↑ Hurrikan-Saison 2006: Prognose war völlig falsch
-
Tages-Anzeiger
2006-12-01 de Hurrikan-Saison 2006: Prognose war völlig falsch
Hurrikan-Saison 2006: Prognose war völlig falsch
↑ fr Autres calamités qui devraient s'amplifier, dit-on, mais qui ne le font pas : Les ouragans !
-
Pensée unique
2006-11-10 fr Autres calamités qui devraient s'amplifier, dit-on, mais qui ne le font pas : Les ouragans !Il apparaît que la violence et la fréquence des ouragans dans le nord de l'océan Indien, la région ouest du Pacifique nord et le Pacifique sud, (régions où se produisent 85% des ouragans de la planète) ont diminué ou sont restés stables, depuis, au moins, les 23 dernières années, bien que la température de ces océans se soit un peu élevée comme celle de l'atlantique.
La violence des ouragans dans l'atlantique, (soit 15% du total), elle, a augmenté entre 1983 et 2005.
De plus, on observe que la violence des ouragans suit une variation cyclique avec des périodes intenses et des périodes de calme comme dans les années 50-60. Cette variation ne suit donc en aucun cas, la faible croissance régulière de la température des océans ni, bien entendu, celle de la croissance du CO2 dans l'atmosphère.
⇧
23 Medicane
en Mediterranean tropical-like cyclone
fr Cyclone subtropical méditerranéen
Mit folgenden Links wird von anderen Webseiten auf diese Seite verwiesen:
| de | en | fr |
|---|---|---|
|
Wetterphänomene Medicane |
Weather phenomena Mediterranean tropical-like cyclone |
Phénomènes météorologiques Cyclone subtropical méditerranéen |
⇧ de Verzeichnis en Contents fr Sommaire
⇧ Welt-Info
|
|
Stürme / Storm / Tempête |
| ▷Die Kalte Sonne Blog‑Themen Vahrenholt/Lüning ▶Die kalte Sonne | de ▷Stürme |
| EIKE | de Hurrikan, Taifun. |
| WUWT | en Tornado Page, Tropical Cyclone Page |
| NoTricksZone | en Hurricanes / Tornados |
| Popular Technology | en Hurricanes, Storms, Tornadoes. |
| Wikipedia |
de
Meeresspiegel en Sea level fr Niveau de la mer |
| Vademecum |
▶Wintersturm
▶Welt-Info |
| Siehe auch | ▶Extremwetter |
|
|
|
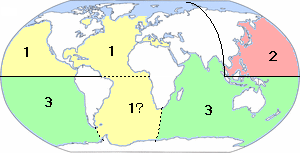
|
1 Hurrikan (Orkan) |
| de | en | fr |
|---|---|---|
| Wetterphänomene (Teil 2) | Weather phenomena (Part 2) | Phénomènes météorologiques (partie 2) |
| Sturm (Wintersturm) | Storm | Tempête |
| Tropischer Wirbelsturm | Tropical cyclone | Cyclone tropical |
| Hurrikan | Hurricane | Ouragan (Cyclone tropical) |
| Medicane | Mediterranean tropical-like cyclone | Cyclone subtropical méditerranéen |
| Taifun | Typhoon | Typhon |
| Tornado | Tornado | Tornade |
| Zyklon | Cyclone | Cyclone |
| Sturmflut | Storm surge | Onde de tempête |
| Blizzard | Blizzard | Blizzard (météorologie) |
| Wind | Wind | Vent |
| Jetstream | Jet stream | Courant-jet |
| Monsun | Monsoon | Mousson |
| Blockierte Wetterlagen | Block (meteorology) | Blocage (météorologie) |
⇧ de Allgemein en General fr Générale
-
Wikipedia de
Medicane
en Mediterranean tropical-like cyclone
fr Cyclone subtropical méditerranéen -
⇧ de Text en Text fr Texte
⇧
24 Taifun
en Typhoon
fr Typhon
Mit folgenden Links wird von anderen Webseiten auf diese Seite verwiesen:
| de | en | fr |
|---|---|---|
|
Wetterphänomene Taifun |
Weather phenomena Typhoon |
Phénomènes météorologiques Typhon |
⇧ de Verzeichnis en Contents fr Sommaire
- 2017
- de Wirbelsturmaktivität in Asien durch El Nino und solare Schwankungen kontrolliert
- 2013
- de Wer hätte das gedacht: Studien können keine Zunahme der tropischen Wirbelstürme im Indischen und Pazifischen Ozean feststellen
- de Klimaaktivisten missbrauchen Taifun Haiyan für eigene Zwecke: Studien fanden für die vergangenen Jahrzehnte keine Zunahme der Taifunaktivität
⇧ Welt-Info
|
|
Stürme / Storm / Tempête |
| ▷Die Kalte Sonne Blog‑Themen Vahrenholt/Lüning ▶Die kalte Sonne | de ▷Stürme |
| EIKE | de Hurrikan, Taifun. |
| WUWT | en Tornado Page, Tropical Cyclone Page |
| NoTricksZone | en Hurricanes / Tornados |
| Popular Technology | en Hurricanes, Storms, Tornadoes. |
| Wikipedia |
de
Meeresspiegel en Sea level fr Niveau de la mer |
| Vademecum |
▶Wintersturm
▶Welt-Info |
| Siehe auch | ▶Extremwetter |
|
|
|
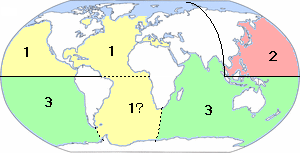
|
1 Hurrikan (Orkan) |
| de | en | fr |
|---|---|---|
| Wetterphänomene (Teil 2) | Weather phenomena (Part 2) | Phénomènes météorologiques (partie 2) |
| Sturm (Wintersturm) | Storm | Tempête |
| Tropischer Wirbelsturm | Tropical cyclone | Cyclone tropical |
| Hurrikan | Hurricane | Ouragan (Cyclone tropical) |
| Medicane | Mediterranean tropical-like cyclone | Cyclone subtropical méditerranéen |
| Taifun | Typhoon | Typhon |
| Tornado | Tornado | Tornade |
| Zyklon | Cyclone | Cyclone |
| Sturmflut | Storm surge | Onde de tempête |
| Blizzard | Blizzard | Blizzard (météorologie) |
| Wind | Wind | Vent |
| Jetstream | Jet stream | Courant-jet |
| Monsun | Monsoon | Mousson |
| Blockierte Wetterlagen | Block (meteorology) | Blocage (météorologie) |
⇧ de Allgemein en General fr Générale
⇧ de Text en Text fr Texte
⇧ 2017
↑ Wirbelsturmaktivität in Asien durch El Nino und solare Schwankungen kontrolliert
-
Die kalte Sonne (Fritz Vahrenholt & Sebastian Lüning)
2017-10-23 de Wirbelsturmaktivität in Asien durch El Nino und solare Schwankungen kontrolliertWirbelstürme in Asien werden als Taifune bezeichnet.
Wie hat sich die Taifun-Aktivität in den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten entwickelt?
Gibt es Trends?
Wir begeben uns auf einen Streifzug durch die neuere Literatur.
Wie alle unsere Beiträge, wird auch dieser Blogartikel in ein paar Wochen in unserem thematischen Inhaltsverzeichnis zu finden sein.
Wenn also das nächste Mal ein Taifun in Asien wirbelt und ein Aktivist umgehend den Klimawandel dafür verantwortlich macht, haben Sie den wichtigen klimahistorischen Kontext sofort parat.
⇧ 2013
↑ Wer hätte das gedacht: Studien können keine Zunahme der tropischen Wirbelstürme im Indischen und Pazifischen Ozean feststellen
-
Die kalte Sonne (Fritz Vahrenholt & Sebastian Lüning)
2013-12-03 de Wer hätte das gedacht: Studien können keine Zunahme der tropischen Wirbelstürme im Indischen und Pazifischen Ozean feststellenHeute wollen wir uns die historische Entwicklung der tropischen Wirbelstürme in der weiteren Umgebung von Haiyan näher anschauen und begeben uns auf einen Streifzug durch die Welt der aktuellen Forschungsliteratur.
Schlussbemerkung (mit Links im Artikel)
JoNova brachte Mitte 2012 auf Basis einer Literaturauswertung des Science & Policy Institutes eine Übersicht zur historischen Sturmentwicklung in Australien und Neuseeland.
Fazit: Es ist keine Steigerung der tropischen Wirbelsturmgefahr zu verzeichnen.
Eine weitere Übersicht des Science & Public Policy Institiute zur Literaturlage der pazifischen Hurrikane erschien im Juni 2013.
Auch hier konnten keine Hinweise auf eine drohende Verschärfung der Stürme gefunden werden.
↑ Klimaaktivisten missbrauchen Taifun Haiyan für eigene Zwecke: Studien fanden für die vergangenen Jahrzehnte keine Zunahme der Taifunaktivität
-
Die kalte Sonne (Fritz Vahrenholt & Sebastian Lüning)
2013-11-18 de Klimaaktivisten missbrauchen Taifun Haiyan für eigene Zwecke: Studien fanden für die vergangenen Jahrzehnte keine Zunahme der TaifunaktivitätAnfang November 2013 verwüstete der Taifun Haiyan (chinesisch: "Sturmschwalbe") Teile der Philippinen und forderte über 2300 Tote.
Eine Tragödie, die sich leider seit jeher in dieser von der Natur hart auf die Prüfung gestellten Region abspielt.
Ursprünglich war sogar von 10.000 Toten die Rede gewesen, eine letztendlich zu hoch gegriffene Zahl, deren fälschliches Zustandekommen der philippinische Präsident Benigno Aquino durch das 'emotionale Drama' nach der Katastrophe entschuldigte.
Haiyan war einer der stärksten tropischen Wirbelstürme seit Beginn verlässlicher Wetteraufzeichnungen.
Neben den hohen Windgeschwindigkeiten kam jedoch noch ein weiterer unglücklicher Umstand hinzu, der die Opferzahlen nach oben schnellen ließ:
Gerade als Haiyan auf Land traf herrschte nämlich Flut, so dass die Flutwelle noch viel höher auflief, als sie es sonst eigentlich getan hätte.
Studien fanden für die vergangenen Jahrzehnte keine Zunahme der Taifunaktivität
Siehe Artikel der Kalten Sonne
und aus dem Vademecum

 Global Tropical Storms and Hurricanes
Global Tropical Storms and Hurricanes
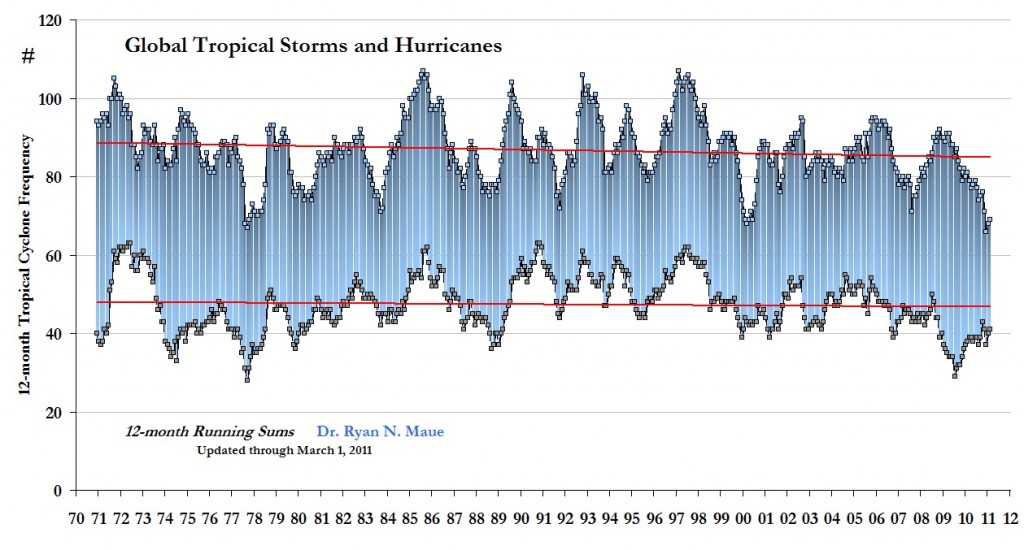
-
NoTricksZone (P Gosselin )
2011-03-21 en Tropical Storm Activity Hits A 40-Year Low - Possibly "Unprecedented"!
Wie nach jeder größeren Extremwetterkatastrophe nutzten sogleich Klimaaktivisten die Situation aus und missbrauchten das schlimme Ereignis für eigene Zwecke.
Delegierter der Philippinen
So nahm ein Delegierter der Philippinen bei der UN-Klimakonferenz in Warschau den Sturm in einer emotionsgeladenen Rede zum Anlass, zu einem entschiedenerem Kampf gegen den Klimawandel aufzurufen.
Die Tagesschau
Auf der gleichen Klimakonferenz kündigte Japan an, seine CO2-Einsparungsbemühungen erheblich drastisch nach unten zu schrauben.
Sogleich inszenierte eine Klimaaktivistengruppe ein fragwürdiges mediales Happening im Rahmen einer Pressekonferenz in Warschau, bei dem als Japaner verkleidete Schauspieler auf am Boden liegende Philippiner eintraten.
Die Tagesschau stieg sofort mit ein und verbreitete das Schmierentheater dankbar.
Ban Ki-moon
Auch der Klimaspezialist und Generalsekretär der Vereinten Nationen, Ban Ki-moon ist sich sicher, dass Haiyan auf den menschengemachten Klimawandel zurückgeht, wie er jetzt in einer Rede an der Universität Tallinn in Estland erklärte.
Mojib Latif
Im Bayerischen Rundfunk sprach der klimareligiöse Mojib Latif von einer Katastrophe "biblischen Ausmaßes", die auf jeden Fall als Folge der Klimaerwärmung zu werten wäre.
Stefan Rahmstorf
Im ZDF-Morgenmagazin behauptete Stefan Rahmstorf aus dem Bauch heraus, dass dies wahrscheinlich der stärkste Taifun war, der jemals auf Land getroffen ist.
In seinem Blog fragt der Forscher:
Wie ruhig können diejenigen, die sich mit aller Macht gegen Klimaschutzmaßnahmen stemmen, im Angesicht der Bilder aus den Philippinen noch schlafen?
In seinem Klimalounge Blog versuchte Rahmstorf zudem den Anschein zu erwecken, er hätte allerneueste, exklusive Informationen, die seine Sichtweise stützen.
Und abschließend noch eine wichtige Frage:
Warum hat sich niemand aus der offiziellen deutschen Forschung in der Presse zu Wort gemeldet und die falsche, unmoralische Darstellung der historischen Taifuntrends durch Rahmstorf, Latif und Hobbyklimatologe Töpfer richtiggestellt, obwohl dies unter Hinweis auf begutachtete Publikationen ein Leichtes gewesen wäre?
Wollte man wieder einmal "der klimaskeptischen Seite keine Munition liefern" und ließ daher die Fehler einfach so durchgehen?
Was ist von dieser gefährlichen Passivität von mit deutschen Steuermitteln bezahlten Forschern zu halten, die aus Angst vor grünen Repressalien nicht mehr frei in der Öffentlichkeit sprechen können?
Quo vadis deutsche Wissenschaft?
-
NoTricksZone (P Gosselin )
⇧
25 Tornado
en Tornado
fr Tornade
Mit folgenden Links wird von anderen Webseiten auf diese Seite verwiesen:
| de | en | fr |
|---|---|---|
|
Wetterphänomene Tornado |
Weather phenomena Tornado |
Phénomènes météorologiques Tornade |
⇧ de Verzeichnis en Contents fr Sommaire
- 2019
- de Heftige Tornados sind in den USA während der letzten 70 Jahre seltener geworden
- 2017
- de Fake-News: Von Tornados und anderen Halluzinationen in den Medien
- 2016
- de
Das heißeste Jahr, aber die niedrigste Tornadorate -
obwohl nach der Theorie beides gleichzeitig höher werden muss
en NOAA: U.S. Tornadoes lowest since 1954 - during the "hottest year ever" - 2014
- en Violent Tornadoes Are On The Decline In The US
- 2013
- de
Die große Tornadoflaute: Kein Zusammenhang zwischen Klimawandel und
Tornadohäufigkeit
en Climate Experts Vahrenholt And Lüning Call Recent Tornado Activity "The Great Tornado Doldrums" - de Bereinigte Tornadoschäden in den USA haben in den letzten Jahrzehnten abgenommen
- de Heftiger Tornado-Doppelschlag im Mai 2013 in Oklahoma: Sturmgeschichte der Tornado-Gasse seit 1950
- en Was ist die Ursache der Tornado-Häufung von 2011 in den USA? Menschengemachter Klimawandel oder natürliche Variabilität?
- 2012
- en Tornado Season Statistics Update - 'remarkably quiet'
- en 'On climate time scales there is no indication of increasing incidence of tornadoes...'
- 2010
- de Tornadoland Deutschland
- 2008
- de Kerry Blames Tornado Outbreak on Global Warming
⇧ Welt-Info
|
|
Stürme / Storm / Tempête |
| ▷Die Kalte Sonne Blog‑Themen Vahrenholt/Lüning ▶Die kalte Sonne | de ▷Stürme |
| EIKE | de Hurrikan, Taifun. |
| WUWT | en Tornado Page, Tropical Cyclone Page |
| NoTricksZone | en Hurricanes / Tornados |
| Popular Technology | en Hurricanes, Storms, Tornadoes. |
| Wikipedia |
de
Meeresspiegel en Sea level fr Niveau de la mer |
| Vademecum |
▶Wintersturm
▶Welt-Info |
| Siehe auch | ▶Extremwetter |
|
|
|
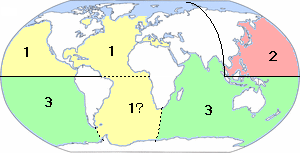
|
1 Hurrikan (Orkan) |
| de | en | fr |
|---|---|---|
| Wetterphänomene (Teil 2) | Weather phenomena (Part 2) | Phénomènes météorologiques (partie 2) |
| Sturm (Wintersturm) | Storm | Tempête |
| Tropischer Wirbelsturm | Tropical cyclone | Cyclone tropical |
| Hurrikan | Hurricane | Ouragan (Cyclone tropical) |
| Medicane | Mediterranean tropical-like cyclone | Cyclone subtropical méditerranéen |
| Taifun | Typhoon | Typhon |
| Tornado | Tornado | Tornade |
| Zyklon | Cyclone | Cyclone |
| Sturmflut | Storm surge | Onde de tempête |
| Blizzard | Blizzard | Blizzard (météorologie) |
| Wind | Wind | Vent |
| Jetstream | Jet stream | Courant-jet |
| Monsun | Monsoon | Mousson |
| Blockierte Wetterlagen | Block (meteorology) | Blocage (météorologie) |
⇧ de Allgemein en General fr Générale
⇧ de Text en Text fr Texte
⇧ 2019
↑ Heftige Tornados sind in den USA während der letzten 70 Jahre seltener geworden
-
Die kalte Sonne (Fritz Vahrenholt & Sebastian Lüning)
2019-01-23 de Heftige Tornados sind in den USA während der letzten 70 Jahre seltener geworden
 Entwicklung starker Tornados in den USA seit 1950
Entwicklung starker Tornados in den USA seit 1950

Die Weltwirtschaftsleistung steigt und steigt.
Das kann man schön am Wachstum der globalen Summe des Bruttoinlandsprodukts sehen.
Insofern wundert es auch nicht, dass Schäden durch Naturkatastrophen ebenfalls stetig ansteigen.
Denn wenn es mehr Werte gibt, die zerstört werden können, dann steigt die Schadenssumme selbst dann an, wenn die Anzahl und Stärke der Naturkatastrophen konstant bliebe.
Dieser Aspekt wird gerne verschwiegen, wenn MunichRe und andere Unternehmen statistische Schadenszahlen verbreiten.
Eine neue Studie von Roger Pielke hat genau diesen Effekt dokumentieren können.
In den letzten 25 Jahren sind die Schäden stark angestiegen, jedoch über das BIP normiert, ist ein Rückgang zu verzeichnen
⇧ 2017
↑ Fake-News: Von Tornados und anderen Halluzinationen in den Medien
-
EIKE Europäisches Institut für Klima und Energie
Klaus-Eckart Puls
2017-07-11 de Fake-News: Von Tornados und anderen Halluzinationen in den Medien
⇧ 2016
↑
Das heißeste Jahr, aber die niedrigste Tornadorate -
obwohl nach der Theorie beides gleichzeitig höher werden muss
en
NOAA: U.S. Tornadoes lowest since 1954 - during the
"hottest year ever"
![]()
![]() Black: 830 tornadoes so far in 2016
Black: 830 tornadoes so far in 2016

-
EIKE Europäisches Institut für Klima und Energie
Helmut Kuntz
2016-11-25 de Das heißeste Jahr, aber die niedrigste Tornadorate - obwohl nach der Theorie beides gleichzeitig höher werden mussWer aber den Daten und nicht der AGW-Theorie glaubt, ist ein "Klimaleugner".
Auf Watts Up With That kam gerade eine interessante Info:
Obwohl dieses Jahr schon wieder als das heißeste ausgerufen wird, ist die Tornadoanzahl die niedrigste seit Beginn der systematischen Zählung m Jahr 1954.Und wie Bild 1 der NOAA zeigt, war das Jahr 1884 (Anm.: Im Jahr 1880 begann offiziell der Klimawandel) das mit dem höchsten Wert.
-
Watts Up With That? (Antony Watts)
2016-11-16 en NOAA: U.S. Tornadoes lowest since 1954 - during the "hottest year ever"Latest data from NOAA's Storm Prediction Center indicate that as of today, the total count for 2016 of US tornadoes are fewest in a calendar year since record-keeping began in 1954.
That's a hard fact, that flies in the face of claims of extreme weather being enhanced by warmer temperatures, as many have tried to claim.
This graph from NOAA SPC shows that with 830 tornadoes so far this year (in black),
it has crossed the minimum line (in magenta) showing 879 as the previous lowest number recorded on this date.
The National Weather Service Forecast Office in Nashville said today:
There have only been 5 tornadoes in Tennessee this year.
It's been the quietest year for tornadoes in the state since 1987.
U.N.'s weather bureau is warning of this:
It is very likely that 2016 will be the hottest year on record, with global temperatures even higher than the record-breaking temperatures in 2015.
Preliminary data shows that 2016's global temperatures are approximately 1.2° Celsius above pre-industrial levels, according to an assessment by the World Meteorological Organization (WMO).
⇧ 2014
↑ en Violent Tornadoes Are On The Decline In The US
Violent Tornadoes Are On The Decline In The US
|
⇧ 2013
↑
Die große Tornadoflaute: Kein Zusammenhang zwischen Klimawandel und
Tornadohäufigkeit
en Climate Experts Vahrenholt And Lüning Call Recent Tornado Activity
"The Great Tornado Doldrums"
-
Die kalte Sonne (Fritz Vahrenholt & Sebastian Lüning)
2013-06-22 de Die große Tornadoflaute: Kein Zusammenhang zwischen Klimawandel und Tornadohäufigkeit
-
NoTricksZone (Pierre L. Gosselin)
2013-06-22 de Climate Experts Vahrenholt And Lüning Call Recent Tornado Activity "The Great Tornado Doldrums"
↑ Bereinigte Tornadoschäden in den USA haben in den letzten Jahrzehnten abgenommen
-
Die kalte Sonne (Fritz Vahrenholt & Sebastian Lüning)
2013-07-01 de Bereinigte Tornadoschäden in den USA haben in den letzten Jahrzehnten abgenommen
↑ Heftiger Tornado-Doppelschlag im Mai 2013 in Oklahoma: Sturmgeschichte der Tornado-Gasse seit 1950
-
Die kalte Sonne (Fritz Vahrenholt & Sebastian Lüning)
2013-06-21 de Heftiger Tornado-Doppelschlag im Mai 2013 in Oklahoma: Sturmgeschichte der Tornado-Gasse seit 1950
↑ Was ist die Ursache der Tornado-Häufung von 2011 in den USA? Menschengemachter Klimawandel oder natürliche Variabilität?
-
Die kalte Sonne (Fritz Vahrenholt & Sebastian Lüning)
2012-07-29 de Was ist die Ursache der Tornado-Häufung von 2011 in den USA? Menschengemachter Klimawandel oder natürliche Variabilität?
⇧ 2012
↑ en Tornado Season Statistics Update - 'remarkably quiet'
-
Watts UP With That? (Antony Watts)
2012-07-16 en Tornado Season Statistics Update - 'remarkably quiet'
↑ en 'On climate time scales there is no indication of increasing incidence of tornadoes...'
-
Watts UP With That? (Antony Watts)
2012-08-12 en 'On climate time scales there is no indication of increasing incidence of tornadoes'
⇧ 2010
↑ Tornadoland Deutschland
-
EIKE Europäisches Institut für Klima und Energie
2010-07-24 de Tornadoland DeutschlandDer Mensch mit seiner natürlichen Fixierung in der Gegenwart neigt dazu, Ereignissen die unmittelbar geschehen, eine höhere Präferenz zuzuordnen als Ereignisse, die sich in der Vergangenheit abspielten.
Dies umso mehr, je weiter das Ereignis zurückliegt.
Daraus resultieren z.B. solche Sätze, Nichts ist so alt wie die Tageszeitung von gestern.So mögen bei einigen Mitmenschen die jüngsten Ereignisse im Wettergeschehen Deutschlands den Eindruck erwecken, diese seien ungewöhnlich.
⇧ 2008
↑ Kerry Blames Tornado Outbreak on Global Warming
de Panik-Küche en Panic laboratory fr Marmite alarmiste
-
Watts Up With That? (Antony Watts)
2008-02-07 en Kerry Blames Tornado Outbreak on Global Warming
⇧
26 Zyklon
en Cyclone
fr Cyclone
Mit folgenden Links wird von anderen Webseiten auf diese Seite verwiesen:
| de | en | fr |
|---|---|---|
|
Wetterphänomene Zyklon |
Weather phenomena Cyclone |
Phénomènes météorologiques Cyclone |
⇧ de Verzeichnis en Contents fr Sommaire
⇧ Welt-Info
|
|
Stürme / Storm / Tempête |
| ▷Die Kalte Sonne Blog‑Themen Vahrenholt/Lüning ▶Die kalte Sonne | de ▷Stürme |
| EIKE | de Hurrikan, Taifun. |
| WUWT | en Tornado Page, Tropical Cyclone Page |
| NoTricksZone | en Hurricanes / Tornados |
| Popular Technology | en Hurricanes, Storms, Tornadoes. |
| Wikipedia |
de
Meeresspiegel en Sea level fr Niveau de la mer |
| Vademecum |
▶Wintersturm
▶Welt-Info |
| Siehe auch | ▶Extremwetter |
|
|
|
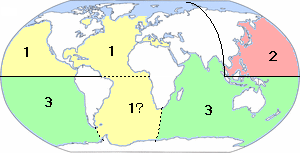
|
1 Hurrikan (Orkan) |
| de | en | fr |
|---|---|---|
| Wetterphänomene (Teil 2) | Weather phenomena (Part 2) | Phénomènes météorologiques (partie 2) |
| Sturm (Wintersturm) | Storm | Tempête |
| Tropischer Wirbelsturm | Tropical cyclone | Cyclone tropical |
| Hurrikan | Hurricane | Ouragan (Cyclone tropical) |
| Medicane | Mediterranean tropical-like cyclone | Cyclone subtropical méditerranéen |
| Taifun | Typhoon | Typhon |
| Tornado | Tornado | Tornade |
| Zyklon | Cyclone | Cyclone |
| Sturmflut | Storm surge | Onde de tempête |
| Blizzard | Blizzard | Blizzard (météorologie) |
| Wind | Wind | Vent |
| Jetstream | Jet stream | Courant-jet |
| Monsun | Monsoon | Mousson |
| Blockierte Wetterlagen | Block (meteorology) | Blocage (météorologie) |
⇧ de Allgemein en General fr Générale
-
Wikipedia de
Zyklon
en -
fr -
⇧ de Text en Text fr Texte
⇧
27 Sturmflut
en Storm surge
fr Onde de tempête
Mit folgenden Links wird von anderen Webseiten auf diese Seite verwiesen:
| de | en | fr |
|---|---|---|
|
Wetterphänomene Sturmflut |
Weather phenomena Storm surge |
Phénomènes météorologiques Onde de tempête |
Links zur Klimaschau
|
|
▶Wintersturm ▶Tropischer Wirbelsturm ▶Sturmflut |
⇧ de Verzeichnis en Contents fr Sommaire
- 2017
- de Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie: Es gibt in Norddeutschland nicht mehr Sturmfluten als vor 50 Jahren
⇧ Welt-Info
|
|
Stürme / Storm / Tempête |
| ▷Die Kalte Sonne Blog‑Themen Vahrenholt/Lüning ▶Die kalte Sonne | de ▷Stürme |
| EIKE | de Hurrikan, Taifun. |
| WUWT | en Tornado Page, Tropical Cyclone Page |
| NoTricksZone | en Hurricanes / Tornados |
| Popular Technology | en Hurricanes, Storms, Tornadoes. |
| Wikipedia |
de
Meeresspiegel en Sea level fr Niveau de la mer |
| Vademecum |
▶Wintersturm
▶Welt-Info |
| Siehe auch | ▶Extremwetter |
|
|
|
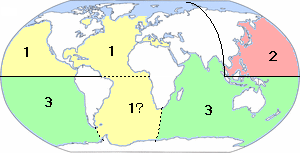
|
1 Hurrikan (Orkan) |
| de | en | fr |
|---|---|---|
| Wetterphänomene (Teil 2) | Weather phenomena (Part 2) | Phénomènes météorologiques (partie 2) |
| Sturm (Wintersturm) | Storm | Tempête |
| Tropischer Wirbelsturm | Tropical cyclone | Cyclone tropical |
| Hurrikan | Hurricane | Ouragan (Cyclone tropical) |
| Medicane | Mediterranean tropical-like cyclone | Cyclone subtropical méditerranéen |
| Taifun | Typhoon | Typhon |
| Tornado | Tornado | Tornade |
| Zyklon | Cyclone | Cyclone |
| Sturmflut | Storm surge | Onde de tempête |
| Blizzard | Blizzard | Blizzard (météorologie) |
| Wind | Wind | Vent |
| Jetstream | Jet stream | Courant-jet |
| Monsun | Monsoon | Mousson |
| Blockierte Wetterlagen | Block (meteorology) | Blocage (météorologie) |
⇧ de Allgemein en General fr Générale
-
Wikipedia
de
Sturmflut
en Storm surge
fr Onde de tempête
⇧ de Text en Text fr Texte
⇧ 2017
↑ Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie: Es gibt in Norddeutschland nicht mehr Sturmfluten als vor 50 Jahren
-
Die kalte Sonne (Fritz Vahrenholt & Sebastian Lüning)
2017-12-27 de Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie: Es gibt in Norddeutschland nicht mehr Sturmfluten als vor 50 Jahren
⇧
28 Blizzard
en Blizzard
fr Blizzard
Mit folgenden Links wird von anderen Webseiten auf diese Seite verwiesen:
| de | en | fr |
|---|---|---|
|
Wetterphänomene Blizzard |
Weather phenomena Blizzard |
Phénomènes météorologiques Blizzard |
⇧ de Verzeichnis en Contents fr Sommaire
- 2017
- de
Mehr Blizzards in Nordamerika während solarer Schwächephasen
en The number of blizzards has DOUBLED in the past 20 years: Scientists blame global warming and sunspots for rise in storms
⇧ Welt-Info
|
|
Stürme / Storm / Tempête |
| ▷Die Kalte Sonne Blog‑Themen Vahrenholt/Lüning ▶Die kalte Sonne | de ▷Stürme |
| EIKE | de Hurrikan, Taifun. |
| WUWT | en Tornado Page, Tropical Cyclone Page |
| NoTricksZone | en Hurricanes / Tornados |
| Popular Technology | en Hurricanes, Storms, Tornadoes. |
| Wikipedia |
de
Meeresspiegel en Sea level fr Niveau de la mer |
| Vademecum |
▶Wintersturm
▶Welt-Info |
| Siehe auch | ▶Extremwetter |
|
|
|
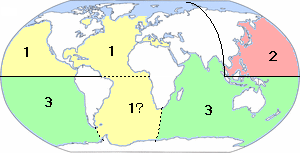
|
1 Hurrikan (Orkan) |
| de | en | fr |
|---|---|---|
| Wetterphänomene (Teil 2) | Weather phenomena (Part 2) | Phénomènes météorologiques (partie 2) |
| Sturm (Wintersturm) | Storm | Tempête |
| Tropischer Wirbelsturm | Tropical cyclone | Cyclone tropical |
| Hurrikan | Hurricane | Ouragan (Cyclone tropical) |
| Medicane | Mediterranean tropical-like cyclone | Cyclone subtropical méditerranéen |
| Taifun | Typhoon | Typhon |
| Tornado | Tornado | Tornade |
| Zyklon | Cyclone | Cyclone |
| Sturmflut | Storm surge | Onde de tempête |
| Blizzard | Blizzard | Blizzard (météorologie) |
| Wind | Wind | Vent |
| Jetstream | Jet stream | Courant-jet |
| Monsun | Monsoon | Mousson |
| Blockierte Wetterlagen | Block (meteorology) | Blocage (météorologie) |
⇧ de Allgemein en General fr Générale
-
Wikipedia
de
Blizzard
en Blizzard
fr Blizzard (météorologie)
⇧ de Text en Text fr Texte
⇧ 2017
↑
Mehr Blizzards in Nordamerika während solarer Schwächephasen
en
The number of blizzards has DOUBLED in the past 20 years:
Scientists blame global warming and sunspots for rise in storms
-
Die kalte Sonne (Fritz Vahrenholt & Sebastian Lüning)
2017-09-28 de Mehr Blizzards in Nordamerika während solarer SchwächephasenIm Januar 2017 erschien im Journal of Applied Meteorology and Climatology eine Arbeit von Jill Coleman und Robert Schwartz, in der sie die sogenannten Blizzards in den USA untersuchten.
Blizzards sind starke Schneestürme im Zusammenhang mit einem kräftigen Kälteeinbruch.
Quelle / Source:
-
AMS American Meteorological Society
2017-01-11 en An Updated Blizzard Climatology of the Contiguous United States (1959-2014): An Examination of Spatiotemporal Trends
-
DAILYMAIL
2016-01-25 en The number of blizzards has DOUBLED in the past 20 years: Scientists blame global warming and sunspots for rise in stormsFrom 1960-94, the US had an average of nine blizzards per year
But since 1995, the annual average has risen to 19, recent study found
More blizzards are forming outside normal season of October to March
One explanation is the use of better methods to record severe storms
⇧
29 Wind
en Wind
fr Vent
Mit folgenden Links wird von anderen Webseiten auf diese Seite verwiesen:
| de | en | fr |
|---|---|---|
|
Wetterphänomene Wind |
Weather phenomena Wind |
Phénomènes météorologiques Vent |
⇧ de Verzeichnis en Contents fr Sommaire
⇧ Welt-Info
|
|
Stürme / Storm / Tempête |
| ▷Die Kalte Sonne Blog‑Themen Vahrenholt/Lüning ▶Die kalte Sonne | de ▷Stürme |
| EIKE | de Hurrikan, Taifun. |
| WUWT | en Tornado Page, Tropical Cyclone Page |
| NoTricksZone | en Hurricanes / Tornados |
| Popular Technology | en Hurricanes, Storms, Tornadoes. |
| Wikipedia |
de
Meeresspiegel en Sea level fr Niveau de la mer |
| Vademecum |
▶Wintersturm
▶Welt-Info |
| Siehe auch | ▶Extremwetter |
|
|
|
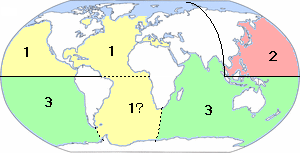
|
1 Hurrikan (Orkan) |
| de | en | fr |
|---|---|---|
| Wetterphänomene (Teil 2) | Weather phenomena (Part 2) | Phénomènes météorologiques (partie 2) |
| Sturm (Wintersturm) | Storm | Tempête |
| Tropischer Wirbelsturm | Tropical cyclone | Cyclone tropical |
| Hurrikan | Hurricane | Ouragan (Cyclone tropical) |
| Medicane | Mediterranean tropical-like cyclone | Cyclone subtropical méditerranéen |
| Taifun | Typhoon | Typhon |
| Tornado | Tornado | Tornade |
| Zyklon | Cyclone | Cyclone |
| Sturmflut | Storm surge | Onde de tempête |
| Blizzard | Blizzard | Blizzard (météorologie) |
| Wind | Wind | Vent |
| Jetstream | Jet stream | Courant-jet |
| Monsun | Monsoon | Mousson |
| Blockierte Wetterlagen | Block (meteorology) | Blocage (météorologie) |
⇧ de Allgemein en General fr Générale
-
Wikipedia
de
Liste der Winde und Windsysteme
en List of local winds
fr Liste de vents
-
ESYS Europäisches Segel-Informationssystem
de Windkarte Mittelmeer
⇧ de Text en Text fr Texte
⇧
30 Jetstream
en Jet stream
fr Courant-jet
Mit folgenden Links wird von anderen Webseiten auf diese Seite verwiesen:
| de | en | fr |
|---|---|---|
|
Wetterphänomene Jetstream |
Weather phenomena Jet stream |
Phénomènes météorologiques Courant-jet |
⇧ de Verzeichnis en Contents fr Sommaire
- 2018
- de
Studie zeigt, dass die globale Erwärmung den Jetstream nicht
verändern wird
en Study Shows That Global Warming Will NOT Alter The Jet Stream
⇧ Welt-Info
|
|
Stürme / Storm / Tempête |
| ▷Die Kalte Sonne Blog‑Themen Vahrenholt/Lüning ▶Die kalte Sonne | de ▷Stürme |
| EIKE | de Hurrikan, Taifun. |
| WUWT | en Tornado Page, Tropical Cyclone Page |
| NoTricksZone | en Hurricanes / Tornados |
| Popular Technology | en Hurricanes, Storms, Tornadoes. |
| Wikipedia |
de
Meeresspiegel en Sea level fr Niveau de la mer |
| Vademecum |
▶Wintersturm
▶Welt-Info |
| Siehe auch | ▶Extremwetter |
|
|
|
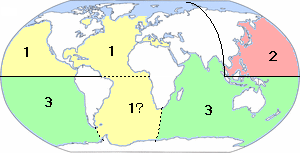
|
1 Hurrikan (Orkan) |
| de | en | fr |
|---|---|---|
| Wetterphänomene (Teil 2) | Weather phenomena (Part 2) | Phénomènes météorologiques (partie 2) |
| Sturm (Wintersturm) | Storm | Tempête |
| Tropischer Wirbelsturm | Tropical cyclone | Cyclone tropical |
| Hurrikan | Hurricane | Ouragan (Cyclone tropical) |
| Medicane | Mediterranean tropical-like cyclone | Cyclone subtropical méditerranéen |
| Taifun | Typhoon | Typhon |
| Tornado | Tornado | Tornade |
| Zyklon | Cyclone | Cyclone |
| Sturmflut | Storm surge | Onde de tempête |
| Blizzard | Blizzard | Blizzard (météorologie) |
| Wind | Wind | Vent |
| Jetstream | Jet stream | Courant-jet |
| Monsun | Monsoon | Mousson |
| Blockierte Wetterlagen | Block (meteorology) | Blocage (météorologie) |
⇧ de Allgemein en General fr Générale
-
Wikipedia
de
Jetstream
en Jet stream
fr Courant-jet
⇧ de Text en Text fr Texte
⇧ 2018
↑
Studie zeigt, dass die globale Erwärmung den Jetstream nicht
verändern wird
en
Study Shows That Global Warming Will NOT Alter The Jet Stream
-
EIKE Europäisches Institut für Klima und Energie
Michael Bastasch / Andreas Demmig
2018-03-26 de Studie zeigt, dass die globale Erwärmung den Jetstream nicht verändern wirdDer Jetstream ist der Schlüssel für die Fähigkeit von Meteorologen, kurzfristige Wettermuster vorherzusagen und der Atmosphärenwissenschaftler Anthony Lupo und der Doktorand Andrew Jensen wollten sehen, ob das Hinzufügen von mehr Kohlendioxid in die Atmosphäre den Jetstream-Fluss beeinflussen würde.
Nein, CO2 beeinflusst den Jetstream nicht.
Lupo und Jensen untersuchten die Ergebnisse von Klimamodellen und fanden bis zu 35 Jetstream-Strömungsänderungen pro Jahr, ähnlich dem heutigen Klima.
-
The Daily Caller / Michael Bastasch
2018-02-21 en Study Shows That Global Warming Will NOT Alter The Jet StreamMan-made global warming is not going to make it harder to predict the weather, according to a new study by University of Missouri scientists.
The jet stream is key to the ability of meteorologists to forecast short-term weather patterns, and Atmospheric scientist Anthony Lupo and doctoral student Andrew Jensen wanted to see if adding more carbon dioxide to the atmosphere would affect jet stream flow.
It didn't. Examining climate model outputs, Lupo and Jensen found jet stream flow changes up to 35 times a year, similar to today's climate.
Weather forecasts are made within the 10 to 12 days between jet stream flow changes, making this pattern crucial for forecasts
⇧
31 Monsun
en Monsoon
fr Mousson
Mit folgenden Links wird von anderen Webseiten auf diese Seite verwiesen:
| de | en | fr |
|---|---|---|
|
Wetterphänomene Monsun |
Weather phenomena Monsoon |
Phénomènes météorologiques Mousson |
⇧ de Verzeichnis en Contents fr Sommaire
- Einfluss der Sonne auf den Monsun
- de
Einfluss der Sonne auf den Monsun
fr Solar inpact on the Monsoon
fr Impacte du soleit sur le mousson - Monsun-Modelle
- de Modellversagen: Simulationen bekommen den Indischen Monsun nicht in den Griff
⇧ Welt-Info
|
|
Stürme / Storm / Tempête |
| ▷Die Kalte Sonne Blog‑Themen Vahrenholt/Lüning ▶Die kalte Sonne | de ▷Stürme |
| EIKE | de Hurrikan, Taifun. |
| WUWT | en Tornado Page, Tropical Cyclone Page |
| NoTricksZone | en Hurricanes / Tornados |
| Popular Technology | en Hurricanes, Storms, Tornadoes. |
| Wikipedia |
de
Meeresspiegel en Sea level fr Niveau de la mer |
| Vademecum |
▶Wintersturm
▶Welt-Info |
| Siehe auch | ▶Extremwetter |
|
|
|
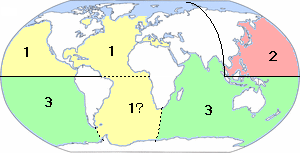
|
1 Hurrikan (Orkan) |
| de | en | fr |
|---|---|---|
| Wetterphänomene (Teil 2) | Weather phenomena (Part 2) | Phénomènes météorologiques (partie 2) |
| Sturm (Wintersturm) | Storm | Tempête |
| Tropischer Wirbelsturm | Tropical cyclone | Cyclone tropical |
| Hurrikan | Hurricane | Ouragan (Cyclone tropical) |
| Medicane | Mediterranean tropical-like cyclone | Cyclone subtropical méditerranéen |
| Taifun | Typhoon | Typhon |
| Tornado | Tornado | Tornade |
| Zyklon | Cyclone | Cyclone |
| Sturmflut | Storm surge | Onde de tempête |
| Blizzard | Blizzard | Blizzard (météorologie) |
| Wind | Wind | Vent |
| Jetstream | Jet stream | Courant-jet |
| Monsun | Monsoon | Mousson |
| Blockierte Wetterlagen | Block (meteorology) | Blocage (météorologie) |
⇧ de Allgemein en General fr Générale
⇧ de Text en Text fr Texte
⇧ Einfluss der Sonne auf den Monsun
↑
Einfluss der Sonne auf den Monsun
en Solar inpact on the Monsoon
fr Impacte du soleit sur le mousson
- a de Über Feuchtigkeit und Trockenheit in Südchina entschied während der letzten 7000 Jahre unsere liebe Sonne: Millenniumszyklen im ostasiatischen Monsun
- b de Sonnenaktivität steuerte den südamerikanischen Monsunregen während der letzten 1500 Jahre
- c de Neue Studie in den Geophysical Research Letters: Indischer Monsunregen pulsierte während der letzten 150 Jahre im Takte der 11-Jahres-Sonnenfleckenzyklen
- d de Neue PIK-Studie sagt Monsunstörung vorher: Zeit für einen Faktencheck
↑ a Über Feuchtigkeit und Trockenheit in Südchina entschied während der letzten 7000 Jahre unsere liebe Sonne: Millenniumszyklen im ostasiatischen Monsun
-
Die kalte Sonne (Fritz Vahrenholt & Sebastian Lüning)
2012-05-16 de Über Feuchtigkeit und Trockenheit in Südchina entschied während der letzten 7000 Jahre unsere liebe Sonne: Millenniumszyklen im ostasiatischen Monsun
↑ b Sonnenaktivität steuerte den südamerikanischen Monsunregen während der letzten 1500 Jahre
-
Die kalte Sonne (Fritz Vahrenholt & Sebastian Lüning)
2012-03-12 de Sonnenaktivität steuerte den südamerikanischen Monsunregen während der letzten 1500 Jahre
↑ c Neue Studie in den Geophysical Research Letters: Indischer Monsunregen pulsierte während der letzten 150 Jahre im Takte der 11-Jahres-Sonnenfleckenzyklen
-
Die kalte Sonne (Fritz Vahrenholt & Sebastian Lüning)
2012-09-19 de Neue Studie in den Geophysical Research Letters: Indischer Monsunregen pulsierte während der letzten 150 Jahre im Takte der 11-Jahres-Sonnenfleckenzyklen
↑ d Neue PIK-Studie sagt Monsunstörung vorher: Zeit für einen Faktencheck
-
Die kalte Sonne (Fritz Vahrenholt & Sebastian Lüning)
2012-12-03 de Neue PIK-Studie sagt Monsunstörung vorher: Zeit für einen Faktencheck
⇧ Monsun-Modelle
↑ Modellversagen: Simulationen bekommen den Indischen Monsun nicht in den Griff
-
Die kalte Sonne (Fritz Vahrenholt & Sebastian Lüning)
2017-06-17 de Modellversagen: Simulationen bekommen den Indischen Monsun nicht in den Griff
Klimamodelle simulieren die Wirklichkeit. Die Erfolgsquote ist durchwachsen.
Während in den Medien oft suggeriert wird, alles wäre bestens unter Kontrolle, sieht die Wirklichkeit leider ander aus.
Nehmen wir das Beispiel des Indischen Monsuns, dem lebenswichtigen Regenspender in der Region.
Bereits im Oktober 2014 ließen Anamira Saha und Kollegen in den Geophysical Research Letters "eine Bombe platzen":
Der Monsun hat in den letzten 60 Jahren langfristig abgenommen.Jedoch können die Modelle diesen Trend nicht reproduzieren.
Schlimmer noch, die Modelle können nicht einmal die generellen Veränderungen der atmopshärischen Zirkulation und Temperaturmuster der Ozeangebiete nachvollziehen.
Ein absolutes Debakel, wenn man bedenkt, dass dieselben Modell im großen Maßstab als Begründung für weitreichende gessellschaftsumbildende Maßnahmen herangezogen werden.
Geophysical Research Letters Failure of CMIP5 climate models in simulating post-1950 decreasing trend of Indian monsoon
Zu einem ähnlichen Schluss kam Venkatraman Prasanna im April 2016 im Fachblatt Pure and Applied Geophysics.
Die Modelle unterscheiden sich so stark voneinander, dass die Resultate beliebig werden:
Pure and Applied Geophysics Assessment of South Asian Summer Monsoon Simulation in CMIP5-Coupled Climate Models During the Historical Period (1850-2005)
⇧
32 Blockierte Wetterlagen
en Block (meteorology)
fr Blocage (météorologie)
Mit folgenden Links wird von anderen Webseiten auf diese Seite verwiesen:
| de | en | fr |
|---|---|---|
|
Wetterphänomene Blockierte Wetterlagen |
Weather phenomena Block (meteorology) |
Phénomènes météorologiques Blocage (météorologie) |
Links zur Klimaschau
|
|
▶Wetterphänomene ▶Extremwetter ▶Dürre ▶Niederschläge ▶Waldbrände ▶Wintersturm ▶Tropischer Wirbelsturm ▶Hurrikan ▶Blockierte Wetterlagen ▶Todesfälle wegen Extremwetter |
⇧ de Verzeichnis en Contents fr Sommaire
- 2018
- de
Blockierte Wetterlagen könnten im Pazifik zukünftig seltener werden
en New theory finds 'traffic jams' in jet stream cause abnormal weather patterns - Study explains blocking phenomenon that has baffled forecasters
⇧ Welt-Info
|
|
Stürme / Storm / Tempête |
| ▷Die Kalte Sonne Blog‑Themen Vahrenholt/Lüning ▶Die kalte Sonne | de ▷Stürme |
| EIKE | de Hurrikan, Taifun. |
| WUWT | en Tornado Page, Tropical Cyclone Page |
| NoTricksZone | en Hurricanes / Tornados |
| Popular Technology | en Hurricanes, Storms, Tornadoes. |
| Wikipedia |
de
Meeresspiegel en Sea level fr Niveau de la mer |
| Vademecum |
▶Wintersturm
▶Welt-Info |
| Siehe auch | ▶Extremwetter |
|
|
|
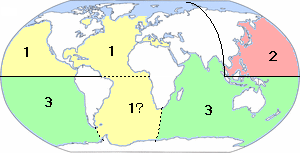
|
1 Hurrikan (Orkan) |
| de | en | fr |
|---|---|---|
| Wetterphänomene (Teil 2) | Weather phenomena (Part 2) | Phénomènes météorologiques (partie 2) |
| Sturm (Wintersturm) | Storm | Tempête |
| Tropischer Wirbelsturm | Tropical cyclone | Cyclone tropical |
| Hurrikan | Hurricane | Ouragan (Cyclone tropical) |
| Medicane | Mediterranean tropical-like cyclone | Cyclone subtropical méditerranéen |
| Taifun | Typhoon | Typhon |
| Tornado | Tornado | Tornade |
| Zyklon | Cyclone | Cyclone |
| Sturmflut | Storm surge | Onde de tempête |
| Blizzard | Blizzard | Blizzard (météorologie) |
| Wind | Wind | Vent |
| Jetstream | Jet stream | Courant-jet |
| Monsun | Monsoon | Mousson |
| Blockierte Wetterlagen | Block (meteorology) | Blocage (météorologie) |
⇧ de Allgemein en General fr Générale
-
Wikipedia
de
Omegalage
en Block (meteorology)
fr Blocage (météorologie)
⇧ de Text en Text fr Texte
⇧ 2018
↑
Blockierte Wetterlagen könnten im Pazifik zukünftig seltener werden
en
New theory finds 'traffic jams' in jet stream cause abnormal
weather patterns -
Study explains blocking phenomenon that has baffled forecasters
-
Die kalte Sonne (Fritz Vahrenholt & Sebastian Lüning)
2018-06-22 de Blockierte Wetterlagen könnten im Pazifik zukünftig seltener werdenBlockierte Wetterlagen bringen Hitzewellen und anderes Extremwetter.
Forscher der Unversity of Chicago haben jetzt den Mechanismus in einem einfachen Modell näher beschrieben.
Sie schlussfolgern unter anderem, dass die Klimaerwärmung keine generelle Zunahme der blockierten Wetterlagen bringt, sondern regional sehr unterschiedlich ausfallen könnte.
Im Pazifik beispielsweise erwarten die Wissenschaftler sogar eine Abnahme der Blockagen (via Science Daily)
-
ScienceDaily / University of Chicago
2018-05-24 en New theory finds 'traffic jams' in jet stream cause abnormal weather patterns - Study explains blocking phenomenon that has baffled forecastersSummary
A study offers an explanation for a mysterious and sometimes deadly weather pattern in which the jet stream, the global air currents that circle the Earth, stalls out over a region.
Much like highways, the jet stream has a capacity, researchers said, and when it's exceeded, blockages form that are remarkably similar to traffic jams - and climate forecasters can use the same math to model them both.